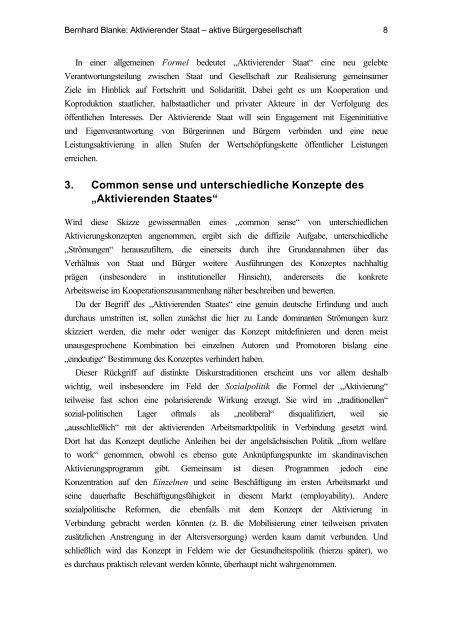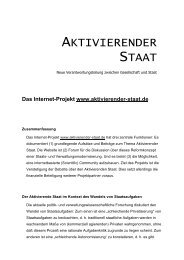Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Bernhard</strong> <strong>Blanke</strong>: <strong>Aktivierender</strong> <strong>Staat</strong> – <strong>aktive</strong> <strong>Bürgergesellschaft</strong><br />
In einer allgemeinen Formel bedeutet „<strong>Aktivierender</strong> <strong>Staat</strong>“ eine neu gelebte<br />
Verantwortungsteilung zwischen <strong>Staat</strong> und Gesellschaft zur Realisierung gemeinsamer<br />
Ziele im Hinblick auf Fortschritt und Solidarität. Dabei geht es um Kooperation und<br />
Koproduktion staatlicher, halbstaatlicher und privater Akteure in der Verfolgung des<br />
öffentlichen Interesses. Der Aktivierende <strong>Staat</strong> will sein Engagement mit Eigeninitiative<br />
und Eigenverantwortung von Bürgerinnen und Bürgern verbinden und eine neue<br />
Leistungsaktivierung in allen Stufen der Wertschöpfungskette öffentlicher Leistungen<br />
erreichen.<br />
3. Common sense und unterschiedliche Konzepte des<br />
„Aktivierenden <strong>Staat</strong>es“<br />
Wird diese Skizze gewissermaßen eines „common sense“ von unterschiedlichen<br />
Aktivierungskonzepten angenommen, ergibt sich die diffizile Aufgabe, unterschiedliche<br />
„Strömungen“ herauszufiltern, die einerseits durch ihre Grundannahmen über das<br />
Verhältnis von <strong>Staat</strong> und Bürger weitere Ausführungen des Konzeptes nachhaltig<br />
prägen (insbesondere in institutioneller Hinsicht), andererseits die konkrete<br />
Arbeitsweise im Kooperationszusammenhang näher beschreiben und bewerten.<br />
Da der Begriff des „Aktivierenden <strong>Staat</strong>es“ eine genuin deutsche Erfindung und auch<br />
durchaus umstritten ist, sollen zunächst die hier zu Lande dominanten Strömungen kurz<br />
skizziert werden, die mehr oder weniger das Konzept mitdefinieren und deren meist<br />
unausgesprochene Kombination bei einzelnen Autoren und Promotoren bislang eine<br />
„eindeutige“ Bestimmung des Konzeptes verhindert haben.<br />
Dieser Rückgriff auf distinkte Diskurstraditionen erscheint uns vor allem deshalb<br />
wichtig, weil insbesondere im Feld der Sozialpolitik die Formel der „Aktivierung“<br />
teilweise fast schon eine polarisierende Wirkung erzeugt. Sie wird im „traditionellen“<br />
sozial-politischen Lager oftmals als „neoliberal“ disqualifiziert, weil sie<br />
„ausschließlich“ mit der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik in Verbindung gesetzt wird.<br />
Dort hat das Konzept deutliche Anleihen bei der angelsächsischen Politik „from welfare<br />
to work“ genommen, obwohl es ebenso gute Anknüpfungspunkte im skandinavischen<br />
Aktivierungsprogramm gibt. Gemeinsam ist diesen Programmen jedoch eine<br />
Konzentration auf den Einzelnen und seine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt und<br />
seine dauerhafte Beschäftigungsfähigkeit in diesem Markt (employability). Andere<br />
sozialpolitische Reformen, die ebenfalls mit dem Konzept der Aktivierung in<br />
Verbindung gebracht werden könnten (z. B. die Mobilisierung einer teilweisen privaten<br />
zusätzlichen Anstrengung in der Altersversorgung) werden kaum damit verbunden. Und<br />
schließlich wird das Konzept in Feldern wie der Gesundheitspolitik (hierzu später), wo<br />
es durchaus praktisch relevant werden könnte, überhaupt nicht wahrgenommen.<br />
8