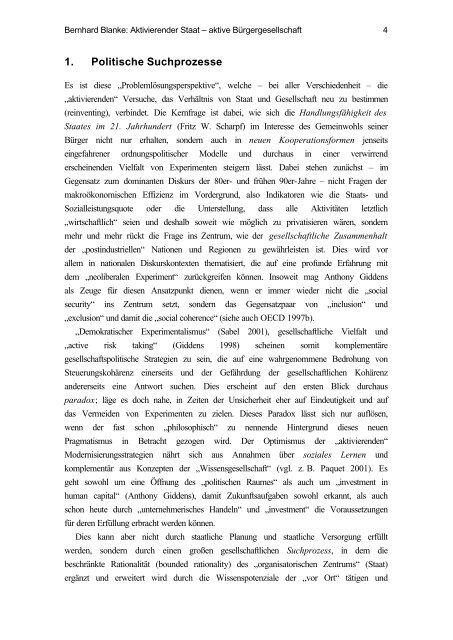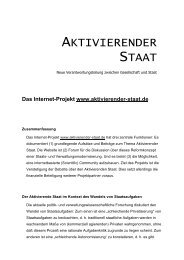Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Bernhard</strong> <strong>Blanke</strong>: <strong>Aktivierender</strong> <strong>Staat</strong> – <strong>aktive</strong> <strong>Bürgergesellschaft</strong><br />
1. Politische Suchprozesse<br />
Es ist diese „Problemlösungsperspektive“, welche – bei aller Verschiedenheit – die<br />
„aktivierenden“ Versuche, das Verhältnis von <strong>Staat</strong> und Gesellschaft neu zu bestimmen<br />
(reinventing), verbindet. Die Kernfrage ist dabei, wie sich die Handlungsfähigkeit des<br />
<strong>Staat</strong>es im 21. Jahrhundert (Fritz W. Scharpf) im Interesse des Gemeinwohls seiner<br />
Bürger nicht nur erhalten, sondern auch in neuen Kooperationsformen jenseits<br />
eingefahrener ordnungspolitischer Modelle und durchaus in einer verwirrend<br />
erscheinenden Vielfalt von Experimenten steigern lässt. Dabei stehen zunächst – im<br />
Gegensatz zum dominanten Diskurs der 80er- und frühen 90er-Jahre – nicht Fragen der<br />
makroökonomischen Effizienz im Vordergrund, also Indikatoren wie die <strong>Staat</strong>s- und<br />
Sozialleistungsquote oder die Unterstellung, dass alle Aktivitäten letztlich<br />
„wirtschaftlich“ seien und deshalb soweit wie möglich zu privatisieren wären, sondern<br />
mehr und mehr rückt die Frage ins Zentrum, wie der gesellschaftliche Zusammenhalt<br />
der „postindustriellen“ Nationen und Regionen zu gewährleisten ist. Dies wird vor<br />
allem in nationalen Diskurskontexten thematisiert, die auf eine profunde Erfahrung mit<br />
dem „neoliberalen Experiment“ zurückgreifen können. Insoweit mag Anthony Giddens<br />
als Zeuge für diesen Ansatzpunkt dienen, wenn er immer wieder nicht die „social<br />
security“ ins Zentrum setzt, sondern das Gegensatzpaar von „inclusion“ und<br />
„exclusion“ und damit die „social coherence“ (siehe auch OECD 1997b).<br />
„Demokratischer Experimentalismus“ (Sabel 2001), gesellschaftliche Vielfalt und<br />
„active risk taking“ (Giddens 1998) scheinen somit komplementäre<br />
gesellschaftspolitische Strategien zu sein, die auf eine wahrgenommene Bedrohung von<br />
Steuerungskohärenz einerseits und der Gefährdung der gesellschaftlichen Kohärenz<br />
andererseits eine Antwort suchen. Dies erscheint auf den ersten Blick durchaus<br />
paradox; läge es doch nahe, in Zeiten der Unsicherheit eher auf Eindeutigkeit und auf<br />
das Vermeiden von Experimenten zu zielen. Dieses Paradox lässt sich nur auflösen,<br />
wenn der fast schon „philosophisch“ zu nennende Hintergrund dieses neuen<br />
Pragmatismus in Betracht gezogen wird. Der Optimismus der „aktivierenden“<br />
Modernisierungsstrategien nährt sich aus Annahmen über soziales Lernen und<br />
komplementär aus Konzepten der „Wissensgesellschaft“ (vgl. z. B. Paquet 2001). Es<br />
geht sowohl um eine Öffnung des „politischen Raumes“ als auch um „investment in<br />
human capital“ (Anthony Giddens), damit Zukunftsaufgaben sowohl erkannt, als auch<br />
schon heute durch „unternehmerisches Handeln“ und „investment“ die Voraussetzungen<br />
für deren Erfüllung erbracht werden können.<br />
Dies kann aber nicht durch staatliche Planung und staatliche Versorgung erfüllt<br />
werden, sondern durch einen großen gesellschaftlichen Suchprozess, in dem die<br />
beschränkte Rationalität (bounded rationality) des „organisatorischen Zentrums“ (<strong>Staat</strong>)<br />
ergänzt und erweitert wird durch die Wissenspotenziale der „vor Ort“ tätigen und<br />
4