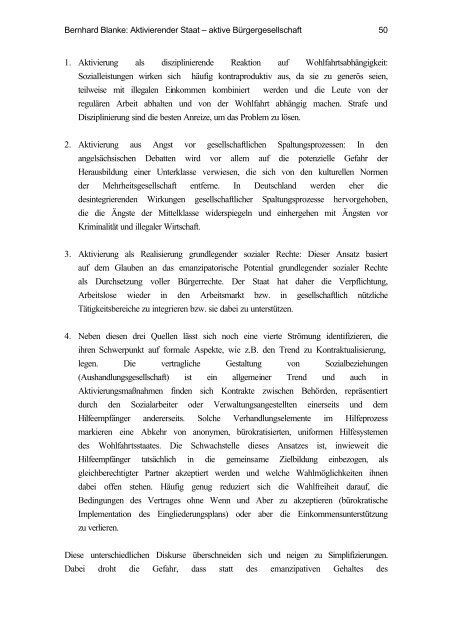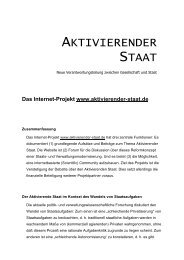Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Bernhard</strong> <strong>Blanke</strong>: <strong>Aktivierender</strong> <strong>Staat</strong> – <strong>aktive</strong> <strong>Bürgergesellschaft</strong><br />
1. Aktivierung als disziplinierende Reaktion auf Wohlfahrtsabhängigkeit:<br />
Sozialleistungen wirken sich häufig kontraproduktiv aus, da sie zu generös seien,<br />
teilweise mit illegalen Einkommen kombiniert werden und die Leute von der<br />
regulären Arbeit abhalten und von der Wohlfahrt abhängig machen. Strafe und<br />
Disziplinierung sind die besten Anreize, um das Problem zu lösen.<br />
2. Aktivierung aus Angst vor gesellschaftlichen Spaltungsprozessen: In den<br />
angelsächsischen Debatten wird vor allem auf die potenzielle Gefahr der<br />
Herausbildung einer Unterklasse verwiesen, die sich von den kulturellen Normen<br />
der Mehrheitsgesellschaft entferne. In Deutschland werden eher die<br />
desintegrierenden Wirkungen gesellschaftlicher Spaltungsprozesse hervorgehoben,<br />
die die Ängste der Mittelklasse widerspiegeln und einhergehen mit Ängsten vor<br />
Kriminalität und illegaler Wirtschaft.<br />
3. Aktivierung als Realisierung grundlegender sozialer Rechte: Dieser Ansatz basiert<br />
auf dem Glauben an das emanzipatorische Potential grundlegender sozialer Rechte<br />
als Durchsetzung voller Bürgerrechte. Der <strong>Staat</strong> hat daher die Verpflichtung,<br />
Arbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt bzw. in gesellschaftlich nützliche<br />
Tätigkeitsbereiche zu integrieren bzw. sie dabei zu unterstützen.<br />
4. Neben diesen drei Quellen lässt sich noch eine vierte Strömung identifizieren, die<br />
ihren Schwerpunkt auf formale Aspekte, wie z.B. den Trend zu Kontraktualisierung,<br />
legen. Die vertragliche Gestaltung von Sozialbeziehungen<br />
(Aushandlungsgesellschaft) ist ein allgemeiner Trend und auch in<br />
Aktivierungsmaßnahmen finden sich Kontrakte zwischen Behörden, repräsentiert<br />
durch den Sozialarbeiter oder Verwaltungsangestellten einerseits und dem<br />
Hilfeempfänger andererseits. Solche Verhandlungselemente im Hilfeprozess<br />
markieren eine Abkehr von anonymen, bürokratisierten, uniformen Hilfesystemen<br />
des Wohlfahrtsstaates. Die Schwachstelle dieses Ansatzes ist, inwieweit die<br />
Hilfeempfänger tatsächlich in die gemeinsame Zielbildung einbezogen, als<br />
gleichberechtigter Partner akzeptiert werden und welche Wahlmöglichkeiten ihnen<br />
dabei offen stehen. Häufig genug reduziert sich die Wahlfreiheit darauf, die<br />
Bedingungen des Vertrages ohne Wenn und Aber zu akzeptieren (bürokratische<br />
Implementation des Eingliederungsplans) oder aber die Einkommensunterstützung<br />
zu verlieren.<br />
Diese unterschiedlichen Diskurse überschneiden sich und neigen zu Simplifizierungen.<br />
Dabei droht die Gefahr, dass statt des emanzipativen Gehaltes des<br />
50