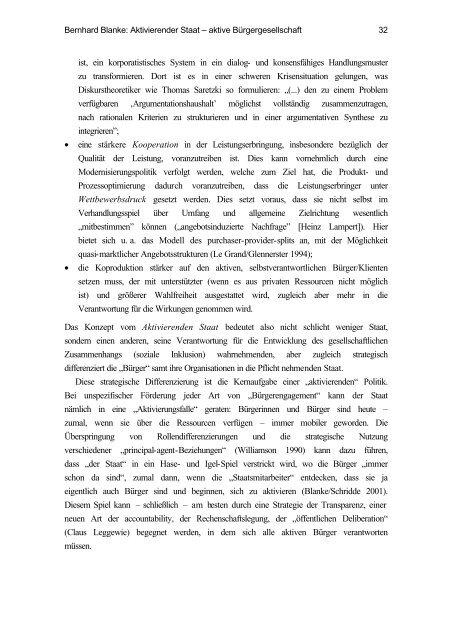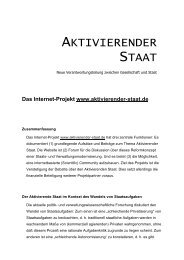Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Bernhard</strong> <strong>Blanke</strong>: <strong>Aktivierender</strong> <strong>Staat</strong> – <strong>aktive</strong> <strong>Bürgergesellschaft</strong><br />
ist, ein korporatistisches System in ein dialog- und konsensfähiges Handlungsmuster<br />
zu transformieren. Dort ist es in einer schweren Krisensituation gelungen, was<br />
Diskurstheoretiker wie Thomas Saretzki so formulieren: „(...) den zu einem Problem<br />
verfügbaren ‚Argumentationshaushalt’ möglichst vollständig zusammenzutragen,<br />
nach rationalen Kriterien zu strukturieren und in einer argumentativen Synthese zu<br />
integrieren”;<br />
• eine stärkere Kooperation in der Leistungserbringung, insbesondere bezüglich der<br />
Qualität der Leistung, voranzutreiben ist. Dies kann vornehmlich durch eine<br />
Modernisierungspolitik verfolgt werden, welche zum Ziel hat, die Produkt- und<br />
Prozessoptimierung dadurch voranzutreiben, dass die Leistungserbringer unter<br />
Wettbewerbsdruck gesetzt werden. Dies setzt voraus, dass sie nicht selbst im<br />
Verhandlungsspiel über Umfang und allgemeine Zielrichtung wesentlich<br />
„mitbestimmen” können („angebotsinduzierte Nachfrage” [Heinz Lampert]). Hier<br />
bietet sich u. a. das Modell des purchaser-provider-splits an, mit der Möglichkeit<br />
quasi-marktlicher Angebotsstrukturen (Le Grand/Glennerster 1994);<br />
• die Koproduktion stärker auf den <strong>aktive</strong>n, selbstverantwortlichen Bürger/Klienten<br />
setzen muss, der mit unterstützter (wenn es aus privaten Ressourcen nicht möglich<br />
ist) und größerer Wahlfreiheit ausgestattet wird, zugleich aber mehr in die<br />
Verantwortung für die Wirkungen genommen wird.<br />
Das Konzept vom Aktivierenden <strong>Staat</strong> bedeutet also nicht schlicht weniger <strong>Staat</strong>,<br />
sondern einen anderen, seine Verantwortung für die Entwicklung des gesellschaftlichen<br />
Zusammenhangs (soziale Inklusion) wahrnehmenden, aber zugleich strategisch<br />
differenziert die „Bürger“ samt ihre Organisationen in die Pflicht nehmenden <strong>Staat</strong>.<br />
Diese strategische Differenzierung ist die Kernaufgabe einer „aktivierenden“ Politik.<br />
Bei unspezifischer Förderung jeder Art von „Bürgerengagement“ kann der <strong>Staat</strong><br />
nämlich in eine „Aktivierungsfalle“ geraten: Bürgerinnen und Bürger sind heute –<br />
zumal, wenn sie über die Ressourcen verfügen – immer mobiler geworden. Die<br />
Überspringung von Rollendifferenzierungen und die strategische Nutzung<br />
verschiedener „principal-agent-Beziehungen“ (Williamson 1990) kann dazu führen,<br />
dass „der <strong>Staat</strong>“ in ein Hase- und Igel-Spiel verstrickt wird, wo die Bürger „immer<br />
schon da sind“, zumal dann, wenn die „<strong>Staat</strong>smitarbeiter“ entdecken, dass sie ja<br />
eigentlich auch Bürger sind und beginnen, sich zu aktivieren (<strong>Blanke</strong>/Schridde 2001).<br />
Diesem Spiel kann – schließlich – am besten durch eine Strategie der Transparenz, einer<br />
neuen Art der accountability, der Rechenschaftslegung, der „öffentlichen Deliberation“<br />
(Claus Leggewie) begegnet werden, in dem sich alle <strong>aktive</strong>n Bürger verantworten<br />
müssen.<br />
32