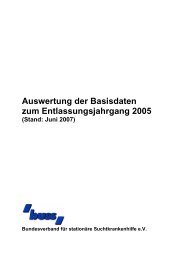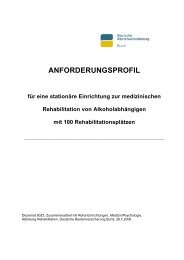Rahmenkonzept medizinische Rehabilitation
Rahmenkonzept medizinische Rehabilitation
Rahmenkonzept medizinische Rehabilitation
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
verwendet werden, bei denen weiterführende, differenzierte psychodiagnostische<br />
Verfahren erforderlich sind. Inhalte der Psychodiagnostik können insbesondere sein:<br />
1<br />
> kognitive Kapazitäten und Potentiale,<br />
> Status und Fähigkeiten der Krankheitsverarbeitung,<br />
> psychische Beeinträchtigungen.<br />
Forschungsergebnisse haben gezeigt, wie wichtig gerade die psychische Komorbidität<br />
für den weiteren Verlauf der Erkrankung und ihrer Folgen sein kann.<br />
Bei psychischen Störungen kommen weitere Inhalte der Psychodiagnostik hinzu (vgl.<br />
die entsprechenden speziellen Konzepte und Empfehlungen) 28, 29 .<br />
Hinsichtlich der Diagnostik berufsbezogener Einschränkungen sollten die Ergebnisse<br />
der Eingangsuntersuchung ebenfalls dazu führen, im Bedarfsfall weitergehende<br />
funktions- bzw. leistungsbezogene Untersuchungen (z. B. in Form von Belastungserprobungen<br />
und anderen arbeitstherapeutischen Maßnahmen mit begleitender<br />
<strong>medizinische</strong>r und psychophysiologischer Belastbarkeitsdiagnostik) und berufsbezogene<br />
Beratungen zu veranlassen.<br />
Kontextfaktoren<br />
Wichtige Informationen zu den im Einzelfall vorliegenden Kontextfaktoren erhalten<br />
zunächst die Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung bei der<br />
Erhebung der Krankheitsvorgeschichte, der sozialen und beruflichen Situation (z. B.<br />
Analyse und Beschreibung des Arbeitsplatzes) sowie im Rahmen der orientierenden<br />
psychosozialen Diagnostik. Diese erhebt insbesondere psychische und soziale Belastungen,<br />
Probleme der sozialen Integration infolge der gesundheitlichen Störungen<br />
sowie berufsbezogene Einschränkungen. Auf der Grundlage dieser Informationen und<br />
in der Regel unter Verwendung von geeigneten psychologischen Messinstrumenten<br />
erfolgt dann eine gezielte problemorientierte Diagnostik. Diese bezieht sich auf Krankheitsfolgen<br />
und Krankheitsverarbeitung, Gesundheitsverhalten, Motivation und<br />
Erwartungshaltung ebenso wie auf etwaiges Suchtverhalten, Ernährungsgewohnheiten<br />
sowie psychische Belastungsmomente und die sozialen Lebensumstände (z. B. Arbeitslosigkeit<br />
als zusätzlicher Kontextfaktor). Die vorliegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen<br />
können auf diese Weise im Zusammenhang mit der individuellen<br />
psychosozialen Situation (Familienintegration, Lebensplanung, Unterstützung innerhalb<br />
und außerhalb der Familie, berufliche und finanzielle Situation) gesehen werden.<br />
Die ersten Angaben und Eindrücke werden im Verlauf der weiteren rehabilitativen<br />
Behandlung ergänzt und vertieft, z. B. bei Visiten, therapeutisch orientierten Gesprächen<br />
und Teambesprechungen.<br />
5.3 <strong>Rehabilitation</strong>s- bzw. Therapieziele<br />
Zentrales Ziel der <strong>medizinische</strong>n <strong>Rehabilitation</strong> durch die gesetzliche Rentenversicherung<br />
ist es, einer (drohenden oder eingetretenen) Minderung der Leistungsfähigkeit<br />
im Erwerbsleben zu begegnen, um damit die Teilhabe zu sichern (vgl.<br />
Abschnitt 2.2). Die individuellen <strong>Rehabilitation</strong>s- und Therapieziele, die den vorgenannten<br />
allgemeinen <strong>Rehabilitation</strong>sauftrag im Einzelfall ausfüllen, werden auf<br />
der Basis der durchgeführten Diagnostik festgelegt. In der Regel erfolgt dies in<br />
Abstimmung zwischen Rehabilitand und <strong>Rehabilitation</strong>steam. Die Formulierung<br />
der Behandlungsziele ist eine wesentliche Aufgabe zu Beginn der <strong>Rehabilitation</strong>.<br />
Die Ziele setzen dabei auf unterschiedlichen Ebenen an. <strong>Rehabilitation</strong>sziele sind<br />
in der Regel übergreifend formuliert. Sie beziehen sich auf ein ganzheitliches<br />
<strong>Rehabilitation</strong>skonzept und den Erfolg der <strong>Rehabilitation</strong>sleistung insgesamt.<br />
28 Vgl. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger VDR (Hrsg.) (2001): Empfehlungen für die sozial<strong>medizinische</strong> Beurteilung psychischer<br />
Vgl. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger VDR (Hrsg.) (2001): Empfehlungen für die sozial<strong>medizinische</strong> Beurteilung psychischer<br />
Störungen. Hinweise zur Begutachtung. DRV-Schriften 0. Frankfurt am Main.<br />
29 Vgl. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger VDR (Hrsg.) (200 ): Abschlussbericht der Kommission zur Weiterentwicklung der<br />
Sozialmedizin in der gesetzlichen Rentenversicherung SOMEKO. DRV-Schriften . Frankfurt am Main.