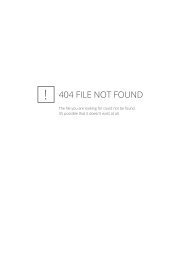Der Setting-Ansatz in der Gesundheitsförderung ... - Bibliothek - WZB
Der Setting-Ansatz in der Gesundheitsförderung ... - Bibliothek - WZB
Der Setting-Ansatz in der Gesundheitsförderung ... - Bibliothek - WZB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
auf <strong>der</strong> Erkenntnis, daß Gesundheitsprobleme e<strong>in</strong>er Bevölkerungsgruppe das Resultat<br />
e<strong>in</strong>er wechselseitigen Beziehung zwischen ökonomischer, sozialer und <strong>in</strong>stitutioneller<br />
Umwelt und persönlichem Verhalten s<strong>in</strong>d“ (Grossmann & Scala, 1996,<br />
S. 66). Damit wurde die Abkehr vom Fokus auf mediz<strong>in</strong>ische Probleme von Individuen<br />
verbunden mit <strong>der</strong> neuen Gesundheitsför<strong>der</strong>ung als Kernstück e<strong>in</strong>er „New<br />
Public Health“. Statt auf den e<strong>in</strong>zelnen Menschen und se<strong>in</strong> <strong>in</strong>dividuelles Verhalten<br />
sollte <strong>der</strong> Blickw<strong>in</strong>kel auf die gesundheitlichen Belange von Menschen <strong>in</strong> ihren gesellschaftlichen<br />
und sozialen Systemen gerichtet werden, <strong>in</strong> denen Gesundheit<br />
außerhalb des Mediz<strong>in</strong>betriebs im alltäglichen Arbeiten und Leben gestaltet wird<br />
(z. B. Altgeld, 2004; Barić & Conrad, 1999). Dieser konzeptionelle „Eckpfeiler“ des<br />
<strong>Sett<strong>in</strong>g</strong>-<strong>Ansatz</strong>es wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Literatur weitgehend geteilt. Es<br />
kann zunächst festgestellt werden, dass beim <strong>Sett<strong>in</strong>g</strong>-<strong>Ansatz</strong> soziale Systeme den<br />
jeweiligen Interventionsgegenstand darstellen und nicht die gesundheitlichen Probleme<br />
<strong>der</strong> Menschen <strong>in</strong> den <strong>Sett<strong>in</strong>g</strong>s selbst.<br />
Entsprechend dieser Prämisse hat sich auch e<strong>in</strong>e Unterscheidung von „Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />
im <strong>Sett<strong>in</strong>g</strong>“ und e<strong>in</strong>em „gesundheitsför<strong>der</strong>nden <strong>Sett<strong>in</strong>g</strong>“ (Barić<br />
& Conrad, 1999, S. 16) etabliert. Gesundheitsför<strong>der</strong>ung im <strong>Sett<strong>in</strong>g</strong> nutzt lediglich<br />
den sozialen o<strong>der</strong> organisatorischen Rahmen e<strong>in</strong>es <strong>Sett<strong>in</strong>g</strong>s als Zugangsweg zu<br />
den Zielgruppen, um dort „traditionelle“ Aktivitäten <strong>der</strong> Gesundheitsaufklärung o<strong>der</strong><br />
-erziehung stattf<strong>in</strong>den zu lassen (z. B. Dooris, 2004; Rosenbrock, 2004a). Dieser<br />
<strong>Ansatz</strong> hat bereits e<strong>in</strong>e längere Tradition. <strong>Der</strong> „neue“ <strong>Sett<strong>in</strong>g</strong>-<strong>Ansatz</strong> h<strong>in</strong>gegen fokussiert<br />
auf e<strong>in</strong>e Integration gesundheitsför<strong>der</strong>n<strong>der</strong> Aspekte <strong>in</strong> die gesamten Funktionsbed<strong>in</strong>gungen<br />
e<strong>in</strong>es <strong>Sett<strong>in</strong>g</strong>s, <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Struktur, <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Kultur, se<strong>in</strong>e Prozesse<br />
und die Rout<strong>in</strong>en des alltäglichen <strong>Sett<strong>in</strong>g</strong>-Lebens (z. B. Barić & Conrad, 1999;<br />
Dooris, 2004; Rosenbrock, 2004a). Die folgende Tabelle 3 verdeutlicht diese Differenzierung:<br />
Tab. 3: Typen und Arten <strong>der</strong> Primärprävention<br />
Strategie<br />
Interventonsebene<br />
Individuum<br />
(Mikroebene)<br />
<strong>Sett<strong>in</strong>g</strong><br />
(Mesoebene)<br />
Bevölkerung<br />
(Makroebene<br />
Information, Aufklärung,<br />
Beratung<br />
I.<br />
z. B. Ärztliche Gesundheitsbera-<br />
tung, Gesundheitskurse<br />
III.<br />
z. B. Anti-Tabak Aufklärung <strong>in</strong><br />
Schulen<br />
V.<br />
z. B. ‚Esst mehr Obst’, ‚Sport tut<br />
gut’, ‚Rauchen gefährdet die Gesundheit’,<br />
‚Seid nett zue<strong>in</strong>an<strong>der</strong>’<br />
Bee<strong>in</strong>flussung des<br />
Kontextes<br />
II.<br />
z. B. ‚präventiver Hausbesuch’<br />
IV.<br />
z. B. betriebliche Gesundheitsförde-<br />
rung als Organisationsentwicklung<br />
VI.<br />
z. B. HIV/Aids-Kampagne, Trimm<strong>in</strong>g<br />
130<br />
Quelle: Aus „Primäre Prävention zur Verm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung sozial bed<strong>in</strong>gter Ungleichheit von Gesundheitschancen<br />
– Problemskizze und e<strong>in</strong> Politikvorschlag zur Umsetzung des § 20 Abs. 1 SGB V durch die<br />
GKV“ (S. 67) von R. Rosenbrock, 2004. In R. Rosenbrock, M. Bellw<strong>in</strong>kel & A. Schröer (Hrsg.), Primärprävention<br />
im Kontext sozialer Ungleichheit, wissenschaftliche Gutachten zum BKK-Programm<br />
‚Mehr Gesundheit für alle’ (Gesundheitsför<strong>der</strong>ung und Selbsthilfe Band 8) (S. 7-149). Bremerhaven:<br />
Wirtschaftsverlag NW.<br />
33