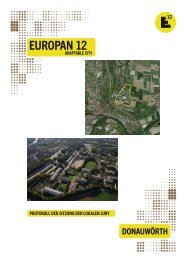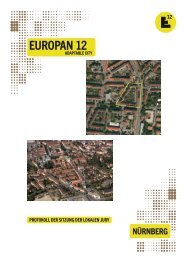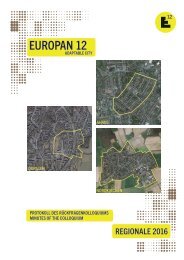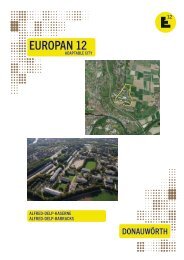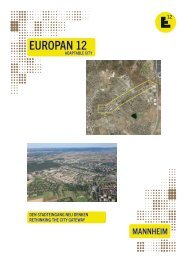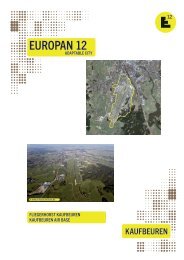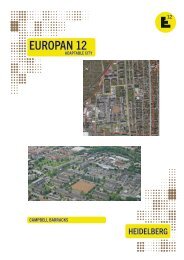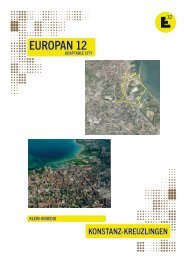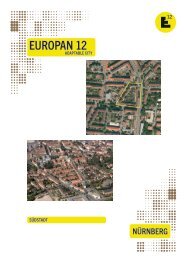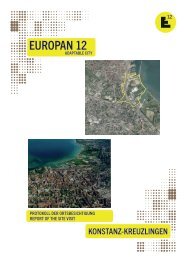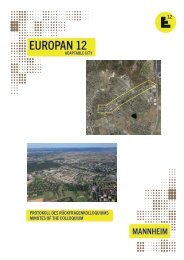Auslobung Bitterfeld-Wolfen - EUROPAN Deutschland
Auslobung Bitterfeld-Wolfen - EUROPAN Deutschland
Auslobung Bitterfeld-Wolfen - EUROPAN Deutschland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
BITTERFELD-WOLFEN<br />
Zweiten Welt krieges hatte im August 1945 der Sowjetunion<br />
deutlich gemacht, dass sie ihre Reparationserwartungen<br />
allein aus der eigenen Besatzungszone<br />
befriedigen müsse. Auch in <strong>Bitterfeld</strong>, <strong>Wolfen</strong> und<br />
Greppin wurden 50 Prozent der Betriebsstätten als<br />
Reparationsleistung demontiert und in die Sowjetunion<br />
verbracht. Alle nicht demontierten Schlüsselindustrien<br />
überführte die Besatzungsmacht in eigene, sowjetische<br />
Aktiengesellschaften. Be troffen von dieser bis 1953<br />
währenden Maßnahme waren die Elektrochemischen<br />
Werke sowie die Film- und Farbenwerke. Die Eingriffe<br />
der Besatzungsmächte wirkten sich besonders nachteilig<br />
für die <strong>Wolfen</strong>er Filmfabrik, die Innovationsschmiede<br />
der 1930er Jahre, aus. Schon vor der Demontage von<br />
Produktions anlagen hatten sich die Amerikaner aller<br />
wichtigen Dokumente und Patentschriften bemächtigt.<br />
Die Folge war ein langjähriger Rechtsstreit um den Markennamen<br />
Agfa, der erst 1964 durch Einführung des<br />
Namens „ORWO – Original <strong>Wolfen</strong>“ aufgelöst werden<br />
konnte. Viele hoch qualifizierte Mitarbeiter verließen bis<br />
1961 die Filmfabrik <strong>Wolfen</strong> in Richtung Westen, und die<br />
zunehmende Abgrenzung der ostdeutschen Wirtschaft<br />
vom Westen zeigte auch hier deutliche Auswirkungen.<br />
Doch schon bald bewegten sich Braunkohleförderung,<br />
Elektroenergieerzeugung und auch der Produktionsausstoß<br />
in der chemischen Industrie auf höchstem<br />
Niveau. Wenig Rücksicht wurde dabei auf Umwelt, Natur<br />
und die Gesundheit der Menschen genommen. Nach der<br />
sowjetischen Besatzungsmacht setzte auch die DDR-Wirtschaftspolitik<br />
alles daran, so viel wie möglich aus dem<br />
eingeführten Industriestandort herauszu pressen. Nicht<br />
von ungefähr war <strong>Bitterfeld</strong> auch einer der Schwerpunkte<br />
des Arbeiteraufstandes am 17. Juni 1953.<br />
1957 beschlossen Partei und Regierung der DDR das<br />
Kohle-Energieprogramm und 1958 das Chemieprogramm<br />
der DDR, das unter dem Motto „Chemie bringt<br />
Brot, Wohlstand und Schönheit“ stand. Das Ziel dieser<br />
Programme war, die Unabhängigkeit von Rohstoff-<br />
lieferungen und Importen aus dem nicht-sozialistischen<br />
Wirtschaftsgebiet zu erreichen. Beide Programme<br />
stärkten noch einmal die Bedeutung von <strong>Bitterfeld</strong> und<br />
<strong>Wolfen</strong>. Zugleich wurde der Industriestandort zu einem<br />
Symbolort der Aktivistenbewegung hochstilisiert, die<br />
Höchstleistungen in der Produktion erbringen sollte.<br />
Auf zwei kulturpolitischen Konferenzen im Kulturpalast<br />
<strong>Bitterfeld</strong> wurden 1959 und 1964 Leitlinien für die<br />
sozialistische Kulturpolitik verkündet, die als „<strong>Bitterfeld</strong>er<br />
Weg“ in die Geschichte eingingen.<br />
Hatte das Chemieprogramm am Anfang der 1960er Jahre<br />
noch einige Investitionen für neue Produktions anlagen<br />
ermöglicht, wurden schon kurze Zeit später technologische<br />
Erneuerungen und Maßnahmen zum Schutz der<br />
Umwelt immer wieder zurückgestellt.<br />
Teil 2<br />
made it clear to the Soviet Union in August 1945<br />
that it had to satisfy its reparation payments only from<br />
the zone occupied by it. As such, in <strong>Bitterfeld</strong>, <strong>Wolfen</strong><br />
and Greppin 50 percent of the industrial plants were<br />
dismantled as reparations and brought to the Soviet<br />
Union. The occupying power transformed all key<br />
industries which had not been dismantled into Soviet<br />
enterprises divided by shares. The electrochemical<br />
plants and all film and paint plants also fell under this<br />
measure which lasted until 1953.<br />
The occupying power’s intervention had a particularly<br />
negative effect on the <strong>Wolfen</strong> film factory, the innovation<br />
incubator of the 1930s. Already before its disassembly,<br />
the US-Americans had taken all important documents<br />
and patents which led to a long-lasting legal dispute<br />
regarding the agfa brand name. The dispute could<br />
not be settled until 1964 when the new brand name<br />
“ORWO – Original <strong>Wolfen</strong>” was introduced. Many<br />
highly qualified employees had left the <strong>Wolfen</strong> film<br />
factory by 1961 towards the West, and the growing<br />
division of the East German economy from the West<br />
also showed its effects.<br />
However, lignite mining, electricity generation and<br />
production volumes in the chemical industry were soon<br />
back at a top level. There was hardly any respect for the<br />
environment, nature and human health, however.<br />
Like the Soviet occupying powers before it, the GDR<br />
economic policies also did everything to squeeze out<br />
as much from this well-established industrial location<br />
as possible. It was not without reason that <strong>Bitterfeld</strong><br />
was one of the main focuses of the workers’ uprising on<br />
17 June 1953.<br />
In the year 1957, the Party and the GDR government<br />
adopted the Lignite Energy Programme of 1958 and<br />
the Chemical Programme of the GDR titled “Chemistry<br />
brings bread, welfare and beauty”. The programmes<br />
aimed to achieve independence from raw materials<br />
supplies and imports coming from the non-Socialist<br />
economic area. Both programmes again strengthened<br />
the importance of <strong>Bitterfeld</strong> and <strong>Wolfen</strong>.<br />
At the same time, the industrial location was hyped<br />
as a symbolic place where activists rendered top<br />
production performances. At two cultural political<br />
conferences in the <strong>Bitterfeld</strong> cultural palace in 1959<br />
and 1964, guidelines for Socialist cultural politics were<br />
announced which became historically known as the<br />
“<strong>Bitterfeld</strong> way”.<br />
Whilst the Chemical Programme from the beginning of<br />
1961 had still foreseen some new production plants,<br />
shortly afterwards all technological innovations and<br />
measures which could have protected the environment<br />
were postponed.<br />
20