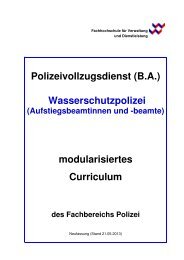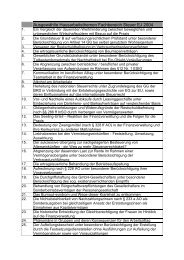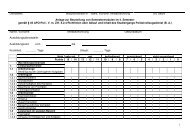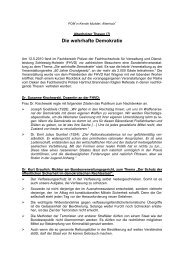PDF-Download 2,7 MB - FHVD - Fachhochschule für Verwaltung ...
PDF-Download 2,7 MB - FHVD - Fachhochschule für Verwaltung ...
PDF-Download 2,7 MB - FHVD - Fachhochschule für Verwaltung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
lange nicht verwirklicht. Am 1. Juli 1996<br />
trat in der Schweiz das Bundesgesetz über<br />
die Gleichstellung von Frau und Mann in<br />
Kraft. Dieses stellt <strong>für</strong> ArbeitgeberInnen<br />
und ArbeitnehmerInnen eine neue<br />
Herausforderung dar. Denn mit diesem<br />
Gesetz werden den Arbeitnehmerinnen<br />
bessere Mittel in die Hand gegeben, ihren<br />
Anspruch auf gleichen Lohn <strong>für</strong> gleichwertige<br />
Arbeit durchzusetzen.<br />
Im Erwerbsleben verdienen Frauen <strong>für</strong><br />
vergleichbare Arbeit wesentlich weniger<br />
als ihre männlichen Kollegen (vgl. Reis<br />
1988, Ulich et al.1988, Zingg Schrupkowski<br />
1994). Typische Frauenarbeitsplätze<br />
werden geringer bewertet und<br />
Qualifikationen, die <strong>für</strong> viele Frauentätigkeiten<br />
erforderlich sind –, z.B. Einfühlungsvermögen<br />
und Organisationsfähigkeit<br />
–, werden in der Arbeitswelt und<br />
Berufspraxis zu wenig wahrgenommen<br />
und lohnmässig nicht erfasst (vgl. Baitsch<br />
et al. 1988, Semmer 1991).<br />
Trotz der Bedeutung der Lohndiskriminierungen<br />
bei gleichwertiger Arbeit fehlten<br />
lange wissenschaftliche begründete<br />
Kriterien <strong>für</strong> die Beurteilung der Gleichwertigkeit<br />
von Arbeitstätigkeiten.<br />
Arbeitsbewertungsverfahren waren <strong>für</strong><br />
Gerichte, aber auch <strong>für</strong> viele Arbeitgeber-<br />
Innen und ArbeitnehmerInnen oft das<br />
einzige Instrument, zwei Tätigkeiten<br />
miteinander zu vergleichen.<br />
Sowohl eine Untersuchung im Auftrag der<br />
Arbeitsgruppe »Lohngleichheit von Frau<br />
und Mann« des Eidgenössischen Justizund<br />
Polizeidepartements als auch ein<br />
Gutachten des Eidgenössischen Büros <strong>für</strong><br />
die Gleichstellung von Frau und Mann<br />
haben gezeigt, dass die damals bekannten<br />
Arbeitsbewertungsverfahren (z.B. Hay-<br />
Verfahren, Funktionsbewertung des<br />
Betriebswirtschaftlichen Institutes der ETH<br />
Zürich) wichtige Merkmale von typischen<br />
Frauentätigkeiten stark vernachlässigen,<br />
Anforderungen an Tätigkeiten, die vorwiegend<br />
von Männern ausgeführt werden,<br />
jedoch überbewerten. Die erwähnten<br />
Studien wiesen aber auch darauf hin, dass<br />
diese Mängel der Instrumente bei ihrer<br />
Anwendung noch verstärkt, einerseits weil<br />
manche Arbeitsbewertungsverfahren sehr<br />
komplex sind, anderseits weil die AnwenderInnen<br />
die speziellen Diskriminierungsquellen<br />
der Arbeitsbewertung nicht<br />
kennen.<br />
Arbeitsbewertung in der Praxis<br />
Es gibt in der Praxis viele Verfahren und<br />
Systeme der Arbeitsbewertung. Mit<br />
diesen werden die verschiedenen<br />
Arbeitstätigkeiten in einem Betrieb unabhängig<br />
von den Personen bewertet und<br />
miteinander verglichen.<br />
Arbeitsbewertungsverfahren sind in der<br />
Schweiz vor allem in öffentlichen <strong>Verwaltung</strong>en<br />
und in mittleren und größeren<br />
Unternehmen bedeutsam, da die<br />
Durchführung mit erheblichem Aufwand<br />
verbunden ist. In kleinen Betrieben werden<br />
die Löhne oft anhand von wenigen<br />
Kriterien und/oder Vergleich zwischen verschiedenen<br />
Arbeitsplätzen festgelegt. Die<br />
Aufgabe dieser Bewertungssysteme liegt<br />
u.a. darin, den Schwierigkeitsgrad einer<br />
Arbeit anhand von im voraus zu bestimmenden<br />
Merkmalen (wie Anforderungen<br />
und Belastungen) zu ermitteln und diesem<br />
einen Zahlenwert zuzuordnen (vgl. Ridder<br />
1982) .<br />
Die Durchführung der verschiedenen<br />
Arbeitsbewertungsverfahren erfolgt in der<br />
Regel in den folgenden Schritten (vgl.<br />
Kappel 1993, Semmer et al. S. 23 ff., S.<br />
29ff., Katz & Baitsch 1996, S. 16):<br />
g Bestimmung der Kriterien, bzw.<br />
Merkmale, anhand der die Tätigkeiten<br />
bewertet werden sollen;<br />
g Gewichtung der Kriterien, bzw.<br />
Merkmale;<br />
g Beschreibung der Arbeitsaufgaben der<br />
zu bewertenden Tätigkeit;<br />
g Bewertung der Arbeitsaufgaben aufgrund<br />
des im voraus festgelegten<br />
Kriterien-, bzw. Merkmalskatalogs;<br />
g Berechnung des Gesamtarbeitswertes<br />
durch Zusammenzählen der gewichteten<br />
Merkmalspunkte.<br />
Aufgrund von Verfahren der Arbeitsbewertung<br />
werden die Grundlöhne festgelegt,<br />
d.h. es werden nur die tätigkeitsbezogenen<br />
Kriterien berücksichtigt.<br />
Personenbezogene Kriterien wie beispielsweise<br />
die Leistung, das Alter und die<br />
Betriebzugehörigkeit einer Person werden<br />
bei der Arbeitsbewertung nicht berücksichtigt<br />
und sind nicht Teil des Grundlohns.<br />
35