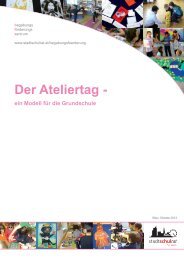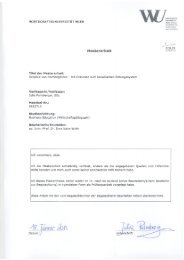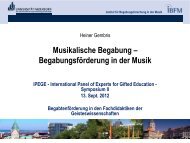news science - ÖZBF
news science - ÖZBF
news science - ÖZBF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Tagungsberichte 53<br />
zur Förderung hochbegabter und besonders<br />
begabter Schüler entwickelt. Damit war für<br />
die Bundesrepublik Deutschland erstmals in<br />
einer staatlichen Schule ein Modell entstanden,<br />
in dem Schüler/innen bereits mit zehn<br />
Jahren, von Beginn der Gymnasialausbildung<br />
an, nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten<br />
gefördert werden können. Die Entscheidung,<br />
diese Förderung in speziellen Klassen zu versuchen,<br />
erwuchs aus den Erfahrungen der ersten<br />
Jahre, die zeigten, dass eine integrative<br />
Förderung wegen der notwendigen Differenzierung<br />
einen wesentlich höheren personellen<br />
Aufwand und Einsatz erfordern würde<br />
(der nicht zur Verfügung stand). Heute führt<br />
das Deutschhaus-Gymnasium in jeder Jahrgangsstufe<br />
eine Modellklasse mit ca. zwanzig<br />
Schülerinnen und Schülern.<br />
Zum Verständnis der pädagogischen Konzeption<br />
(www.deutschhaus.de) muss angemerkt<br />
werden, dass die Aufnahme in diese Klassen<br />
nicht allein vom IQ-Wert oder einer zu<br />
erwartenden schulischen Hochleistung abhängt,<br />
sondern stärker von der Überlegung<br />
bestimmt ist, welche Kinder wegen ihrer besonderen<br />
Begabung, ihrer speziellen Interessen<br />
und ev. auch ihrer sozialen Eigenheiten<br />
einer solchen Modellklasse bedürfen. Allerdings<br />
muss auch zugestanden werden, dass<br />
die Zahl der sozialen oder lernpraktisch sehr<br />
auffälligen Kinder (die sog. Underachiever)<br />
relativ gering sein muss, wenn im Kontext<br />
einer staatlichen Schule dieses Projekt gelingen<br />
soll.<br />
In unserem Verständnis ist Hochbegabtenförderung<br />
nicht zuerst eine Frage von Enrichment<br />
und zusätzlicher schulischer Angebote,<br />
die es geben kann und muss. Mehr ist es<br />
eine Frage der inneren Gestaltung des täglichen<br />
Unterrichts und noch wesentlicher ist<br />
die Haltung, die die Lehrerin/der Lehrer dem<br />
begabten Kind gegenüber einnimmt, d.h. ob<br />
und wie sie/er Begabungen wahrnimmt, akzeptiert<br />
und zur Geltung bringen will.<br />
In unserem Verständnis ist Begabtenförderung<br />
vor allem eine spezifische Qualität im<br />
Beziehungsgeschehen zwischen den Lehrerinnen/Lehrern<br />
und den Schülerinnen/<br />
Schülern. D.h. die individuelle Begleitung<br />
und dadurch Förderung und eine schulische<br />
Struktur, die individuelles Lernen aus den<br />
Schemen unserer normierenden Strukturen<br />
herauslöst, ist das Qualitätsziel dieser besonderen<br />
Klassen. Dahin ist noch ein weiter<br />
Weg. Herkömmliche schulische Organisations-<br />
und Verhaltensmuster sind mächtige,<br />
widerständige Kräfte auf dem Weg zu einer<br />
begabungsfördernden Schule.<br />
Eine zweite Idee bestimmt unseren Weg.<br />
Es ist die Idee der sozialen Rückbindung der<br />
Begabung. Begabung als unverdientes Geschenk<br />
verstanden verlangt die „Rückgabe“<br />
als Verantwortung für die anderen und für<br />
das Umfeld. In diesem Verständnis wird der<br />
Geruch des Elitären aufgehoben und umgewandelt<br />
in einen sozialen und gesellschaftlichen<br />
Wert der Talente des Einzelnen.<br />
Worin unterscheiden sich unsere Klassen von<br />
den regulären Klassen unseres Gymnasiums?<br />
Es ist nicht die pure Leistung, die sich vornehmlich<br />
in Noten ausdrückt, obgleich sie natürlich<br />
messbar vorhanden ist. Zuerst ist es<br />
ein höherer Leistungsanspruch an die Schüler/innen,<br />
die neben den üblichen zwei Fremdsprachen<br />
eine dritte erlernen, dazu das volle<br />
Pensum des naturwissenschaftlich-technologischen<br />
Gymnasiums mit Physik, Chemie und<br />
Informatik zu belegen haben und darüber hinaus<br />
mit Philosophie und dem Fach Europäisches<br />
Denken einen dritten, geisteswissenschaftlichen<br />
Schwerpunkt haben.<br />
Wesentlicher als dieses quantitative Merkmal<br />
ist die methodische Spezifizierung, die<br />
pauschalierend mit den Begriffen der Individualisierung<br />
des Lernens und der Differenzierung<br />
der Leistung umschrieben werden kann.<br />
Dieses Moment ist neben der personalen<br />
Begleitung und Orientierung der eigentliche<br />
Kern des Modellprojekts. Individualisierung<br />
auf dem Hintergrund des oben benannten<br />
Ideals der Wahrnehmung und Akzeptanz von<br />
unterschiedlichen Begabungen, die sich in<br />
konkreten Interessen äußern können, führt<br />
in der Konsequenz zu einer Auflösung der<br />
herkömmlichen, geschlossenen Strukturen<br />
des Unterrichts. Schule wird dann in Teilen<br />
zu einem offenen Lernraum, in dem sich die<br />
Lehrer/innenrolle hin zur/zum Begleiter/in<br />
und Unterstützer/in der Lernprozesse verändern<br />
muss. In diesen Kontext ist eine gewisse<br />
Wahlfreiheit in der Fächerzusammenstellung<br />
(Additum genannt) einzureihen. Das<br />
Ziel dieser Vorstellung ist auch in unserem<br />
Gymnasium noch lange nicht erreicht. Was<br />
erreicht ist, sind erste Schritte.<br />
Mit dieser Vision verbindet sich das dritte<br />
Merkmal der Begabtenförderung: eine intensivere<br />
Begleitung und Orientierung. Sie realisiert<br />
sich in der Teamführung der Klassen,<br />
dem Coaching oder Mentoring (in unserer<br />
Schule Kontaktlehrer/innen oder Mentorinnen/Mentoren<br />
genannt) und im Fach Personale<br />
Kompetenz, das grundlegende Fragen<br />
des Lernens, des sozialen Umgangs, der Organisation<br />
u.a. beinhaltet.<br />
Der geraffte und unvollständige Überblick<br />
verdeutlicht jedoch eines:<br />
Begabtenförderung ist zuerst Förderung der<br />
einzelnen, begabten Schülerin/des begabten<br />
Schülers. Es gibt weder den Hochbegabten<br />
an sich noch die Begabtenförderung für sich.<br />
Noch weniger gibt es die Gewissheit, dass<br />
alle personalen und strukturellen Öffnungen<br />
qua se erfolgreich sein müssen. In der Hochbegabtenförderung<br />
kommt es mehr auf die<br />
Begabte/den Begabten selbst an. Die Schule<br />
ist gefordert, ihr/ihm und ihnen einen Entfaltungsraum<br />
anzubieten. Diese Definition von<br />
Schule klingt sehr bescheiden. Sie verschiebt<br />
aber schon im Anfangsstadium der Realisierung<br />
unsere herkömmlichen Vorstellungen<br />
von Unterricht und Schule, die sich immer<br />
mit Klassen und gleichen Normen und vor<br />
allem mit der Rolle der Lehrerin/des Lehrers<br />
als Instruktor/in und als Wissensvermittler/<br />
in, kurzum als „Professorin/Professor“ verbindet.<br />
Zu lernen, dass Lernen von unterschiedlichen<br />
Geschwindigkeiten, verschiedenen<br />
Wegen und andersartigen Interessen<br />
bestimmt wird, ist die schwierigste Aufgabe<br />
dieses Modellprojekts.“ (Zitat Ende)<br />
Nach dem dichten Input-Teil des Vormittags<br />
war das Nachmittagsprogramm dem eigent-