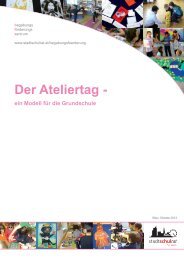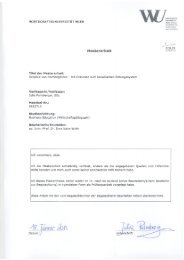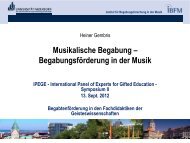news science - ÖZBF
news science - ÖZBF
news science - ÖZBF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Rezensionen<br />
61<br />
REZENSION<br />
Hochbegabte Kinder und Jugendliche. Diagnostik – Förderung – Beratung.<br />
Rohrmann, S. & Rohrmann, T. (2005).<br />
Hochbegabte Kinder und Jugendliche.<br />
Diagnostik – Förderung – Beratung. München:<br />
Ernst Reinhardt. [242 S. mit 13 Abbildungen<br />
u. 3 Tabellen; ISBN 3-497-<br />
01786-8]<br />
Gleich zu Anfang sei festgehalten, dass man<br />
dem Buch anmerkt, dass es nicht von „Newcomern“<br />
im Felde geschrieben wurde. Sabine<br />
Rohrmann, geb. Platzer, hat eine eigene Praxis<br />
für Bildungsberatung und Begabtenförderung,<br />
ist approbierte Kinder- und Jugendpsychotherapeutin<br />
und hat vorher längere<br />
Zeit an der Jugenddorf-Christophorusschule<br />
Braunschweig als Beraterin und Schulpsychologin<br />
gearbeitet. Ihr Ehemann, Tim Rohrmann,<br />
ist ebenfalls Diplom-Psychologe und arbeitet<br />
selbständig in Fortbildung und Beratung sowie<br />
in Forschungsprojekten zur Entwicklung<br />
und Pädagogik im Vor- und Grundschulalter.<br />
Die Autoren versuchen gleich von Beginn an,<br />
die Diskussion um Hochbegabung zu entdramatisieren.<br />
Dazu gehört ihr entwicklungspsychologisches<br />
und pädagogisches Credo, dass<br />
Kinder kompetent sind, „von Geburt an aktiv<br />
lernende Wesen, die sich mit ihrer Umwelt<br />
auseinandersetzen.“ (S. 11) Verschiedenheit<br />
(„diversity“) wird als Chance gesehen, die<br />
für alle gilt. Das beinhaltet für die Autoren<br />
zugleich, nicht besondere Programme für besondere<br />
Kinder zu propagieren, sondern „Kindern<br />
in all ihrer Unterschiedlichkeit gerecht<br />
zu werden und einen Rahmen zu schaffen,<br />
in dem sie ihre Potenziale verwirklichen können.“<br />
(S. 16)<br />
Um die „Vielfalt der Persönlichkeiten und<br />
Verhaltensweisen von Begabten“ (S. 22) zu<br />
zeigen, stellen sie eine kleine „Typenlehre“<br />
mit neun, in drei Gruppen eingeteilten Typen<br />
auf: Die Erfolgreichen, die Schwierigen und<br />
die Unauffälligen; allerdings scheint mir die<br />
Reduzierung auf Typen zur Demonstration<br />
von Mannigfaltigkeit ein gewisser Widerspruch<br />
in sich selbst zu sein.<br />
In dem eher theoretisch orientierten Kapitel<br />
über Modelle und Definitionen wollen die Autoren<br />
„etwas Licht in diesen Begriffsdschun-<br />
gel bringen“ und u. a. klären, was „genau unter<br />
Intelligenz und Begabung verstanden“ (S.<br />
31) werde. Das gelingt ihnen nur zum Teil. Sie<br />
bieten für ein Buch dieser Art eine erfreulich<br />
zurückhaltende Auswahl von Definitionen<br />
und Modellen an, ohne dass aber der eigene<br />
Standpunkt wirklich erkennbar wird. Eine<br />
gewisse Sympathie erfährt der an Sternberg<br />
angelehnte Ansatz von „Hochbegabung als<br />
‚developing expertise’“ (S. 50f), weil er in<br />
gelungener Weise psychometrische und kognitionspsychologische<br />
Ansätze miteinander<br />
verbindet. Bis zum Schluss aber erfährt die<br />
Leserin/der Leser beispielsweise nicht, ob<br />
die Autoren Intelligenz und Begabung als synonym<br />
betrachten oder nicht.<br />
Im Kapitel über Diagnostik wird u. a. auf die<br />
Schwierigkeiten hingewiesen, zuverlässige<br />
und prognostisch valide, intelligenzdiagnostische<br />
Ergebnisse im frühen Kindesalter zu<br />
erheben. Die Autoren ziehen daraus die Konsequenzen,<br />
zum einen im Kindergarten- und<br />
Grundschulalter grundsätzlich nur von „Entwicklungsvorsprüngen“<br />
und nicht von Hochbegabung<br />
zu sprechen, und zum Zweiten,<br />
testpsychologische Untersuchungen eher<br />
später als früher durchzuführen. Zu Recht<br />
weisen sie auf die in der Praxis häufig vernachlässigte<br />
Bedeutung des Messfehlers<br />
hin sowie auf die Problematik der Verwendung<br />
veralteter Normen. In kurzen und kritisch<br />
bewertenden Beschreibungen werden<br />
eine ganze Reihe ein- und mehrdimensionaler<br />
Intelligenztests vorgestellt.<br />
Gar nicht zustimmen kann ich der von den<br />
Autoren sehr bestimmt vertretenen Ablehnung<br />
zweier häufig verwendeter Verfahren,<br />
nämlich des „Adaptiven Intelligenz-Diagnostikums<br />
(AID)“ sowie der „Kaufman–Assessment<br />
Battery for Children (K-ABC)“. Beide<br />
Instrumente können m. E. dem erfahrenen<br />
Testleiter/der erfahrenen Testleiterin und<br />
Auswerter/in befriedigende, nützliche und<br />
interpretierbare Hinweise geben, mit der Einschränkung,<br />
dass ein Einsatz der K-ABC nur<br />
bis zu etwa 7/8 Jahren (und nicht bis zum eigentlich<br />
vorgesehenen Alter von 12;5) sinnvoll<br />
erscheint, da sonst bei begabteren Kindern<br />
verstärkt Deckeneffekte auftreten können.<br />
Bezüglich der das AID betreffenden Ablehnung<br />
ergibt sich die Vermutung, dass die<br />
Autoren nicht allzu sehr mit dem Test vertraut<br />
sind, da sie in der Besprechung schreiben:<br />
„Ähnlich wie in den Wechsler-Tests ergibt<br />
das Verfahren zwei allgemeine Werte,<br />
hier für verbal-akustische sowie für manuell-visuelle<br />
Fähigkeiten.” (S. 75) Das trifft allerdings<br />
für den überarbeiteten AID 2, der im<br />
Jahre 2000 herauskam und den alten AID von<br />
1991 ersetzt, schlichtweg nicht zu.<br />
Positiv ist hervorzuheben, dass sich die Auflistung<br />
von Diagnoseinstrumenten mit Kurzbesprechungen<br />
nicht nur auf Intelligenztests<br />
beschränkt, sondern auch eine ganze Reihe<br />
von Verfahren zur „Diagnostik von nichtkognitiven<br />
Persönlichkeitsfaktoren und sozialemotionaler<br />
Situation“ mit einbezieht, und<br />
dass 10 Leitlinien für Begabungsdiagnostik<br />
und Gutachtenerstellung vorgestellt werden,<br />
die für Eltern und Lehrer/innen im Umgang<br />
mit und bei der Bewertung von Gutachten<br />
(bzw. Gutachtenden) nützlich sein können.<br />
Mit einer ganzen Reihe von kurzen Fallbeispielsschilderungen<br />
werden die Ausführungen<br />
zu problematischen Entwicklungen bei Hochbegabten<br />
eindrucksvoll illustriert. Der schon<br />
zu Beginn angesprochene Ansatz wird auch<br />
hier wieder deutlich, wenn kritisiert wird, dass<br />
„bei einem Verständnis von Hochbegabung als<br />
Problem völlig aus dem Blick gerät, […] dass<br />
hohe Begabung in erster Linie eine Ressource<br />
darstellt.“ (S. 90) Im Besonderen angesprochen<br />
werden ausführlich Underachievement und Etikettierung,<br />
außerdem asynchrone Entwicklung,<br />
Probleme im Sozialverhalten, psychische<br />
Störungen und Sexualität.<br />
Immer wieder taucht im Buch die Genderproblematik<br />
auf, die ein spezielles Arbeitsgebiet<br />
von Tim Rohrmann zu sein scheint. Wobei<br />
nicht, wie sonst üblich, die „benachteiligten<br />
Mädchen“ im Vordergrund stehen, sondern<br />
es wird „ein differenzierender Blick auf die je<br />
spezifischen Chancen und Risiken beider Geschlechter“<br />
gefordert, der nicht die Benachteiligungen<br />
der Geschlechter gegeneinander<br />
aufrechnet. (S. 54) Diesen Perspektivenwechsel<br />
sehen die Autoren noch nicht in der<br />
Forschung und Praxis zu Hochbegabung und<br />
Begabtenförderung angekommen.