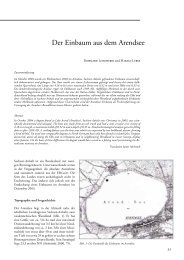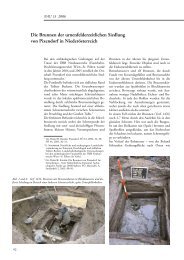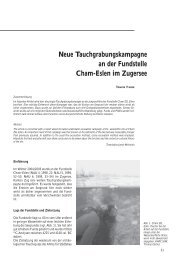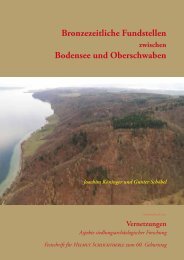Silexfunde aus der Schicht 9 von Sipplingen-Osthafen und aus der um
Silexfunde aus der Schicht 9 von Sipplingen-Osthafen und aus der um
Silexfunde aus der Schicht 9 von Sipplingen-Osthafen und aus der um
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abb. 6 Vergleich <strong>der</strong> flächenretuschierten Plattensilexgeräte <strong>von</strong> <strong>Sipplingen</strong> (1,5) mit Plattensilex-Sicheln <strong>von</strong><br />
Reute-Schorrenried (4) (KIESELBACH/SCHLICHTHERLE 1998, Taf. 17,383) <strong>und</strong> Altheim (2,3) (DRIEHAUS 1960,<br />
Taf. 36,2.3.7; 37,14)<br />
deutlich glatteren Plattensilex hergestellt ist, könnte es<br />
sich ebenfalls <strong>um</strong> eine mehrfach überarbeitete Altheimer<br />
Sichel handeln, wie sie z. B. auch in Reute-Schorrenried<br />
vorliegt. Da beide Stücke keine Glanzpatina aufweisen,<br />
bleibt die typologische Ansprache jedoch fraglich.<br />
Die vollständigen Messer haben eine mittlere Länge <strong>von</strong><br />
51,7 mm, eine mittlere Breite <strong>von</strong> 25,2 mm <strong>und</strong> eine mittlere<br />
Dicke <strong>von</strong> 6,9 mm. Das Gewicht liegt nur <strong>von</strong> zwei<br />
Messern (Taf. 28, 302,303) vor. Sie wiegen 12,6 g <strong>und</strong><br />
15,8 g. Die Messer des Oberflächeninventars sind somit<br />
bis auf die Dickenmasse deutlich größer als die Messer <strong>aus</strong><br />
<strong>Schicht</strong> 9 (siehe Tab. 17).<br />
Von den kanten- <strong>und</strong> endretuschierten sowie flächenretuschierten<br />
Geräten wurden drei, vermutlich ebenfalls als<br />
Messer verwendete Stücke separiert, die durch eine Spitze<br />
gekennzeichnet sind. Es handelt sich <strong>um</strong> eine einfache<br />
Spitzklinge (Taf. 28. 310), eine Spitzklinge mit verr<strong>und</strong>eter<br />
Kratzspitze (Taf. 28, 311), sowie <strong>um</strong> einen Abschlag,<br />
bei dem eine gerade <strong>und</strong> eine konvex retuschierte Lateralkante<br />
spitz <strong>aus</strong>laufen (Taf. 28, 309). Bei <strong>der</strong> Spitzklinge<br />
mit Kratzspitze (Taf. 28, 311) diente möglicherweise eine<br />
Kernkantenklinge als Ausgangsform. Die Spitzklingen<br />
sind <strong>aus</strong> Jurahornstein <strong>der</strong> Materialgruppe 3a <strong>und</strong> 4. Der<br />
Abschlag ist <strong>aus</strong> dunkelgrau bis schwarzbraun patiniertem<br />
o<strong>der</strong> gebranntem Silex. Im stratifizierten Geräteinventar<br />
liegt außer dem Dolch kein weiteres spitz retuschiertes<br />
Messer vor. Sie bilden aber gängige Geräteformen in jungneolithischen<br />
Inventaren Südwestdeutschlands. Allerdings<br />
weisen die Spitzklingen in aller Regel an<strong>der</strong>e Dimensionen<br />
auf als die beiden vorliegenden Stücke, die 67,3 mm <strong>und</strong><br />
88,3 mm lang sind. So haben die <strong>aus</strong> Inventaren <strong>der</strong> Aichbühler<br />
<strong>und</strong> Schussenrie<strong>der</strong> Kultur Südwestdeutschlands<br />
vorliegenden Spitzklingen <strong>aus</strong> Jurahornstein eine mittlere<br />
Länge <strong>von</strong> ca. 48 mm. Die für die Michelsberger Kultur<br />
typischen Spitzklingen <strong>aus</strong> Rijckholt-Kreidefeuerstein lassen<br />
sich zweiteilen: die dolchartigen Spitzklingen <strong>aus</strong><br />
Rijckholt-Kreidefeuerstein, die u. a. in Aichbühl, Allesh<strong>aus</strong>en-Hartöschle<br />
(siehe Abb. 5) o<strong>der</strong> Ehrenstein vorliegen,<br />
weisen Längen <strong>von</strong> über 100 mm auf. Daneben kommen<br />
kürzere Exemplare vor, z. B. im Michelsberger Erdwerk<br />
<strong>von</strong> Ilsfeld-Ebene, die zwischen 61 <strong>und</strong> 65 mm lang<br />
sind (KIESELBACH 2000). In Pfyner <strong>und</strong> Pfyn-Altheimer<br />
Stationen Südwestdeutschlands sind Spitzklingen selten<br />
o<strong>der</strong> nicht vorhanden. Die Spitzklinge <strong>aus</strong> südalpinem Silex<br />
im Inventar <strong>von</strong> Ödenahlen hat eine Länge <strong>von</strong> 59<br />
mm. Die Spitzklingen im Horgener Inventar <strong>von</strong> Nußdorf-Strandbad<br />
sind hingegen gleich groß bzw. größere als<br />
jene im Oberflächeninventar <strong>von</strong> <strong>Sipplingen</strong>. Sie haben<br />
eine mittlere Länge <strong>von</strong> 72,7 mm. Es ist somit nicht <strong>aus</strong>zuschließen,<br />
daß die beiden vorliegenden Spitzklingen <strong>aus</strong><br />
den nahegelegenen Horgener <strong>Schicht</strong>en stammen.<br />
Für zwei Geräte im Oberflächeninventar ist eine Funktion<br />
als Bohrer anzunehmen. Ein Exemplar (Katalogn<strong>um</strong>mer<br />
313) hat an seinem Distalende eine dornartig Bohrspitze,<br />
das an<strong>der</strong>e (Taf. 28, 312) weist an seinem Proximalende<br />
eine abgesetzte, lang <strong>aus</strong>gezogene <strong>und</strong> leicht gekrümmte<br />
Bohrspitze auf. Beide Bohrer sind in ihrer Länge gebrochen.<br />
Daher läßt sich bei beiden Bohrern die Ausgangsform<br />
nicht mehr sicher bestimmen. Ebenso können keine<br />
Angaben über die Größe <strong>der</strong> Stücke gemacht werden. Beide<br />
Bohrer sind dunkelgrau bis schwarz patiniert <strong>und</strong> bezüglich<br />
ihres Rohmaterials nicht mehr sicher zu bestimmen.<br />
Ein Exemplar (Taf. 28, 312) weist zudem thermische<br />
Einwirkung in Form <strong>von</strong> Hitze<strong>aus</strong>sprünge auf. In Pfyner<br />
<strong>und</strong> Pfyn-Altheimer Inventaren stellen Bohrer gängige<br />
Geräte dar. Daß im stratifizierten Material <strong>von</strong> <strong>Schicht</strong> 9<br />
nur ein möglicher Bohrer vorliegt, ist daher ungewöhnlich<br />
<strong>und</strong> möglicherweise auf den begrenzten Grabungs<strong>aus</strong>schnitt<br />
zurückzuführen.<br />
Es lassen sich ferner sechs Kratzer identifizieren. Sie haben<br />
mit 16,7 % einen etwas höheren Anteil als im stratifizierten<br />
Inventar, wo <strong>der</strong> Kratzeranteil bei 12,1 % liegt. Bei<br />
fünf Kratzern (Taf. 29, 314,315,317,318; Katalogn<strong>um</strong>mer<br />
319) diente ein Abschlag als Gr<strong>und</strong>form. Beim sechsten<br />
(Taf. 29, 316) handelt es sich hingegen <strong>um</strong> einen Kern, bei<br />
dem <strong>der</strong> Kernfuß eine steile Kratzerkappe aufweist. Die<br />
Kratzerstirn liegt bei allen Abschlagkratzern am Distalende.<br />
Bis auf einen Abschlagkratzer (Taf. 29, 317) weisen die<br />
Kratzer zusätzlich zur Kratzerkappe Kanten- o<strong>der</strong> Gebrauchsretuschen<br />
o<strong>der</strong> Aussplitterungen auf. Die meisten<br />
Kratzer sind patiniert <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> gebrannt. Lediglich zwei<br />
Kratzer sind <strong>aus</strong> Jurahornstein <strong>der</strong> Materialgruppe 3a. Die<br />
71