2 Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort ... - Region Stuttgart
2 Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort ... - Region Stuttgart
2 Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort ... - Region Stuttgart
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Ermittlung regionalen Qualifizierungsbedarfs<br />
• Im Zuge der europäischen Integration erlebte der Subsidiaritätsgedanke eine Renaissance,<br />
und auch der Strukturwandel der Weltwirtschaft führte zu zunehmender theoretischer wie<br />
praktischer Aufwertung der <strong>Region</strong> (Stichwort "Glokalisierung", Robertson 1998). 10 Im<br />
Kielwasser dieser Entwicklungen folgten zwei weitere Richtungsänderungen: Zum einen<br />
setzten sich <strong>Region</strong>alisierungsstrategien einzelner Politiken durch – so bei der Weiterbildung<br />
11 und ansatzweise in der Arbeitsmarktpolitik, deren bereits früher angeregte <strong>Region</strong>alisierung<br />
(vgl. Garlichs et al. 1983) in den 1990er Jahren in einigen Bundesländern auf eine<br />
institutionalisierte Basis gestellt wurde. Den Hintergrund bildete das Aufkommen des endogenen<br />
Entwicklungsgedankens, nachdem bereits in den 1980er Jahren Innovations- und<br />
Qualifikationsdefizite als Ursache regionaler Disparitäten ausgemacht worden waren (z.B.<br />
Derenbach 1984) und die Einsicht, dass in der <strong>Region</strong> mit knappen Mitteln ein größerer Wirkungsgrad<br />
zu erzielen sei (Gnahs 1995: 5). Zum anderen erschien der regionale Ansatz angesichts<br />
des gestiegenen ökonomischen und sozialen Problemdrucks der 1990er Jahre auch<br />
geeignet, verschiedene Politiken (Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Struktur-, Technologie-, Bildungspolitik)<br />
im Hinblick auf Synergieeffekte zu konzertieren. In diesem Sinn ist z.B. gemäß<br />
dem Konzept der "Lernenden <strong>Region</strong>" Qualifikationsentwicklung als Bestandteil regionaler<br />
Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung zu gestalten, indem regionale Netze zwischen<br />
Betrieben, Bildungsträgern, öffentlichen Behörden und Beratungsdiensten geknüpft werden<br />
(Tuschke 1994). 12 Netzwerkstrukturen spielen gerade in neueren regionalwissenschaftlichen<br />
Ansätzen (z.B. Grabher 1994) als Steuerungsform neben Markt und Hierarchie zunehmend<br />
eine Rolle, auch für die Verbesserung von Struktur und Funktionsweise regionaler Arbeitsmärkte.<br />
13<br />
10 Dabei gilt es mit dem Missverständnis aufzuräumen, dass <strong>Region</strong>alisierung eine "Gegenstrategie" zu<br />
Globalisierung bilden könnte. Im Gegenteil stellt die zunehmende regionalpolitische "Aufrüstung", das<br />
wettbewerbsorientierte Standortbewusstsein der <strong>Region</strong>en einen Antriebsmoment von Globalisierung<br />
dar.<br />
11 Brinkmann 1994, Gnahs 1995, Alt et al. 1995. Dabei wurden aber auch skeptische Stimmen laut:<br />
"Zum einen lässt sich berufliche Weiterbildung innerhalb einer <strong>Region</strong> wegen der institutionellen Vielfalt<br />
und der unterschiedlichen Eigeninteressen der verschiedenen Träger nicht einfach koordinieren. Zum<br />
anderen sind langfristige Bildungsziele (Erweiterung der individuellen Handlungskompetenz, größere<br />
Beweglichkeit auf dem Arbeitsmarkt insgesamt – auch auf dem überregionalen etc.) nicht ohne weiteres<br />
mit häufig nur kurzfristig absehbaren wirtschaftlichen Anforderungen kompatibel zu gestalten." (Bosch<br />
1993: 65).<br />
12 Ganz ähnlich funktioniert "<strong>Region</strong>ales Change-Management" (Neumann 1996), das den Erfolg regionaler<br />
Entwicklung an die Prinzipien Dezentralisierung, Entgrenzung der Politikbereiche, kooperative Arbeitsformen,<br />
Projektorientierung sowie das Erarbeiten eines regionalen Leitbildes koppelt.<br />
13 Für Netzwerke sind folgende Eigenschaften konstitutiv: der Modus des Verhandelns und kooperativen<br />
Aushandelns, Reziprozität und Vertrauen, Dauerhaftigkeit der Beziehungen, zunehmende Bedeutung der<br />
informellen Regelungen gegenüber vertraglichen Regelungen, eine Balance zwischen Prozess und Struktur<br />
bzw. eine gewisse Offenheit der Interaktionsbeziehungen, die Entwicklung interaktiver Lernprozesse<br />
und/oder gemeinsamer Handlungsmuster sowie die Bedeutung personeller Beziehungen (Schmid 2000).<br />
11




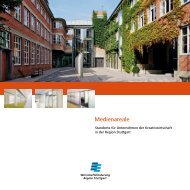

![Download [pdf | 1.3 MB] - Region Stuttgart](https://img.yumpu.com/3295671/1/184x260/download-pdf-13-mb-region-stuttgart.jpg?quality=85)