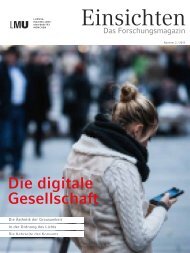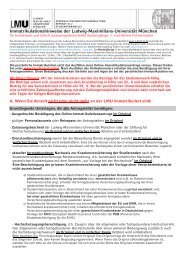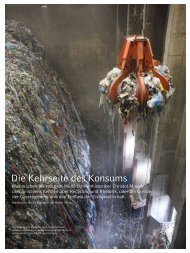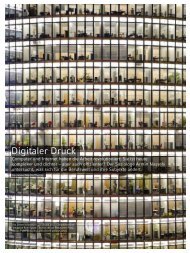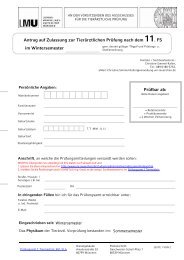2,8 mb - Ludwig-Maximilians-Universität München
2,8 mb - Ludwig-Maximilians-Universität München
2,8 mb - Ludwig-Maximilians-Universität München
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sterbehilfe oder Beihilfe zum Suizid aus dem Leben<br />
geschiedenen Patienten litt an einer Tumorerkrankung.<br />
In den allermeisten Fällen wurde die Sterbehilfehandlung<br />
durch den Hausarzt zuhause beim<br />
Patienten durchgeführt. In Krankenhäusern und<br />
Pflegeheimen hingegen kam Sterbehilfe nur sehr<br />
selten vor. In vier der insgesamt 1.886 Fälle wurde die<br />
Staatsanwaltschaft eingeschaltet.<br />
Vergleicht man diese Zahlen mit den Ergebnissen<br />
einer landesweiten Studie aus dem Jahre 2001, die<br />
etwa 3.500 Fälle von Lebensbeendigung auf Verlangen<br />
und weitere 300 Fälle von Beihilfe zum Suizid zu<br />
Tage brachte, so ist davon auszugehen, dass nur<br />
etwa die Hälfte der tatsächlichen Sterbehilfehandlungen<br />
gemeldet werden.<br />
Zwei aktuelle Entwicklungen verdienen ferner Beachtung:<br />
2004 wurde erstmals ein Fall von Lebensbeendigung<br />
auf Verlangen bei einem Alzheimerpatienten<br />
gemeldet. Obwohl der Patient noch längere Zeit<br />
hätte leben können, sah die zuständige Kontrollkommission<br />
die Sorgfaltskriterien als erfüllt an. Anfang<br />
dieses Jahres wurde bekannt, dass zwischen 1997<br />
und 2004 insgesamt 22 Neugeborene mit Spina<br />
bifida (offener Rücken über der Wirbelsäule, an dem<br />
Rückenmark zutage tritt) und/oder Hydrocephalus<br />
(Überdruck im Kopf als Folge einer gestörten Regulierung<br />
des Gehirnwasserflusses) auf Verlangen der<br />
Eltern getötet wurden. In allen Fällen wurden die Ermittlungen<br />
seitens der Staatsanwaltschaft eingestellt.<br />
Pressemitteilungen zufolge plant das niederländische<br />
Justizministerium ein Gesetz, das auch diese Form<br />
der Sterbehilfe unter bestimmten Voraussetzungen<br />
ermöglichen soll.<br />
Als zweites Land der Welt hat Belgien im Mai 2002<br />
ein Gesetz beschlossen, dass die Lebensbeendigung<br />
auf Verlangen ermöglicht. Das belgische Gesetz ist<br />
dem niederländischen in großen Teilen ähnlich: Wie<br />
in den Niederlanden ist ein freiwilliges, wohl überlegtes,<br />
andauerndes und unbeeinflusstes Verlangen<br />
des Patienten nötig. Das physische oder psychische<br />
Leiden des Patienten muss unerträglich, andauernd<br />
und unheilbar sein. Der Arzt muss sich vor Durchführung<br />
der Sterbehilfe mit einem zweiten, unabhängigen<br />
Arzt beraten und die durchgeführte Handlung<br />
einer Bundeskommission für die Kontrolle und<br />
Evaluation des Sterbehilfe-Gesetzes melden.<br />
Es gibt aber auch einige entscheidende Unterschiede:<br />
Zunächst ist der behandelnde Arzt verpflichtet,<br />
dem Patienten die Möglichkeiten der Palliativmedizin<br />
aufzuzeigen. Zudem ist er gehalten, Kontakt zu<br />
den Angehörigen und einem möglicherweise vorhandenen<br />
Pflegeteam aufzunehmen und mit diesen<br />
über den Patientenwunsch zu sprechen. Ferner verlangt<br />
das Gesetz, dass dieser schriftlich fixiert und zu<br />
den Krankenakten gelegt wird. Ist der Patient dazu<br />
nicht mehr in der Lage, so übernimmt dies eine volljährige<br />
Person seiner Wahl. Es besteht auch die Möglichkeit<br />
einer antizipierten Sterbehilfeerklärung. Der<br />
in der Öffentlichkeit am meisten wahrgenommene<br />
Unterschied besteht jedoch darin, dass der Patient<br />
nach belgischem Recht nicht in absehbarer Zeit sterben<br />
muss. Es genügt bereits, wenn er unheilbar krank<br />
ist, sein Tod aber zeitlich noch weit entfernt. In diesem<br />
Fall ist zwischen dem schriftlich dokumentierten<br />
Wunsch nach Sterbehilfe und der Durchführung derselben<br />
eine Wartefrist von einem Monat vorgeschrieben.<br />
Im Septe<strong>mb</strong>er 2004 hat die Bundeskommission erste<br />
Zahlen veröffentlicht: Demnach wurden von Septe<strong>mb</strong>er<br />
2002 bis Deze<strong>mb</strong>er 2003 259 Fälle von Tötung<br />
auf Verlangen gemeldet. In 91,5 Prozent dieser Fälle<br />
war der Patient als terminal, in 8,5 Prozent als nicht<br />
terminal eingestuft. 41 Prozent der Sterbehilfehandlungen<br />
wurden zu Hause beim Patienten, 54 Prozent<br />
in Krankenhäusern und fünf Prozent in Pflegeheimen<br />
durchgeführt. 80 Prozent der gemeldeten Fälle ereignete<br />
sich im flämischen Teil Belgiens, 20 Prozent<br />
im wallonischen. Dieses Ergebnis dürfte auf die kulturellen<br />
Unterschiede dieser beiden Landesteile<br />
zurückzuführen sein.<br />
Nach einer Studie gab es 1998 circa 640 Fälle von<br />
Tötung auf Verlangen in Flandern. Da bis Deze<strong>mb</strong>er<br />
2003 – also 15 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes<br />
– in ganz Belgien nur 259 Fälle gemeldet wurden,<br />
muss man davon ausgehen, dass die Mehrzahl der<br />
Sterbehilfefälle von den belgischen Ärzten nicht gemeldet<br />
wird.<br />
Die gesetzlichen Reglungen in den Niederlanden und<br />
Belgien verfolgen das Ziel, die Praxis der aktiven Sterbehilfe,<br />
die nachweislich auch in anderen Ländern<br />
existiert, transparenter zu gestalten, und die Lebensbeendigung<br />
auf Verlangen als letzten Ausweg für<br />
schwerstkranke Menschen zu ermöglichen, deren<br />
Leiden durch andere Maßnahmen nicht mehr zu lindern<br />
ist. Dieses Ziel ist – unabhängig davon, wie man<br />
persönlich dazu stehen mag – als Versuch, moralisch<br />
verantwortlich mit diesem Problem umzugehen, zu<br />
respektieren.<br />
Die Praxis in beiden Ländern zeigt jedoch, dass dieses<br />
Ziel nur zum Teil erreicht wurde. Ein grundlegendes<br />
Problem besteht in der geringen Meldebereitschaft<br />
der Ärzte. Selbst in den Niederlanden,<br />
wo die Praxis der aktiven Sterbehilfe seit gut 20 Jahren<br />
von den Gerichten geduldet wird, wird nur etwa<br />
jede zweite Sterbehilfehandlung gemeldet. Man darf<br />
annehmen, dass insbesondere jene Fälle, in denen<br />
die Sorgfaltskriterien nicht in vollem Umfang erfüllt<br />
sind, nicht gemeldet werden. Dies stellt die Funktion<br />
der Kontrollkommissionen und mit ihr die Effektivität<br />
der gesetzlichen Regelungen als solche erheblich in<br />
Frage. Ein weiteres Problem besteht in der schleichenden<br />
Ausweitung der „Indikation“ zur Sterbehilfe.<br />
Während Sterbehilfe ursprünglich als Ultima-Ratio-<br />
Lösung für Patienten gesehen wurde, deren Leiden<br />
auf keine andere Weise mehr gelindert werden kann,<br />
zeigt die Praxis, dass die aktive Sterbehilfe im Falle<br />
ihrer gesetzlichen Zulassung nicht auf diese enge<br />
Patientengruppe beschränkt bleibt. Die gesellschaftliche<br />
Akzeptanz dieser Lösung führt vielmehr dazu,<br />
dass sie auch von anderen (Patienten-)Gruppen, wie<br />
psychisch Kranken, oder Eltern für ihre behinderten<br />
Neugeborenen eingefordert wird.<br />
Ob diese Erfahrungen in Summe nun für oder gegen<br />
eine gesetzliche Zulassung der aktiven Sterbehilfe<br />
sprechen, kann und muss jeder für sich beurteilen.<br />
Ich persönlich respektiere den Weg, den die Niederländer<br />
und Belgier in dieser Frage eingeschlagen<br />
haben, lehne ihn aber für Deutschland ab.<br />
MUM 01 | 2006 ESSAY<br />
11