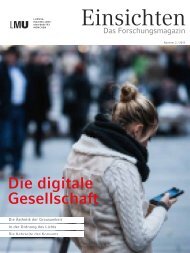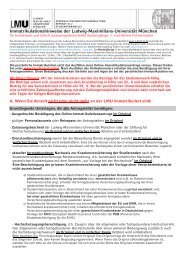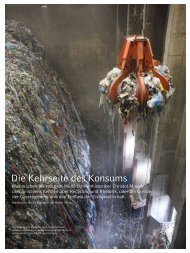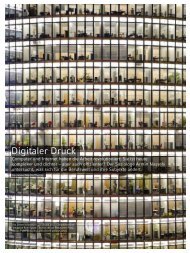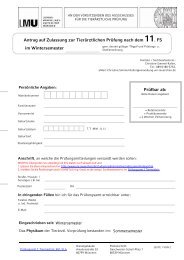2,8 mb - Ludwig-Maximilians-Universität München
2,8 mb - Ludwig-Maximilians-Universität München
2,8 mb - Ludwig-Maximilians-Universität München
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Grenzen der Disziplinen sind historisch gewachsen – die Natur<br />
unterscheidet nicht zwischen Physik, Chemie und Biologie,<br />
sie ist ein Ganzes. Die Einteilung in Disziplinen erscheint zwar hilfreich,<br />
ist aber auch willkürlich. Naturwissenschaftliche Probleme konnten und<br />
können erfolgreich innerhalb einer Disziplin gelöst werden. Aber Antworten<br />
auf komplexe Fragestellungen unserer Zeit erfordern zunehmend<br />
interdisziplinäres Vorgehen. Als Beispiele für den großen Erfolg<br />
ein solchen Zusammenarbeit in der Geschichte der Wissenschaft seien<br />
hier der Einsatz des Mikroskops als physikalische Erfindung in der<br />
Biologie oder die Röntgenbeugung genannt, wodurch immer kleinere<br />
Einheiten von der Zelle bis zur<br />
Struktur und Funktion einzelner<br />
P R O<br />
Biomoleküle aufgeklärt wurden.<br />
Gerade in heutiger Zeit bietet interdisziplinäres<br />
Vorgehen in den<br />
Naturwissenschaften große Chancen<br />
und Perspektiven. So berühren<br />
komplexe Probleme etwa im<br />
Bereich Energie, Umwelt oder Gesundheit<br />
Aspekte verschiedener<br />
Disziplinen und benötigen deren<br />
konzertierten Einsatz. Interdisziplinarität<br />
erweitert das Methodenspektrum,<br />
führt so zu qualitativ<br />
neuen Beobachtungen und erzeugt<br />
eine Vielzahl neuer Ideen<br />
und Konzepte. Sie macht Lehrende<br />
bzw. Forschende in hohem<br />
Maße zu Lernenden, indem sie sie<br />
mit der Sprache, den Methoden und den Modellen der anderen Disziplin<br />
bekannt macht. Interdisziplinäres Vorgehen ist wissens-, problemoder<br />
durch wirtschaftliches Interesse getrieben. Die Industrie ist in hohem<br />
Maße von interdisziplinärer Forschung, nicht nur innerhalb der<br />
Naturwissenschaften, sondern auch zwischen Natur- und Ingenieurwissenschaften<br />
abhängig, um innovative Produkte und damit Arbeitsplätze<br />
zu schaffen.<br />
Interdisziplinarität spiegelt sich auch in der Berufungspolitik der Hochschulen<br />
wider: Wurden ursprünglich nur Professoren in Physik, Chemie<br />
sowie Biologie berufen, so wurden im letzten Jahrhundert bis heute<br />
neue Lehrstühle für Physikalische Chemie und Biochemie, Biophysik<br />
oder sogar Biophysikalische Chemie gegründet. Auch neu gegründete<br />
Forschungszentren, wie das Center for NanoScience (CeNS) der<br />
LMU, sind ausgewiesene interdisziplinäre Forschungsplattformen, in<br />
denen um ein großes Thema gruppiert in hohem Maße und sehr erfolgreich<br />
interdisziplinäre Forschung vorangetrieben wird.<br />
Interdisziplinarität zeitigt aber auch Probleme. Sie liegen in den Sprachbarrieren<br />
zwischen den Disziplinen, den Berührungsängsten beim Verlassen<br />
des Kompetenzbereichs innerhalb der eigenen Disziplin und dem<br />
hohen Zeitaufwand, um Wissen in der anderen Disziplin zu gewinnen,<br />
was mittelfristig auch zu einem Wissensverlust in der eigenen Disziplin<br />
führen kann. Voraussetzung für erfolgreiche interdisziplinäre Arbeit<br />
sind Kommunikation, Kooperation und Koordination. Nur wenn die<br />
Sprache und das persönliche Miteinander stimmen, wenn die Fähigkeiten<br />
aus den einzelnen Disziplinen richtig gewählt sind, sich ergänzen<br />
und durchdringen und die Untersuchungen gut koordiniert<br />
werden, stellt sich der Erfolg ein. Eine Grundvoraussetzung ist jedoch<br />
eine hohe Professionalität in der jeweils eigenen Disziplin, denn nur so<br />
kann der anderen etwas geboten werden.<br />
+ CONTRA<br />
MUSS ERFOLGREICHE<br />
FORSCHUNG INTER-<br />
DISZIPLINÄR SEIN ?<br />
Inwieweit Forschung interdisziplinär ausgerichtet ist bzw. sein<br />
muss, hängt im Wesentlichen vom jeweiligen Fach ab. Ist für<br />
eine innovative naturwissenschaftliche Forschung die Interdisziplinarität<br />
nahezu unabdingbar, so gilt dies für eine erfolgreiche<br />
geisteswissenschaftliche Forschung nicht zwingend.<br />
Disziplinen sind Zufallsprodukte der Wissenschaftsgeschichte,<br />
entstanden in Prozessen der Förderung wissenschaftlicher<br />
Erkenntnis durch funktionale Spezialisierung und<br />
immer feinere Differenzierung der Methoden, Fragestellungen<br />
und Sehepunkte. Mit faszinierender begrifflicher Prägnanz hat<br />
Max Weber betont, daß der erhoffte „Fortschritt der Wissenschaft“<br />
unumgänglich an Spezialisierung gebunden bleibt, an<br />
die mit neuen, genaueren Begriffen und Deutungstechniken verbundene<br />
Verselbständigung überkommener Teilfächer zu methodisch<br />
autonomen Disziplinen. Doch je genauer Einzelnes erkannt<br />
wurde, desto lauter ertönte<br />
die Klage, daß die Spezialisten<br />
in ihren Partikularperspektiven<br />
„das Ganze“ aus<br />
dem Blick verloren hätten.<br />
Seit der ersten romantischen<br />
Denkrevolution um 1800 bildet<br />
diese Kritik an borniertem<br />
akademischen Fachmenschentum<br />
und disziplinenspezifischer<br />
Blickverengung die Begleitmusik<br />
eines Forschungsbetriebs,<br />
in dem inzwischen<br />
selbst die große Mehrheit der<br />
Philosophen und Theologen<br />
keinerlei Ganzheitsattitüden<br />
mehr pflegen. Schwundstufen<br />
idealistischer Syste<strong>mb</strong>astelei<br />
lassen sich zwar gegenwärtig noch beobachten, etwa in den Allvernetzungsphantasien<br />
mancher externer Synergiegewinnexperten,<br />
die <strong>München</strong>s „Wissenschaftslandschaft“ neu ordnen<br />
wollen.<br />
Der Glaube, daß interdisziplinäre „Forschungsverbünde“ oder<br />
transdisziplinäre „Cluster“ der entscheidende Ort zur Erzeugung<br />
innovativer, besserer Erkenntnis seien, mag Natur-, Technikoder<br />
Lebenswissenschaftler in den weißblauen Himmel der<br />
schnellen Verwertbarkeit führen. Doch in den Geisteswissenschaften<br />
folgen Innovationsoffensiven einer signifikant anderen<br />
Logik. Inka Mülder-Bach hat darauf hingewiesen, daß alle bedeutenderen<br />
Bücher der Geisteswissenschaften der letzten 50<br />
Jahre in „Einsamkeit und Freiheit“ geschrieben wurden, relativ<br />
fern von den institutionellen Zwängen einer „Wissenschaft als<br />
Großbetrieb“ (Adolf von Harnack).<br />
Gewiß blicken auch Geisteswissenschaftler über den Tellerrand<br />
des eigenen Faches, und eine disziplinäre Spezialperspektiven<br />
entgrenzende Bildung schadet ihnen ebensowenig wie das Gespräch<br />
über Fächergrenzen hinweg. Aber Erkenntnisfortschritt<br />
verdankt sich in den Geisteswissenschaften weithin der Kreativität<br />
des Einzelnen. Gute Geisteswissenschaften gleichen den<br />
Künsten darin, daß Sensibilität und Weltoffenheit des denkenden<br />
Individuums, seine Reflexionskraft und Bildung, die entscheidenden<br />
Produktivkräfte sind.<br />
MUM 01 | 2006 FORUM<br />
27<br />
7 Professor Dr. Christoph Bräuchle,<br />
Lehrstuhlinhaber für Physikalische Chemie<br />
an der LMU und Vorstand des Centers for<br />
NanoSience (CeNS)<br />
7 Professor Dr. Friedrich Wilhelm Graf,<br />
Lehrstuhl für Systematische Theologie und Ethik<br />
an der LMU