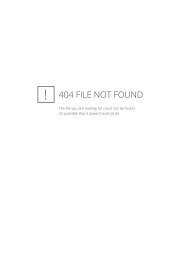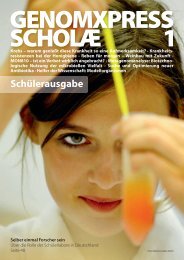Download GENOMXPRESS 4/2002
Download GENOMXPRESS 4/2002
Download GENOMXPRESS 4/2002
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
47 Science Digest<br />
mord verletzter Zellen – sie können repariert werden.<br />
Mit gentherapeutischen Methoden konnten die<br />
Forscher auch in jungen Zellen das Gen aktivieren<br />
– die Zellen überlebten Verletzungen. Wenn<br />
Hsp27 auch bei Patienten mit amyotropher Lateralsklerose<br />
und ähnlichen Erkrankungen die Zellen<br />
am Selbstmord hindern kann, könnten die<br />
Mediziner den Zerfall der Zellen mithilfe des Gens<br />
stoppen. Das würde neue Behandlungsmöglichkeiten<br />
eröffnen, hoffen die Forscher.<br />
Quelle: BdW (Online) 26.09.<strong>2002</strong><br />
Retardation nach<br />
Genveränderung auf<br />
Chromosom 4<br />
Unter den genetischen Ursachen für geistige<br />
Behinderungen ist erstmals ein Gen auf<br />
einem anderem Chromosom als dem X-Geschlechts-Chromosom<br />
entdeckt worden. Im Pariser<br />
Necker-Hospital wurde festgestellt, dass die<br />
Veränderung eines Gens auf dem 4. Chromosom<br />
eine geistige Behinderung verursachen kann. Die<br />
Ergebnisse der Studie, die unter der Leitung von<br />
Laurence Colleaux erstellt wurde, erschienen in<br />
der Wissenschaftszeitschrift «Science».<br />
Die Entdeckung dürfte nach Einschätzung der<br />
Wissenschaftler in vielen Fällen eine gezieltere<br />
Diagnose des geistigen Zurückbleibens ermöglichen.<br />
Darüber hinaus könne sie für genetische<br />
Beratungen genutzt werden. Die zuvor bekannten<br />
elf Gene mit möglichen Beeinträchtigungen für<br />
die geistige Entwicklung wurden alle auf dem X-<br />
Chromosom gefunden.<br />
Die Wirkweise, durch die genetische Mutationen<br />
geistige Behinderungen hervorrufen, ist kompliziert.<br />
In vielen Fällen wird die Bildung von Enzymen<br />
und damit die Funktionsweise von Nervenschaltstellen<br />
(Synapsen) behindert. Von den zahlreichen<br />
Möglichkeiten geistiger Retardierung sind<br />
rund drei Prozent der Bevölkerung betroffen.<br />
Allerdings kann bis heute in 40 Prozent der Fälle<br />
keine klare Diagnose gestellt werden.<br />
Für die Studie am Necker-Hospital wurden Patienten<br />
ausgewählt, die aus Verbindungen zwischen<br />
nahen Verwandten hervorgegangen waren.<br />
Das nicht funktionsfähige Gen auf dem 4. Chromosom<br />
ist für die Bildung des Enzyms Neurotrypsin<br />
verantwortlich, das höchstwahrscheinlich bei<br />
Verbindungen an Nervenschaltstellen eine Rolle<br />
spielt. Durch die geistige Retardierung werden<br />
unter anderem das Lernen und die Gedächtnisleistungen<br />
beeinträchtigt. Insgesamt gibt es nach<br />
heutigem Wissensstand rund 300 Gene, die ein<br />
geistiges Zurückbleiben verursachen können.<br />
Quelle: AFP 28.11. 02<br />
Typ 2 Diabetes –<br />
wichtiger genetischer<br />
Risikofaktor gefunden<br />
Etwa 15 Prozent aller Diabetes Typ 2-Fälle<br />
werden durch eine einzige genetische Abweichung<br />
verursacht. Das haben Pharmakologen der Technischen<br />
Universität Braunschweig jetzt nachgewiesen.<br />
Die Forschungsergebnisse können Wege zu<br />
neuen Therapieansätzen aufzeigen.<br />
Der Typ 2 Diabetes, unter dem mehr als 90 Prozent<br />
aller Betroffenen leiden, zeichnet sich im<br />
Gegensatz zum Typ 1 Diabetes dadurch aus, dass<br />
Insulin zwar freigesetzt wird, die Menge jedoch<br />
nicht ausreicht. Neben Übergewicht hatten Wissenschaftler<br />
auch erbliche Veranlagung im Verdacht,<br />
die Stoffwechselstörung zu begünstigen.<br />
Etwa zehn bis zwanzig Polymorphismen wurden<br />
bisher als mögliche Auslöser gehandelt - einer der<br />
wichtigsten wurde jetzt von Dr. Christina und Prof.<br />
Mathias Schwanstecher, Institut für Pharmakologie<br />
und Toxikologie der TU Braunschweig, aufgedeckt.<br />
(Diabetes Vol 51, Supplement 3, December<br />
<strong>2002</strong>, Diabetes Vol 51, March <strong>2002</strong>)<br />
Die Wissenschaftler haben den Einfluss von Polymorphismen<br />
in einem Zellbestandteil untersucht,<br />
der eine Schlüsselrolle bei der Ausschüttung von<br />
Insulin und Glucagon besitzt, dem so genannten<br />
ATP-sensitiven Kaliumkanal. Liegt dort in Position<br />
23 der Aminosäurekette Lysin anstelle von Glutamat<br />
vor, so trägt dies mittelbar zu einem Anstieg<br />
des Blutzuckers bei: Das Risiko für Diabetes steigt.<br />
Das Forscherehepaar Schwanstecher sieht in der<br />
Identifizierung des Polymorphismus eine wichtige<br />
Basis für neue Behandlungsansätze, wie Gentests<br />
zur Erstellung eines persönlichen Risikoprofils.<br />
Wer bei starker genetischer Belastung Übergewicht<br />
vermeidet, könnte dadurch den Ausbruch<br />
der Krankheit dennoch verhindern. Neue Arzneimittel<br />
könnten durch direkte Wirkung auf den<br />
ATP-sensitiven Kaliumkanal der Erhöhung des<br />
Blutzuckers entgegensteuern.<br />
Weltweite Studien haben bereits ergeben, dass<br />
konstant etwa 60 Prozent aller Europäer,<br />
Nordamerikaner und Japaner genau diesen Polymorphismus<br />
in ihrem Erbgut tragen. Die nahezu<br />
identische Häufigkeit dieser Abweichung in den<br />
verschiedenen Bevölkerungen ist für die Wissenschaftler<br />
ein Indiz dafür, dass der Polymorphismus<br />
den Trägern auch genetische Vorteile verleiht.<br />
Christina und Mathias Schwanstecher vermuten,<br />
dass der Polymorphismus die Nährstoffversorgung<br />
des Gehirns verbessern oder vor zu starker<br />
Einlagerung in die Fettzellen und damit vor Übergewicht<br />
schützen kann.<br />
Quelle:idw 26.11.<strong>2002</strong><br />
Erbgut des<br />
Malaria-Erregers und<br />
der Anopheles-Mücke entziffert<br />
Das Erbgut des Malaria-Erregers und der<br />
Malaria-Mücke ist entziffert. Die Genomdaten<br />
könnten zur Grundlage für die Entwicklung neuer<br />
Medikamente, Insektengifte und Impfungen werden,<br />
hoffen die Wissenschaftler.<br />
Malaria ist die weltweit bedeutsamste Tropenkrankheit.<br />
Sie tötet nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation<br />
etwa eine Million Menschen<br />
im Jahr. Rund 90 Prozent der Opfer leben in<br />
Afrika südlich der Sahara, fast drei Viertel sind Kinder<br />
unter fünf Jahren. Zwischen 300 Mill. und 500<br />
Mill. Menschen werden jährlich neu infiziert.<br />
Das britische Fachblatt «Nature» (Bd. 419, S. 498)<br />
veröffentlichte die Analyse des Genoms von «Plasmodium<br />
falciparum». Der einzellige Parasit vermehrt<br />
sich in der Leber und den roten Blutkörperchen<br />
des Menschen und verursacht dabei die für<br />
Malaria typischen Fieberschübe. Diese Arbeit entstand<br />
unter Leitung von Malcolm Gardener vom<br />
Institut für Genomforschung in Rockville (US-<br />
Staat Maryland).<br />
Die Entschlüsselung des Erbguts der Malaria-<br />
Mücke «Anopheles gambiae» wurde in «Science»<br />
(Bd. 298, S. 129) publiziert. Die Moskitos sind die<br />
wichtigsten Überträger der Einzeller, die mit den<br />
Blut saugenden Insekten von Mensch zu Mensch<br />
gelangen. Erstautor dieser Untersuchung ist<br />
Robert Holt vom US-Biotechnik-Unternehmen<br />
Celera Genomics (ebenfalls Rockville). Die Gendaten<br />
von Stechmücke und Einzeller stehen anderen<br />
Forschern zur Verfügung, heißt es in den beiden<br />
Studien.<br />
Die Mücke hat nach den neuen Ergebnissen<br />
schätzungsweise etwa 280 Millionen Erbgut-Bausteine,<br />
bei Plasmodium sind es rund 23 Millionen.<br />
Zum Vergleich: Der Mensch besitzt drei Milliarden<br />
DNA-Bausteine.<br />
Die Daten seien nur die Grundlage für die Schaffung<br />
neuer Strategien gegen die Malaria, betonen<br />
beide Forscherteams. Jetzt müsse in den Genomen<br />
der beiden Organismen nach Zielen und<br />
Mechanismen für neue Medikamente gesucht<br />
werden. Derartige Substanzen könnten künftig<br />
beispielsweise verhindern, dass die Mücken ihre<br />
menschlichen Opfer erschnüffeln. Wirksam sei es<br />
voraussichtlich auch, das Eindringen der Einzeller<br />
in die roten Blutkörperchen zu verhindern. Denkbar<br />
wäre ebenfalls, gentechnisch veränderte und<br />
damit für den Menschen ungefährliche Mücken in<br />
die Natur zu entlassen. Sie sollen dann die natürlichen<br />
Varianten verdrängen.<br />
Quelle: dpa, 02.10.02