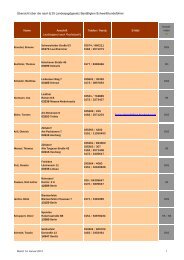Arbeitshilfe Bebauungsplanung - Ministerium für Infrastruktur und ...
Arbeitshilfe Bebauungsplanung - Ministerium für Infrastruktur und ...
Arbeitshilfe Bebauungsplanung - Ministerium für Infrastruktur und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Festsetzungen B 2.3<br />
STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN<br />
Regelungen zur Anordnung <strong>und</strong> Ausrichtung von Gebäuden <strong>und</strong> sonstigen baulichen Anlagen<br />
können aus unterschiedlichen Gründen erforderlich werden, etwa zur Belichtung <strong>und</strong> Besonnung<br />
von Gebäuden, zur Durchlüftung von Siedlungsbereichen, zur Sicherstellung eines<br />
ungestörten R<strong>und</strong>funkempfangs bzw. Funkverkehrs, zur Sicherung von Standorten der Windenergie<br />
oder zur Nutzung von Solarenergie. In vielen Fällen sind auch Immissionsschutzaspekte<br />
wie die Abschirmung einer schutzbedürftigen Nutzung gegenüber Lärm oder anderen<br />
Immissionen oder stadtgestalterische Gründe wie die Sicherung einer erhaltenswerten Aussicht<br />
der Gr<strong>und</strong>, die Stellung baulicher Anlagen zu regeln.<br />
Problemaufriss<br />
Die Anordnung der Gebäude innerhalb eines Baugebietes wird in Bebauungsplänen in der<br />
Regel durch mehr oder weniger differenzierte Festsetzungen zu den überbaubaren <strong>und</strong> nicht<br />
überbaubaren Gr<strong>und</strong>stücksflächen bis hin zu Baukörperausweisungen festgelegt ( B 2.2).<br />
Die Anordnung der Gebäude auf den Baugr<strong>und</strong>stücken wird darüber hinaus maßgeblich<br />
durch Festsetzungen zur Bauweise beeinflusst ( B 2.1). Mit der Festsetzung der Stellung<br />
der baulichen Anlagen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB besteht die Möglichkeit, diese Festsetzungen<br />
hinsichtlich der Ausrichtung der Gebäude <strong>und</strong> baulichen Anlagen zu ergänzen.<br />
Festsetzungen zur Stellung der baulichen Anlagen zielen auf die Ausrichtung der Längsachse<br />
von Gebäuden. Bei Gebäuden mit einem Satteldach ist die Längsachse mit der Firstrichtung<br />
identisch; bei Gebäuden mit anderen Dächern ergibt sich die Längsachse aus dem Verhältnis<br />
der Seiten zueinander.<br />
Als (b<strong>und</strong>esrechtliche) Festsetzungen müssen auch Festsetzungen der Stellung der baulichen<br />
Anlagen städtebaulich begründet sein. Bei stadtgestalterisch begründeten Festsetzungen<br />
muss dabei ein über das einzelne Gebäude hinausgreifender Begründungszusammenhang<br />
erkennbar sein. Dieser ist zum Beispiel dann gegeben, wenn <strong>für</strong> ein Einfamilienhausgebiet in<br />
Hanglage die Ausrichtung der Gebäude parallel zu den Höhenlinien vorgegeben werden soll,<br />
so dass sich aus der Ferne eine homogene Dachlandschaft zeigt. Bei der Überplanung<br />
vorhandener Bebauungsstrukturen kann eine das Straßenbild prägende traufständige Ausrichtung<br />
der Gebäude eine entsprechende Festsetzung der Gebäudestellung rechtfertigen.<br />
Sind Festlegungen zur Stellung baulicher Anlagen hingegen ausschließlich Einzelgebäudebezogen<br />
begründet, z.B. mit der angestrebten Rekonstruktion eines historischen Zustandes in<br />
einer ansonsten heterogenen Gesamtstruktur, so können sie nur als baugestalterische Regelungen<br />
auf der Gr<strong>und</strong>lage von § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 BbgBO in einen Bebauungsplan<br />
aufgenommen werden ( B 29.1 „Gestaltungsfestsetzungen“). Bei übergeordneten städtebaulichen<br />
Gestaltungszielen können Festsetzungen zur Gebäudestellung nach § 9 Abs. 1<br />
Nr. 2 BauGB auch zusammen mit baugestalterischen Festsetzungen nach § 81 BbgBO, z.B.<br />
zur Ausgestaltung der Dächer, im Bebauungsplan festgesetzt werden.<br />
Die Stellung der baulichen Anlagen kann textlich oder zeichnerisch festgesetzt werden. Die<br />
Planzeichenverordnung sieht hier<strong>für</strong> kein Planzeichen vor. In der Praxis ist die Verwendung<br />
eines Doppelpfeils <strong>für</strong> die Bestimmung der Gebäude- bzw. Firstausrichtung gebräuchlich.<br />
Die Darstellung der Gebäudeausrichtung im Plan muss eindeutig sein. Sie ist innerhalb der<br />
jeweils betroffenen (überbaubaren) Gr<strong>und</strong>stücksfläche einzutragen; wechselt sie innerhalb<br />
eines Baufensters die Richtung, so sind die Flächen unterschiedlicher Festsetzung mit einer<br />
Trennlinie, z.B. einer gebrochenen schwarzen Linie, gegeneinander abzugrenzen. Die Verwendung<br />
einer so genannten Knotenlinie ist hier nicht angezeigt, da diese Signatur gemäß Anlage<br />
zur Planzeichenverordnung (Pkt. 15.14) zur Abgrenzung unterschiedlicher Arten der Nutzung<br />
sowie unterschiedlicher Nutzungsmaße innerhalb eines Baugebietes verwendet werden soll.<br />
Planungsrechtlicher<br />
Rahmen<br />
städtebauliche Begründung<br />
auch bei Gründen der<br />
Gestaltung des Ortsbildes<br />
Abgrenzung zu Gestaltungsregelungen<br />
nach § 9 Abs. 4<br />
BauGB i.V.m. § 81 BbgBO<br />
Planzeichen zur Bestimmung der<br />
Gebäudeausrichtung / Firstrichtung<br />
eindeutige Bestimmung<br />
Abgrenzung von Bauflächen<br />
unterschiedlicher Vorgaben<br />
durch eine Trennlinie<br />
MIR Brandenburg / <strong>Arbeitshilfe</strong> <strong>Bebauungsplanung</strong> / Juni 2007 1 / 2



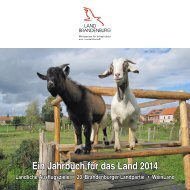
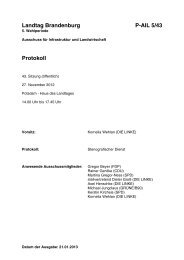
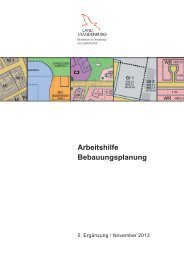
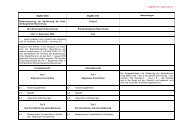

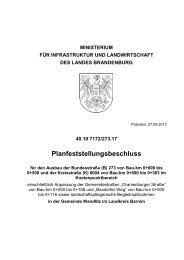

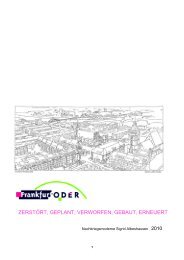
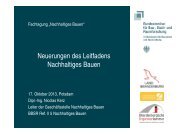

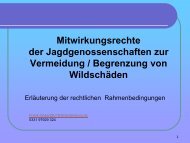
![Andreas Elz, Brandenburgische Architektenkammer. [PDF 1,2 MB]](https://img.yumpu.com/24810280/1/190x135/andreas-elz-brandenburgische-architektenkammer-pdf-12-mb.jpg?quality=85)