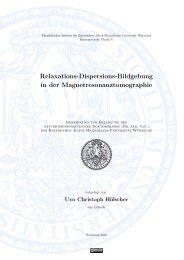Stellenwert der Elektrocochleographie bei der Diagnose von ...
Stellenwert der Elektrocochleographie bei der Diagnose von ...
Stellenwert der Elektrocochleographie bei der Diagnose von ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
7<br />
Bei <strong>der</strong> Beschallung des Ohres werden die Auslenkungen des Steigbügels<br />
(Stapes) über das ovale Fenster auf die mit Perilymphflüssigkeit gefüllte Scala<br />
vestibuli übertragen, welche ausweicht. Diese Auslenkung <strong>der</strong> kochleären<br />
Trennwand führt zu einer Scherbewegung, vor allen zwischen Tektorialmembran<br />
und Corti-Organs. Dadurch, dass die Tektorialmembran die Spitze<br />
<strong>der</strong> längsten Stereozilien berührt, werden diese abgeschert; dies stellt den Reiz<br />
für die Haarzellen dar und führt eine Membranpotentialän<strong>der</strong>ung her<strong>bei</strong> (Ryan<br />
und Dallos 1984). Die Ionenkanälchen in <strong>der</strong> apikalen Zellmembran öffnen sich<br />
durch einen Transducermechanismus und erlauben endolymphatischen Kaliumionen<br />
entlang <strong>der</strong> elektrochemischen Potentialdifferenz in das Zellinnere <strong>der</strong><br />
äußeren Haarzelle einzudringen. Durch den Kaliumeintritt in die Haarzelle<br />
kommt es zur Depolarisation und damit zur Ausbildung des Rezeptorpotentials<br />
(Zenner 1987). Bei <strong>der</strong> anschließenden Repolarisation <strong>der</strong> Haarzelle werden<br />
zwei Mechanismen genutzt: Zum einen werden die Stereozilien zurückgelenkt,<br />
zum an<strong>der</strong>en steigert die Repolarisation die Öffnungswahrscheinlichkeit <strong>von</strong><br />
kaliumspezifischen Kanälen in <strong>der</strong> lateralen Zellmembran und lassen Kalium in<br />
den Perilymphraum ausfließen (Ashmore und Meech 1986, Gitter et al. 1986).<br />
Eine passive Wan<strong>der</strong>welle bildet sich durch die oben beschriebene Trennwandauslenkung<br />
aus, die an einem bestimmten Ort entlang <strong>der</strong> Basilarmembran in<br />
Abhängigkeit <strong>von</strong> <strong>der</strong> Frequenz des Stimulus bis zu einem Maximum zunimmt<br />
und im weiteren Verlauf fast abrupt wie<strong>der</strong> abnimmt (Modell <strong>der</strong> Wan<strong>der</strong>welle<br />
nach v.Békésy 1960).<br />
Für hohe Frequenzen ist die maximale Auslenkung <strong>der</strong> kochleären Trennwand<br />
basal, für niedrigere Frequenzen apikal lokalisiert. Analysen über die Auslenkung<br />
<strong>der</strong> Basilarmembran (Le Page und Johnstone 1980, Sellick et al. 1982)<br />
ergaben, dass diese größer war als nach dem <strong>von</strong> v. Békésy 1960 beschriebenen<br />
Modell angenommen wurde. Deshalb wurde ein aktiver energieverbrauchen<strong>der</strong><br />
Prozess postuliert, <strong>der</strong> die breite passive Wan<strong>der</strong>welle in hohe scharfe<br />
Spitzen umwandelt, sie auf einer sehr schmalen Region <strong>der</strong> kochleären Trennwand<br />
abbildet und zu einer höheren Schärfe <strong>der</strong> Frequenzselektivität führt. Zugeschrieben<br />
wird diese Funktion den äußeren Haarzellen, die durch ihre Anord-