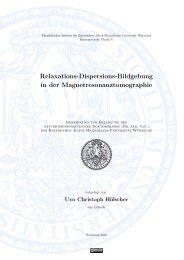Stellenwert der Elektrocochleographie bei der Diagnose von ...
Stellenwert der Elektrocochleographie bei der Diagnose von ...
Stellenwert der Elektrocochleographie bei der Diagnose von ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
53<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Ar<strong>bei</strong>t wurden die elektrophysiologischen und klinischen Daten<br />
<strong>von</strong> 182 Patienten mit Morbus Menière, 125 Patienten mit Verdacht auf Morbus<br />
Menière (festgelegt nach AAO-HNS (1995) <strong>Diagnose</strong>stufe 4) und 196 Patienten<br />
mit sonstigen Innenohrerkrankungen retrospektiv bezüglich ihrer Spezifität<br />
und Sensitivität in <strong>der</strong> Diagnostik eines Morbus Menière analysiert. Ziel <strong>der</strong> Analyse<br />
war es, den Wert <strong>der</strong> ECoG für die Diagnostik an unserem Patientenkollektiv<br />
zu untersuchen.<br />
Die Verteilung des Verhältnisses männlich und weiblich war annährend gleich mit<br />
geringem Überwiegen des weiblichen Geschlechts. Statistisch ergab es keinen<br />
Unterschied. In <strong>der</strong> Literatur schwanken die Angaben über eine Geschlechtshäufung.<br />
Watanabe (1981) fand ein Überwiegen des männlichen Geschlechts; in<br />
einer neueren Veröffentlichung <strong>von</strong> 1995 mit 958 Patienten ein Überwiegen <strong>der</strong><br />
weiblichen Patienten (Watanabe und Mizukoski 1995).<br />
Das durchschnittliche Alter <strong>der</strong> Patienten lag in dieser Ar<strong>bei</strong>t <strong>bei</strong> 47,82 Jahre.<br />
Von diesen 503 Patienten waren sechs im Alter <strong>von</strong> unter 18 Jahren an Morbus<br />
Menière erkrankt. Dies entspricht <strong>der</strong> Häufigkeit <strong>der</strong> erkrankten Kin<strong>der</strong> in einer<br />
Studie <strong>von</strong> Häusler et al. (1987), in <strong>der</strong> etwa 100-mal häufiger Erwachsene als<br />
Kin<strong>der</strong> erkrankten. Auch Sadé und Yaniv (1984) und Filipo und Barbara (1985)<br />
betonten aufgrund <strong>der</strong> geringen <strong>von</strong> ihnen gefundenen Fallzahl eines Morbus<br />
Menière im Kindesalter die häufige Fehldiagnosestellung.<br />
Eine Aussage zur Häufigkeit <strong>der</strong> Erkrankung einer Ohrseite konnte anhand <strong>der</strong><br />
im Rahmen <strong>der</strong> vorliegenden Ar<strong>bei</strong>t erhaltenen Ergebnisse nicht getroffen werden.<br />
Das linke Ohr schien häufiger erkrankt zu sein als das rechte Ohr, diese<br />
Annahme konnte aber statistisch nicht bestätigt werden. Stahle (1976) fand in<br />
seiner Studie mit 356 Patienten ein leichtes Überwiegen <strong>der</strong> rechten Ohrseite;<br />
während Haid et al. (1995) ein leichtes Überwiegen <strong>der</strong> linken Ohrseite (<strong>bei</strong> insgesamt<br />
574 Patienten) feststellten.<br />
Das Symptom „Tinnitus“ trat <strong>bei</strong> den hier untersuchten Patienten mit Morbus Menière<br />
bzw. <strong>bei</strong> <strong>der</strong> Patientengruppe mit Verdacht auf Morbus Menière deutlich<br />
häufiger auf, als <strong>bei</strong> den Patienten mit sonstigen Innenohrerkrankungen. Statistisch<br />
war dieses Ergebnis hochsignifikant. Katholm und Vesterhauge (1993) und