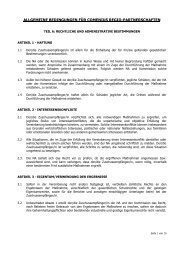oead.news Nr. 88/2013 - Österreichischer Austauschdienst
oead.news Nr. 88/2013 - Österreichischer Austauschdienst
oead.news Nr. 88/2013 - Österreichischer Austauschdienst
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10<br />
Helmut Habersack<br />
Danube River Research and<br />
Management DREAM<br />
Ein Forschungs-Flagshipprojekt im Rahmen<br />
der Donauraumstrategie<br />
Univ. Prof. DI Dr. Helmut Habersack ist Leiter des Christian Doppler<br />
Labors für Innovative Methoden in Fließgewässermonitoring,<br />
Modellierung und Flussbau am Institut für Wasserwirtschaft,<br />
Hydrologie und konstruktiven Wasserbau, Department für Wasser,<br />
Atmosphäre und Umwelt an der Universität für Bodenkultur Wien .<br />
© cdg<br />
Das Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und<br />
konstruktiven Wasserbau an der Universität für Bodenkultur<br />
Wien unter der Leitung von Prof. Habersack<br />
hat eine führende Position in der Forschung in den Bereichen<br />
Fließgewässermonitoring, Modellierung und<br />
Flussbau inne, sowohl EU- als auch nationale Projekte<br />
wurden koordiniert. Das Institut kann auf langjährige<br />
und erfolgreiche Kooperationen im Donauraum zurückblicken,<br />
wobei unterschiedliche Fragestellungen<br />
und Thematiken bearbeitet wurden, wie die nachfolgenden<br />
Beispiele zeigen. Seit 2010 leitet Prof. Habersack<br />
auch das Christian Doppler-Labor für Innovative<br />
Ansätze in Fließgewässermonitoring, Modellierung<br />
und Flussbau.<br />
Die hydromorphologische Beeinflussung von Fließgewässern<br />
ist als potenzielles Konfliktfeld zwischen<br />
Umweltschutz und anthropogenen Nutzungen der<br />
Flüsse (z.B. Schifffahrt, Hochwasserschutz und Wasserkraftnutzung)<br />
zu sehen. Aus diesem Grund wurden<br />
im Zuge des PLATINA-Projekts (FP7–Projekt) in den<br />
Jahren 2009/10 an der gesamten Donau sämtliche<br />
hydromorphologische Aspekte eines integrativen<br />
Flussgebietsmanagements untersucht. Zusammenfassend<br />
zeigten die Ergebnisse, dass die Bewertung<br />
bzw. Berücksichtigung der Gewässermorphologie und<br />
ihrer dynamischen Prozesse nicht nur für ökologische<br />
Fragen aber auch für alle weiteren Formen der Gewässernutzung<br />
(z.B. Schifffahrt) von Bedeutung sind.<br />
Während im Unterlauf der Erhalt der Morphodynamik<br />
im Vordergrund steht, gewinnt im Mittel- und Oberlauf<br />
der Rückbau (z.B. Entfernung der Ufersicherung,<br />
Gewässervernetzung) an Bedeutung. An der Donau<br />
östlich von Wien wird derzeit im Rahmen des Pilotprojektes<br />
Bad Deutsch Altenburg ein Naturversuch<br />
zur Stabilisierung der Donau, Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen<br />
und der Ökologie durchgeführt.<br />
Im Bereich des integrierten Hochwasserschutzes<br />
fordert die EU-Hochwasserrichtlinie eine verstärkte<br />
Zusammenarbeit der Anrainerstaaten an grenzüberschreitenden<br />
Flüssen. Die Donau als größter Fluss in<br />
der Europäischen Union stellt hierbei in Hinblick auf<br />
die Harmonisierung der durch die Richtlinie geforderten<br />
Gefahren- und Risikokarten eine besondere Herausforderung<br />
dar, da eine große Anzahl an Anrainerstaaten<br />
koordiniert werden muss. Die Abstimmung<br />
internationaler Hochwasserschutz-Maßnahmen im<br />
Rahmen eines integrierten Flood-Risk-Managements<br />
erfordert daher ein gemeinsames Begriffsverständnis,<br />
eine gemeinsame Datenbasis und gemeinsam erstellte<br />
und harmonisierte Grundlagenkarten (flood hazard<br />
and risk maps). Diese Zielsetzungen sind integraler<br />
Bestandteil des SEE-Projektes ›Danube FloodRisk‹, in<br />
welchem Wissenschafter/innen, Verwaltungsbehörden,<br />
NGOs und Interessensvertreter/innen anwen-<br />
dungsorientiert an der Entwicklung<br />
einer einheitlichen Methodik zur Erstellung<br />
der Gefahren- und Risikokarten<br />
(Donau-Atlas) arbeiten und somit die<br />
Grundlage für andere Disziplinen wie<br />
Raumplanung oder Wirtschaft in Bezug<br />
auf ein integriertes Risiko-Management<br />
liefern.<br />
Die rumänische Donau, zwischen den<br />
Städten Calarasi und Braila (Fluss-km<br />
375 bis 175) stellt eine weitgehend naturnahe<br />
Bifurkationsstrecke dar. Durch<br />
fortschreitende Durchflussaufteilung<br />
in Richtung linkes Donauufer führt<br />
der rechte Hauptstrom immer weniger<br />
Wasser, wodurch u.a. die Schiffe<br />
einen Umweg von ca. 110 km in Richtung<br />
Schwarzes Meer in Kauf nehmen<br />
müssen. Um wieder mehr Abfluss im<br />
Hauptstrom zu erhalten, soll durch<br />
eine Sohlrampe die Durchflussaufteilung<br />
geändert werden, wodurch sich<br />
eine Beeinträchtigung der Migration<br />
der Störe ergeben könnte. Um die Auswirkungen<br />
zu minimieren, sollen durch<br />
einen phasenweisen Bau der Sohlrampe<br />
und durch ein begleitendes Monitoring,