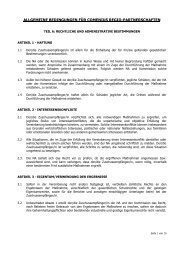oead.news Nr. 88/2013 - Österreichischer Austauschdienst
oead.news Nr. 88/2013 - Österreichischer Austauschdienst
oead.news Nr. 88/2013 - Österreichischer Austauschdienst
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
37<br />
Andreas Wenninger<br />
Über ein geteiltes Land am<br />
Rande Europas<br />
Bukowina-Dialog<br />
MMag. Andreas Wenninger ist Leiter<br />
des OeAD-Kooperationsbüros in Lemberg<br />
Bukowina-Dialog,<br />
Mai 2011<br />
© andreas wenninger<br />
Meine erste Reise in die Bukowina führte<br />
mich im Oktober 2000 durch Ungarn,<br />
zuerst nach Siebenbürgen und dann von<br />
Klausenburg in den Norden Rumäniens.<br />
Von dort planten wir die rumänischukrainische<br />
Grenze zu passieren. Ich<br />
fuhr mit einem von der Österreich-Kooperation<br />
organisierten Reisebus nach<br />
Czernowitz zum 125-Jahr-Jubliäum der<br />
dortigen Universität, von wo wir nach<br />
Lemberg weiterreisen wollten.<br />
Nach einer kurzweiligen Fahrt durch die<br />
Karpatenwälder Rumäniens besuchten<br />
wir das Kloster Voronet. Wie andere<br />
nordrumänische Klöster ist es innen<br />
und außen ganz mit wilden und wunderschönen<br />
Bildern bemalt. Neben dem<br />
Kloster trieb eine alte Frau eine Herde<br />
Gänse zum Bach, und alles sah aus wie in<br />
einem Märchen. Die Klöster Moldovita<br />
und Sucevita seien noch viel schöner als<br />
Voronet, beteuerten uns Mitreisende.<br />
Wir fuhren durch endloses, bewaldetes<br />
Hügelland. In Moldovita und Sucevita<br />
bestaunten wir Bilder von Engeln, Teufeln<br />
und Drachen, frommen Gläubigen<br />
und ›bösen‹ Türken – die Bemalungen<br />
hatten während der Kriege gegen das<br />
Osmanische Reich als christliche Propaganda<br />
gedient. Die bemalten Klöster<br />
sind eine der bekanntesten Attraktionen<br />
der Bukowina.<br />
Doch das kleine Land am östlichen Rand Mitteleuropas<br />
existiert nur noch dem Namen nach: Der Süden gehört<br />
zu Rumänien, der Norden mit der einstigen Hauptstadt<br />
Czernowitz zur Ukraine.<br />
Geschichte als Fundament<br />
Einst war die Bukowina Teil des Herzogtums Moldau<br />
gewesen, dann der Habsburgermonarchie. Nach<br />
dem Ersten Weltkrieg fiel sie an Rumänien, das eine<br />
Großmacht werden wollte und sich bald auf die Seite<br />
der Nazis schlug. 1940 marschierte die Rote Armee<br />
ein, dann die deutsche Wehrmacht, dann wieder die<br />
Sowjets. Auch nach 1991 blieb die Bukowina geteilt.<br />
Mittlerweile ist der Graben sogar tiefer geworden:<br />
Heute verläuft die EU-Außengrenze mitten durch<br />
die Region. Rumän/innen müssen seit einigen Jahren<br />
kein Visum mehr vorzeigen, wenn sie den anderen<br />
Teil besuchen wollen, Ukrainer/innen schon.<br />
Das Bukowina-Forschungszentrum, das mit Hilfe der<br />
Österreich-Kooperation bereits Anfang der 90er-Jahre<br />
an der Czernowitzer Yurij-Fedkowytsch-Universität<br />
eingerichtet wurde und auch eine Österreich-Bibliothek<br />
beherbergte, war die erste Einrichtung, die sich<br />
zum Ziel setzte, gemeinsame bukowinische Projekte<br />
zu initiieren und durchzuführen. Hierzu wurden regelmäßig<br />
Expert/innen und Wissenschafter/innen aus<br />
Rumänien, aus der Ukraine, aus Deutschland und aus<br />
Österreich nach Czernowitz eingeladen und in Form<br />
von Konferenzen, gemeinsamen Ausstellungen und<br />
Literaturprojekten erste Dialog-Veranstaltungen abgehalten.<br />
Zwischenzeitlich beschäftigten sich zahlreiche<br />
Wissenschafter/innen (historisch, literaturwissen-<br />
schaftlich und kulturwissenschaftlich) mit der Region<br />
Bukowina: so zum Beispiel Andrei Corbea-Hoisie in<br />
Iasi, Winfried Menninghaus in Berlin, Peter Rychlo in<br />
Czernowitz und viele mehr, die Czernowitz und die Bukowina<br />
auch als Topos deutsch-jüdischer und multikultureller<br />
Geschichte und Literatur untersuchten. Die<br />
ehemalige Metropole des östlichsten habsburgischen<br />
Kronlandes Bukowina hatte viele bedeutende Schriftsteller/innen,<br />
Künstler/innen und Wissenschafter/<br />
innen hervorgebracht, die bis heute Gegenstand von<br />
Forschungen und Publikationen sind.<br />
Der österreichische Wissenschafter, Geograf und<br />
Historiker Kurt Scharr schrieb im Zuge mehrerer Forschungsreisen<br />
in den letzten 15 Jahren nicht nur einen<br />
informativen Bukowina-Reiseführer, sondern auch<br />
eine wissenschaftliche Abhandlung über ›Die Landschaft<br />
Bukowina‹ mit dem Titel ›Das Werden und Vergehen<br />
einer Region an der Peripherie 1774-1918‹, die<br />
2010 erschien.<br />
Tatsächlich erlebte vor allem Czernowitz während der<br />
relativ friedlichen Zeit unter österreichischer Herrschaft<br />
einen Aufschwung. Armenische, polnische,<br />
rumänische, russische, slowakische, ukrainische, ungarische<br />
und deutsche Menschen, viele von ihnen<br />
Juden und Jüdinnen, lebten friedlich nebeneinander.<br />
Drei oder mehr Sprachen zu sprechen, galt als normal.<br />
Das funktionierte vor allem deshalb so gut, weil ›keine<br />
der Nationen in der Bukowina über eine ausreichende<br />
Mehrheit verfügte und somit (jede) gezwungen war,<br />
konsensorientierte Koalitionen zu anderen zu suchen‹,<br />
schreibt Kurt Scharr in seinem Buch.<br />
Das 20. Jahrhundert verlief weit düsterer. Zwischen