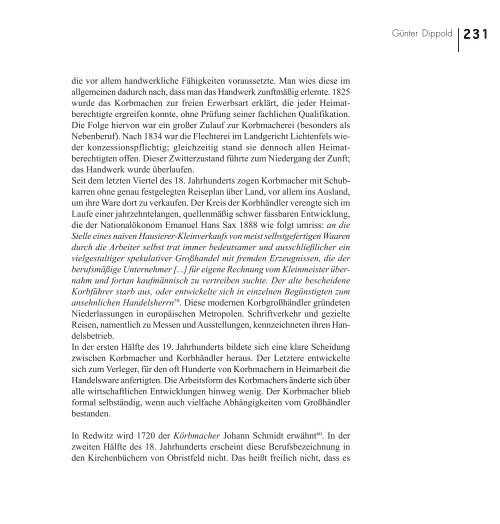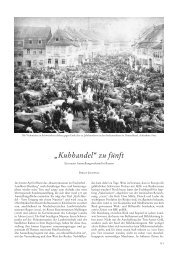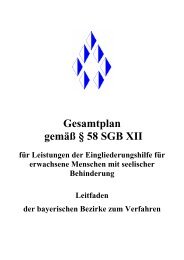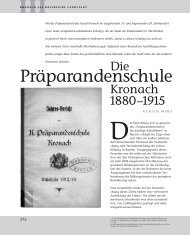Kapitel 9 für PDF - Bezirk Oberfranken
Kapitel 9 für PDF - Bezirk Oberfranken
Kapitel 9 für PDF - Bezirk Oberfranken
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
die vor allem handwerkliche Fähigkeiten voraussetzte. Man wies diese im<br />
allgemeinen dadurch nach, dass man das Handwerk zunftmäßig erlernte. 1825<br />
wurde das Korbmachen zur freien Erwerbsart erklärt, die jeder Heimatberechtigte<br />
ergreifen konnte, ohne Prüfung seiner fachlichen Qualifikation.<br />
Die Folge hiervon war ein großer Zulauf zur Korbmacherei (besonders als<br />
Nebenberuf). Nach 1834 war die Flechterei im Landgericht Lichtenfels wieder<br />
konzessionspflichtig; gleichzeitig stand sie dennoch allen Heimatberechtigten<br />
offen. Dieser Zwitterzustand führte zum Niedergang der Zunft;<br />
das Handwerk wurde überlaufen.<br />
Seit dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts zogen Korbmacher mit Schubkarren<br />
ohne genau festgelegten Reiseplan über Land, vor allem ins Ausland,<br />
um ihre Ware dort zu verkaufen. Der Kreis der Korbhändler verengte sich im<br />
Laufe einer jahrzehntelangen, quellenmäßig schwer fassbaren Entwicklung,<br />
die der Nationalökonom Emanuel Hans Sax 1888 wie folgt umriss: an die<br />
Stelle eines naiven Hausierer-Kleinverkaufs von meist selbstgefertigen Waaren<br />
durch die Arbeiter selbst trat immer bedeutsamer und ausschließlicher ein<br />
vielgestaltiger spekulativer Großhandel mit fremden Erzeugnissen, die der<br />
berufsmäßige Unternehmer [...] <strong>für</strong> eigene Rechnung vom Kleinmeister übernahm<br />
und fortan kaufmännisch zu vertreiben suchte. Der alte bescheidene<br />
Korbführer starb aus, oder entwickelte sich in einzelnen Begünstigten zum<br />
ansehnlichen Handelsherrn 59 . Diese modernen Korbgroßhändler gründeten<br />
Niederlassungen in europäischen Metropolen. Schriftverkehr und gezielte<br />
Reisen, namentlich zu Messen und Ausstellungen, kennzeichneten ihren Handelsbetrieb.<br />
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildete sich eine klare Scheidung<br />
zwischen Korbmacher und Korbhändler heraus. Der Letztere entwickelte<br />
sich zum Verleger, <strong>für</strong> den oft Hunderte von Korbmachern in Heimarbeit die<br />
Handelsware anfertigten. Die Arbeitsform des Korbmachers änderte sich über<br />
alle wirtschaftlichen Entwicklungen hinweg wenig. Der Korbmacher blieb<br />
formal selbständig, wenn auch vielfache Abhängigkeiten vom Großhändler<br />
bestanden.<br />
In Redwitz wird 1720 der Körbmacher Johann Schmidt erwähnt 60 . In der<br />
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erscheint diese Berufsbezeichnung in<br />
den Kirchenbüchern von Obristfeld nicht. Das heißt freilich nicht, dass es<br />
Günter Dippold<br />
231<br />
231