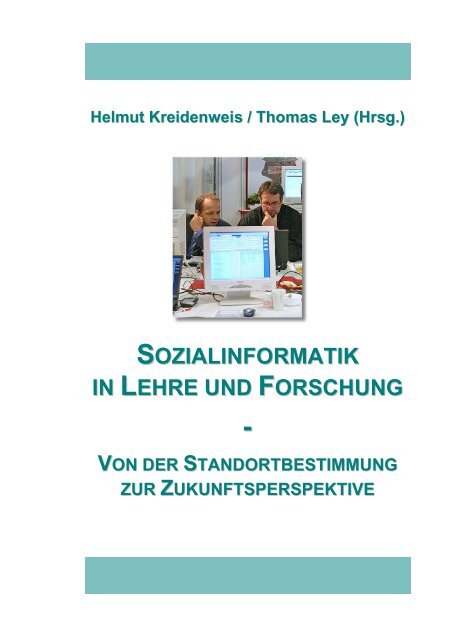SOZIALINFORMATIK IN LEHRE UND FORSCHUNG - wikiinarbeit
SOZIALINFORMATIK IN LEHRE UND FORSCHUNG - wikiinarbeit
SOZIALINFORMATIK IN LEHRE UND FORSCHUNG - wikiinarbeit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Helmut Kreidenweis / Thomas Ley (Hrsg.)<br />
<strong>SOZIAL<strong>IN</strong>FORMATIK</strong><br />
<strong>IN</strong> <strong>LEHRE</strong> <strong>UND</strong> <strong>FORSCHUNG</strong><br />
-<br />
VON DER STANDORTBESTIMMUNG<br />
ZUR ZUKUNFTSPERSPEKTIVE
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 2
<strong>IN</strong>HALTSVERZEICHNIS:<br />
Helmut Kreidenweis / Thomas Ley<br />
Vorwort ..............................................................................................................4<br />
I. CURRICULARE KONSEQUENZEN...........................................................................8<br />
Helmut Kreidenweis<br />
Sozialinformatik in der Lehre – Ein Konzept zur systematischen<br />
Verankerung in der Ausbildung ...................................................................9<br />
Ursula Mosebach / Hans-Jürgen Göppner<br />
Sozialinformatik studieren im virtuellen Seminarraum............................22<br />
Christiane Rudlof<br />
Benutzerzentrierte Anforderungsanalyse als Bestandteil der<br />
Sozialinformatik...........................................................................................34<br />
II. OPTIONEN DES <strong>IN</strong>TERNETS ...............................................................................39<br />
Hans Joachim Gehrmann<br />
Sozialberatung im Internet .........................................................................40<br />
Harald Mehlich<br />
Modernisierung sozialer Institutionen durch eGovernment als<br />
Herausforderung für die Sozialinformatik.................................................50<br />
III. IT-GESTÜTZTE DOKUMENTATION .....................................................................61<br />
Silke Axhausen<br />
Einige Anmerkungen zu IT-gestützten Dokumentations-systemen in der<br />
Sozialen Arbeit ............................................................................................62<br />
Martin Schmid<br />
Chancen und Grenzen IT-gestützter Dokumentation am Beispiel der<br />
Drogenhilfe ..................................................................................................79<br />
Nora Gaupp<br />
Entwicklung eines EDV-gestützten Dokumentationssystems für das<br />
Case Management mit benachteiligten Jugendlichen im<br />
Modellprogramm „Kompetenzagenturen“ ................................................95<br />
Autorenverzeichnis.......................................................................................102<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 3
Vorwort<br />
Die Sozialinformatik beginnt sich an den Hochschulen zu etablieren, Fachzeitschriften<br />
greifen das Thema vermehrt auf, ein (inter-)disziplinärer Diskurs<br />
kommt in Gang. Doch bislang wurden Lehrinhalte und Studienkonzepte wenig<br />
fachöffentlich diskutiert, empirische Forschung gibt es bisher kaum. Dabei<br />
boomt der IT-Einsatz in der Praxis und dringt immer weiter in die Kernprozesse<br />
sozialer Organisationen vor. - Zeit also für vermehrte Impulse aus Lehre und<br />
Forschung.<br />
Der vorliegende Tagungsband speist sich aus Beiträgen von zwei Fachtagungen,<br />
die in der Katholischen Fachhochschule in Mainz am 11. Januar sowie am<br />
26. Juni 2005 unter dem Titel „Sozialinformatik in Lehre und Forschung – Von<br />
der Standortbestimmung zur Zukunftsperspektive“ durchgeführt wurden.<br />
Ziel der Tagungen war es, Lehrende und Forschende im noch offenen Feld der<br />
Sozialinformatik zusammen zu bringen und den fachlichen Diskurs zu bündeln.<br />
Sie dienten der Standortbestimmung, sollten eine Basis für die Vernetzung der<br />
bislang verstreuten Aktivitäten bilden und nicht zuletzt Zukunftsperspektiven für<br />
das Fachgebiet entwickeln.<br />
Der 1. Fachtag Sozialinformatik im Januar 2005 hatte eine unerwartet breite<br />
Resonanz ausgelöst. Von den eingereichten Beitragsvorschlägen konnte nur<br />
knapp die Hälfte berücksichtigt werden und das Interesse der Teilnehmer an<br />
einer Fortführung war hoch, so dass wir - entgegen des ursprünglichen Konzeptes<br />
eines jährlichen Turnus - im Juni 2005 einen 2. Fachtag veranstaltet haben.<br />
Die inhaltlichen Themensetzung der Fachtagungen kreiste um drei Schwerpunkte:<br />
Curriculare Überlegungen, Optionen des Internets und IT-gestützte Dokumentation.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 4
1. Curriculare Überlegungen<br />
Helmut Kreidenweis entwirft auf der Grundlage eines kurzen historischen Überblicks<br />
über curriculare Bemühungen in der Sozialinformatik ein integriertes<br />
Lehrkonzept für IT-Grundausbildung und Sozialinformatik, das die Anforderungen<br />
der Fachpraxis, die Einbindung in das System der Lehre und Fachwissenschaft<br />
sowie den aktuellen Stand und künftige Entwicklungen der Technik berücksichtigt.<br />
Im Zentrum dieses Beitrages stehen Überlegungen zu Struktur und<br />
Themenfeldern der Ausbildung.<br />
Eine besondere Einheit von Form und Inhalt liegt vor, wenn Sozialinformatik im<br />
„virtuellen Seminarraum“ studiert werden kann. Ursula Mosebach und Hans-<br />
Jürgen Göppner beschreiben in ihrem Beitrag Erfahrungen aus vier Semestern<br />
Online-Lehre im Sinne eines Projektberichts. Sie stellen die inhaltlichen und<br />
didaktischen Entscheidungen dar und machen sie so diskutierbar und reflektierbar.<br />
Christiane Rudlof plädiert beim IT-Einsatz in der Sozialen Arbeit und im Sozialen<br />
Management für "Organisation vor Technik". Voraussetzzung dafür ist jedoch,<br />
dass man die eigenen Prozesse der Dienstleistungserbringung ebenso<br />
kennen muss, wie die Grundlagen des Software-Entwicklungsmanagements.<br />
Schwerpunkt des Beitrages bildet daher eine benutzerzentrierte Anforderungsanalyse<br />
als curricularer Bestandteil der Sozialinformatik.<br />
2. Optionen des Internets<br />
Hans-Joachim Gehrmann skizziert den sich entwickelnden Arbeitsbereich „Sozialberatung<br />
im Internet“ in verschiedenen sozialwissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen<br />
Dimensionen. Darauf aufbauend stellt er konkrete Möglichkeiten<br />
der Umsetzung dieser Erkenntnisse vor: Die Entwicklung einer innovativen<br />
Beratungspraxis und der anwendungsbezogenen Lehre anhand eines Kooperationsprojektes<br />
mit beranet / zone 35 und dem Caritasverband Mainz. Leider<br />
liegt dieser Beitrag nur in Form eines Handouts vor.<br />
Harald Mehlich kündigt einen Modernisierungsschub durch moderne Technologien<br />
bei freien und öffentlichen Trägern an. Dieser beruhe auf der flächendeckend<br />
verfügbaren Vernetzung per Internet in und zwischen Organisationen, die<br />
in der öffentlichen Verwaltung verstärkt unter dem Begriff eGovernment thematisiert<br />
wird. Diese Entwicklung hat im sozialen Bereich mit Verzögerung eingesetzt.<br />
Bei hohem Kosten- und Zeitdruck sind effiziente, trägerübergreifende<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 5
Systemlösungen gefragt. Dem steht eine extreme Zersplitterung des Sozialwesens<br />
entgegen, sowohl institutionell als auch bezüglich der eingesetzten technischen<br />
Lösungen. Diese wird bisher durch IT- und organisationsbezogene "Hoheiten"<br />
zementiert, die den integrierten Lösungen im Wege stehen.<br />
3. IT-gestütze Dokumentation<br />
Beim 2. Fachtag stand vor allem die IT-gestützte Dokumentation Sozialer Arbeit<br />
im Mittelpunkt. Sowohl die fachliche als auch die technische Konzeption der<br />
Programme beeinflussen die Kernprozesse Sozialer Arbeit erheblich. Dennoch<br />
wurde die Nutzung solcher Systeme bislang von Seiten der Wissenschaft nur<br />
wenig reflektiert.<br />
Silke Axhausen entfaltet in ihren Anmerkungen zur IT-gestützten Dokumentation<br />
in der Sozialen Arbeit zunächst einen weiten Begriff der klientenbezogenen<br />
Dokumentation und konkretisiert diesen auf den Bereich der Jugendhilfe und<br />
seine Adressaten. Anschließend geht sie auf den Stand der Implementation von<br />
IT-gestützten Dokumentationssystemen in der Sozialen Arbeit ein und zuletzt<br />
schlaglichtartig auf einzelne Programme.<br />
Martin Schmid reflektiert zunächst die Geschichte der Dokumentation in der<br />
Drogenhilfe. Der aktuelle Stand wird anhand zweier Beispiele aus der ambulanten<br />
und aus der niedrigschwelligen Suchthilfe konkretisiert. Schließlich werden<br />
die Zielvorstellungen, die mit der Einführung IT-gestützter Dokumentation in der<br />
Drogenhilfe verbunden waren, zusammengefasst und mit dem bislang Erreichten<br />
verglichen.<br />
Im Mittelpunkt des Beitrages von Nora Gaupp - von dem uns leider nur die Power<br />
Point Präsenation verfügbar ist - steht der Einsatz eines Dokumentationssystems<br />
im Kontext von Maßnahmen der beruflichen und sozialen Integration<br />
von benachteiligten Jugendlichen. Hier wird die inhaltliche Gestaltung von drei<br />
Modulen - biografische Vorgeschichte der Jugendlichen, Aktivitäten im Rahmen<br />
des Fallmanagements und Evaluation der Situation bei Beendigung des Fallmanagements<br />
- vorgestellt.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 6
Die Herausgeber danken der Katholischen Fachhochschule Mainz für die<br />
freundliche Unterstützung sowie die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Weiterhin<br />
möchten wir den Referenten für ihr Engagement danken. Nur auf dieser Basis<br />
konnten die Tagungen ohne großen Organisationsaufwand und weitgehend<br />
kostenneutral durchgeführt werden.<br />
Dem Charakter einer Tagungsdokumentation folgend, wirft dieser Band nur einige<br />
Schlaglichter auf die aktuelle Fachdiskussion. Bewusst haben wir uns dazu<br />
entschlossen, auch nicht textlich komplett ausgearbeitete Dokumente hier zu<br />
publizieren, um diese ebenso der interessierten Fachwelt zugänglich zu machen.<br />
Obgleich die gewählte elektronische Publikationsform einerseits mit Vorläufigkeit<br />
und Flüchtigkeit der dokumentierten Überlegungen assoziiert werden<br />
kann, macht sie andererseits doch eine einfache Verbreitung und den ungehinderten<br />
Zugang zu Wissen (im Sinne des Open Access) möglich.<br />
Trotz der genannten Einschränkungen hoffen wir, mit dem vorliegenden Band<br />
einen weiteren Mosaikstein zur Ausformung der Sozialinformatik im deutschsprachigen<br />
Raum vorlegen zu können. Für Fragen, Anregungen und Kritik sind<br />
wir stets offen.<br />
Eichstätt / Bielefeld<br />
Im Juni 2006<br />
Helmut Kreidenweis<br />
Thomas Ley<br />
Bei Rückfragen, Anregungen oder Interesse zur Aufnahme in die Interessentenliste für Sozialinformatik-Fachtagungen<br />
wenden Sie sich bitte an:<br />
helmut.kreidenweis@ku-eichstaett.de oder thomas.ley@uni-bielefeld.de<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 7
I. CURRICULARE KONSEQUENZEN<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 8
Sozialinformatik in der Lehre – Ein Konzept zur systematischen<br />
Verankerung in der Ausbildung<br />
Helmut Kreidenweis<br />
Überlegungen zur „EDV-Ausbildung“ in FH-Studiengängen für Soziale Arbeit<br />
gab es bereits lange bevor sich die Sozialinformatik als Begriff und Disziplin zu<br />
etablieren begann (vgl. z.B. Kirchlechner/Kolleck 1991, Ohnemüller 1996, Visser/van<br />
Lieshout 1996). Sieht man von der offen-modularen Struktur des niederländischen<br />
Curriculums "Sociale Informatiekunde" (deutsch: van Lieshout,<br />
1998) ab, können die Konzepte aus den 90er Jahren aufgrund der stark gewachsenen<br />
Verbreitung der Computertechnik sowie des Wandels ihrer Anwendung<br />
in sozialen Organisationen heute als weitgehend überholt gelten.<br />
Die jüngeren Publikationen befürworten durchgängig eine stärkere Berücksichtigung<br />
der Sozialinformatik in der Ausbildung, Art und Tiefe der curricularen<br />
Ausprägung unterscheiden sich jedoch und werden nur in Teilaspekten thematisiert.<br />
So beschäftigen sie sich etwa mit der inhaltlichen Ausgestaltung einführender<br />
Lehrveranstaltungen (Ostermann/Tube 2002), beschränken sich auf die<br />
Auflistung von Themenbereichen für management-orientierte Bildungsangebote<br />
(Kohlhoff, 2003) oder widmen sich Randthemen wie der Begründung einer<br />
Vermittlung von Programmierkenntnissen (Jurgovsky, 2004). Das bislang zweifellos<br />
umfassendste Curriculums-Konzept legte Kirchlechner im Jahr 2000 vor.<br />
Es zeigt einen systematischen Aufbau mit Lernzielen, Inhalten und Methoden<br />
und bietet damit zahlreiche Anregungen für die Lehre. Dennoch war es bereits<br />
zum Zeitpunkt seiner Publikation nicht mehr auf der Höhe der technischen Entwicklung<br />
und beschränkte sich zu sehr auf die Ebenen der passiven Techniknutzung<br />
und Technikkritik in der klassischen Sozialarbeit, ohne auf Aspekte des<br />
Informations- und Prozessmanagements in sozialen Organisationen sowie auf<br />
Methoden zur aktive Mitgestaltung von IT-Lösungen und deren Implementation<br />
einzugehen.<br />
Dieser Beitrag will ein integriertes Lehrkonzept für die IT-Grundausbildung und<br />
Sozialinformatik entwerfen, das die Anforderungen der Fachpraxis, die Einbindung<br />
in das System der Lehre und Fachwissenschaft sowie den aktuellen<br />
Stand und künftige Entwicklungen der Technik berücksichtigt. Im Zentrum die-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 9
ses Beitrages stehen Überlegungen zu Struktur und Themenbereichen der<br />
Ausbildung. Nicht berücksichtigt werden hier Fragen der Didaktik und Methodik<br />
sowie der Evaluation der Lehre. Das hier vorgestellte Konzept basiert maßgeblich<br />
auf dem derzeit an der Fachhochschule Neubrandenburg im Studiengang<br />
Soziale Arbeit praktizierten Modell.<br />
1. Sozialinformatik als Disziplin<br />
Ziel dieses Beitrages ist es nicht, Begriff und Gegenstand der Sozialinformatik<br />
zu diskutieren. Angesichts der unterschiedlichen Akzentuierungen in der aktuellen<br />
Diskussion (vgl. Ley 2004) erscheint eine kurze Standpunktklärung im Hinblick<br />
auf die Profilierung der Sozialinformatik in der Lehre dennoch notwendig.<br />
Gegenstand der Sozialinformatik sind in erster Linie fachspezifische Fragen des<br />
IT-Einsatzes in Sozialer Arbeit, sozialen Organisationen und deren Umfeld.<br />
Doch IT-Nutzung in Feldern Sozialer Arbeit und Sozialinformatik sind nicht deckungsgleich:<br />
Wenn ein Sozialarbeiter seine Korrespondenz in Word verfasst<br />
oder eine E-Mail verschickt, ist dies nicht unbedingt schon Thema der Sozialinformatik.<br />
Daher soll hier zwischen allgemeinem IT-Grundwissen und Sozialinformatik<br />
unterschieden werden. Nach Wendt (2000, S. 20) befasst sich die Sozialinformatik<br />
„mit der systematischen Verarbeitung von Informationen im Sozialwesen<br />
in ihrer technischen Konzipierung, Ausführung und Evaluation“. Im Mittelpunkt<br />
steht also die Gestaltung und Reflexion der Prozesse der Informationsverarbeitung<br />
vor allem dort, wo sich fach- oder bereichsspezifische Implikationen<br />
durch den Technikeinsatz ergeben.<br />
Mit dieser Perspektive wird deutlich, dass die disziplinären Wurzeln der Sozialinformatik<br />
nicht, wie etwa von Ley (2004, S. 5) vorgeschlagen, in der Informatik<br />
zu suchen sind. Die auf formal-logische Aspekte der Informationsverarbeitung<br />
fixierte Informatik-Disziplin kann der lebensweltlich orientierten Ko-Produktion<br />
sozialer Dienstleistungen und ihrer sozialwissenschaftlichen Reflexion keinesfalls<br />
gerecht werden. Deshalb besitzt die Sozialinformatik eine deutlich höhere<br />
disziplinär Affinität zur Sozialen Arbeit (vgl. auch Kirchlechner 2000, S. 111) und<br />
zum Sozialmanagement. Die Informatik kommt als Werkzeug dort ins Spiel, wo<br />
fachliche oder organisatorische Fragestellungen im sozialen Handlungsfeld mit<br />
ihren Methoden effektiver, schneller oder qualitativ höherwertiger zu lösen sind.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 10
Einen ähnlichen Bezug zur disziplinären Informatik weisen auch andere<br />
„Bindestrich-Informatiken“ wie etwa die Wirtschaftsinformatik oder die Pflegebzw.<br />
Medizininformatik auf.<br />
Eine interdisziplinäre Orientierung ist für die Sozialinformatik selbstverständlich<br />
und als junge Disziplin ist ihre Entwicklung durchaus offen. Dennoch sollte man<br />
der Versuchung widerstehen, ihr bis dato unerledigte sozialwissenschaftliche<br />
Projekte wie die allgemeine Technikakzeptanz- und Wirkungsforschung oder<br />
bildungssoziologische Fragen der Teilhabe an der Informationsgesellschaft aufzuhalsen.<br />
Vielmehr gilt es, das Profil der Sozialinformatik an den Kernprozessen<br />
Sozialer Arbeit und sozialer Organisationen sowie ihrer Umweltbezüge<br />
auszurichten. Allein hierin findet sich eine immense Spannweite praktisch dringlicher<br />
wie wissenschaftlich anspruchsvoller Fragestellungen, die die Sozialinformatik<br />
geraume Zeit beschäftigen wird.<br />
2. Ausgangssituation und Ziele<br />
Ein mittelfristig tragfähiges Sozialinformatik-Lehrkonzept für muss Anforderungen<br />
und Rahmenbedingungen aus verschiedenen Sphären berücksichtigen und<br />
von dort her seine Ziele formulieren. Die wichtigsten davon sind:<br />
a) Anforderungen der Praxis an das handlungspraktische Wissen der Absolventen<br />
b) Standards der Lehre in einem sozialwissenschaftlich fundierten Studium<br />
c) Stand und Entwicklungstrends der Informationstechnologie und ihrer fachbezogenen<br />
Anwendungsformen<br />
d) Struktur und Gliederung der Ausbildung, hier unter besonderer Berücksichtigung<br />
der Fachhochschulen<br />
a) Anforderungen der Praxis<br />
Die Praxis der Sozialen Arbeit ist derzeit einem beschleunigten Wandlungsprozess<br />
unterworfen, der direkte und indirekte Bezüge zum Einsatz von Informationstechnologien<br />
erkennen lässt. Wichtige Aspekte davon sind<br />
• die Einführung von Qualitätsmanagement-Systemen, die bislang eher amorphe<br />
Arbeitsprozesse in der Sozialen Arbeit vermehrt strukturieren und standardisieren<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 11
• die Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, verbunden mit Evaluation und<br />
Outcome-Orientierung, die eine verstärkte Messung des Erfolgs Sozialer Arbeit<br />
mit sich bringen<br />
• die finanziellen Engpässe aufgrund knapper öffentlicher Mittel, die eine unternehmerische<br />
Steuerung als Voraussetzung für das Überleben im Sozialmarkt<br />
der Zukunft darstellen.<br />
Diese Entwicklungen und die allgemein stark gestiegene Verbreitung der Computertechnik<br />
haben in Arbeitsfeldern wie der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe,<br />
Suchtkrankenhilfe oder Sozialpsychiatrie zu einem verstärkten<br />
Einsatz von Informationstechnologie und ihren fachspezifischen Anwendungsformen<br />
geführt (vgl. Kreidenweis 2002). Die Ungleichzeitigkeiten in der Praxis<br />
sind nach wie vor groß, doch ein Ende der Entwicklung hin zu einer breit gefächerten<br />
und tief in die Kernprozesse sozialer Organisationen hineinreichenden<br />
Nutzung der IT ist nicht abzusehen.<br />
Wie Analysen von Stellenanzeigen zeigen (vgl. Stempfle/Rosenkranz 2003)<br />
werden solide IT-Grundkenntnisse von FH-Absolventen bereits heute vielfach<br />
erwartet. Sozialarbeiter und Führungskräfte in sozialen Organisationen werden<br />
in den kommenden Jahren tagtäglich mit verschiedenen Anwendungsformen<br />
der Informationstechnologie konfrontiert sein.<br />
Fach- und Führungskräfte benötigen darüber hinaus auch Kenntnisse über die<br />
Arbeits- und Funktionsweise einschlägiger Fachsoftware sowie über die Möglichkeiten<br />
und Grenzen ihres Einsatzes. Weiterhin benötigt werden Kenntnisse<br />
über fachspezifische Formen der Internet-Nutzung wie Online-Beratung oder<br />
die Gewinnung von Fach- und Rechtsinformationen.<br />
Führungskräfte brauchen darüber hinaus Wissen über die strategische Bedeutung<br />
der Informationstechnologie sowie über Methoden des IT-Managements in<br />
sozialen Organisationen (vgl. Kreidenweis 2003). Nützlich sind ferner Kenntnisse<br />
über Programme, die steuerungsrelevante Daten bereitstellen oder aufbereiten.<br />
b) Anforderungen der Fachwissenschaft und Lehre<br />
Eine Ausbildung, die an den Anforderungen der künftigen Arbeitgeber von<br />
Hochschulabsolventen vorbeigeht, kann heute kaum mehr gerechtfertigt werden.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 12
Dennoch darf sich ein sozialwissenschaftlich fundiertes Studium darin nicht erschöpfen.<br />
Insbesondere in den komplexen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit<br />
mit seinen spezifischen Formen der Dienstleistungsproduktion muss die<br />
Reflexion der intendierten und nicht intendierten Wirkungen des eigenen Tuns<br />
innerhalb sozio-technischer Systeme integraler Bestandteil der Ausbildung sein<br />
(vgl. Wendt 2000, S. 8f). Dazu gehört auch die Thematisierung der gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen mit ihrer Wirkungen auf die Soziale Arbeit und ihre<br />
Adressaten.<br />
Bezogen auf die Sozialinformatik bedeutet dies zum einen, Einfluss, Grenzen<br />
und Gefahren des IT-Einsatzes auf die verschiedenen fachlichen Settings und<br />
Hilfeformen zu reflektieren. Zum anderen müssen die unter den Stichworten<br />
Informations- und Wissensgesellschaft diskutierten Rahmenbedingungen auf<br />
den Adressatenkreis der Sozialen Arbeit bezogen werden und reflexiv in die<br />
methodischen Handlungsansätze einfließen. Hier geht es etwa um die Ausgrenzung<br />
benachteiligter Menschen von Information und Wissen und um fachlich-methodische<br />
Ansätze der Sozialen Arbeit zur Teilhabe und aktiven Nutzung<br />
moderner Technologien.<br />
c) Stand und Entwicklung der Informationstechnologie<br />
Die Entwicklung der Informationstechnologie ist neben fortwährender Leistungssteigerung<br />
vor allem durch wachsende Vernetzung und ortsunabhängigeren<br />
Einsatz der IT-Systeme gekennzeichnet. Damit verbunden ist die Konvergenz<br />
digitaler Technologien, die beinahe die gesamte Lebens- und Arbeitswelt<br />
durchdringen. Beispiele dafür sind multifunktionale Handys oder digitale Unterhaltungselektronik<br />
auf PC-Basis. Ein Ende dieser Entwicklungen ist nicht abzusehen.<br />
Völlig neue Dimensionen werden durch die wachsenden Möglichkeiten<br />
intelligenter Robotik sowie durch Embedded Systems, also in Alltagsgegenstände<br />
wie Kleidung oder Fahrzeuge integrierte Mikroelektronik erreicht. Anwendungsformen<br />
dafür sind etwa in der Hilfe für mobilitätsbehinderte, geistig behinderte<br />
oder demente Menschen denkbar. Soziale Arbeit muss einerseits die Folgen<br />
dieser Entwicklungen reflektieren, andererseits muss sie Chancen, die sich<br />
daraus ergeben aktiv nutzen und in ihre Arbeitskonzepte integrieren.<br />
Deutlich konkreter sind bereits einige zentrale Entwicklungstrends im Bereich<br />
der fachbezogenen Software: Im Unterschied zu Programmen der 90er Jahre<br />
beschränkt sich zukunftsgerichtete Fachsoftware nicht mehr auf administrativ-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 13
abrechnungstechnische Funktionen oder die nachgehende Dokumentation der<br />
geleisteten Arbeit. Vermehrt werden einzelfallbezogene Hilfeplanungsmodule,<br />
verbunden mit evaluativen Instrumenten wie der Messung der Zielerreichung im<br />
Fallverlauf in die Programme integriert. Soziale Arbeit muss einerseits diese<br />
Funktionalitäten in ihre Geschäftsprozesse integrieren, andererseits muss sie<br />
dazu in der Lage sein, diese tief in Kernprozesse der Hilfeplanung und -<br />
durchführung eingreifenden Software-Funktionalitäten entlang ihrer fachlichen<br />
Erfordernisse aktiv zu gestalten (vgl. Halfar 1997).<br />
d) Struktur der Ausbildung<br />
Durch den Bologna-Prozess ist die Hochschullandschaft den bislang wohl<br />
stärksten Umwälzungen der Nachkriegsgeschichte unterworfen. Ein zukunftsgerichtetes<br />
Konzept der Sozialinformatik muss sich auch diesen neuen strukturellen<br />
Bedingungen stellen.<br />
In der grundständigen Ausbildung scheint sich abzuzeichnen, dass das achtsemestrige<br />
Diplom durch das u.U. ein bis zwei Semester kürzere Bachelor-<br />
Studium abgelöst wird. Für die Sozialinformatik ist hier insbesondere relevant,<br />
inwieweit sich das Volumen der theoretischen Ausbildung in diesem Umstellungsprozess<br />
reduziert. Kommt es zu einer Kompression der Studieninhalte,<br />
wird sie es als neue Disziplin deutlich schwerer haben, sich im Fächerkanon<br />
angemessen zu etablieren. Hinzu kommt die der Finanzkrise der öffentlichen<br />
Haushalte geschuldete, immer restriktivere Stellenbesetzungspraxis an Hochschulen.<br />
Sie kann letztlich zu einer Konzentration auf die angestammten Kernfächer<br />
und zu einer Vernachlässigung innovativer disziplinärer Ausrichtungen<br />
wie der der Sozialinformatik führen.<br />
Geht man davon aus, dass das Gesamtvolumen der Theorie-Ausbildung und<br />
die grundlegende Studienstruktur ähnlich bleiben werden, stellt sich im alten<br />
wie im neuen Modell die Frage der Verortung der Sozialinformatik in der Studienstruktur<br />
sowie in den Studienschwerpunkten.<br />
Ausgehend von der oben dargestellten Verbreitung der IT in den Feldern Sozialer<br />
Arbeit und den Anforderungen der Praxis sollte ein Einführungskurs in Sozialinformatik<br />
künftig fester Bestandteil des Studiums sein. Inwieweit es günstiger<br />
ist, diese Einführung im Grund- oder im Hauptstudium anzusiedeln, hängt von<br />
der konkreten Studienorganisation der jeweiligen Hochschule ab. Für das<br />
Grundstudium spricht, dass es sich um eine Einführung handelt, auf die in ei-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 14
nem Studienschwerpunkt des Hauptstudiums sowie in ausgewählten anderen<br />
Fächer aufgebaut werden kann. Für das Hauptstudium spricht, dass es den<br />
Studierenden eher möglich ist, die Inhalte der Sozialinformatik mit anderen<br />
Lehrinhalten oder eigenen Praxiserfahrungen in Beziehung zu setzen.<br />
Im Hauptstudium liegt die Einführung eines Studienschwerpunktes Sozialinformatik<br />
nahe. In einer Studienstruktur mit erstem und zweitem Schwerpunkt, wie<br />
sie derzeit etwa an der FH Neubrandenburg realisiert ist, besteht die Möglichkeit,<br />
neben einem ersten Schwerpunkt in klassischen Arbeitsfeldern wie Behindertenhilfe<br />
die Sozialinformatik als zweiten Schwerpunkt zu wählen. Die Einrichtung<br />
eines entsprechenden Schwerpunkt-Faches ist aber auch in Studiengängen<br />
mit nur einem Schwerpunkt denkbar.<br />
Völlig neue Möglichkeiten bieten sich im Rahmen der derzeit vor allem im Weiterbildungsbereich<br />
angebotenen Master-Studiengänge, künftig aber auch in<br />
konsekutiven Master-Programmen. Aus Sicht der Sozialinformatik relevant sind<br />
dabei vor allem die etwa 70 Sozialmanagement-Studiengänge im deutschsprachigen<br />
Raum (vgl. Boeßenecker 2003), die für Führungsaufgaben qualifizieren.<br />
Da management-orientiertes IT-Wissen im Rahmen eines modernen Leitungsverständnisses<br />
unverzichtbar ist, sollte die Sozialinformatik integraler Bestandteil<br />
jedes entsprechenden Studiengangs sein (vgl. auch Kohlhoff 2003).<br />
Eine weitere Option könnte darin bestehen, ähnlich wie in der Schweiz (vgl.<br />
Eugster 2002) einen eigenständigen Weiterbildungsstudiengang Sozialinformatik<br />
zu etablieren. Das Schweizer Konzept setzt sich aus den drei Modulen Informatik<br />
(vertiefte Einführung), Informations- und Wissensmanagement sowie<br />
Medienpädagogik zusammen. Hierzulande erscheint es dagegen sinnvoller,<br />
sich von der fachlichen Ebene der Medienpädagogik abzugrenzen und stattdessen<br />
die Studieninhalte auf Kenntnisse und Fähigkeiten von IT-<br />
Verantwortlichen/IT-Managern in mittleren und größeren sozialen Organisationen<br />
zu konzentrieren. Weitere Tätigkeitsfelder für Absolventen eines solchen<br />
Studienganges könnte eine (selbständige) Beratertätigkeit oder Mitarbeit in einem<br />
auf die Sozialwirtschaft ausgerichteten Systemhaus bzw. Software-<br />
Unternehmen sein.<br />
3. Curriculare Konzeption<br />
Das nachfolgende Konzept ist primär auf das grundständige Studium der Sozialen<br />
Arbeit ausgerichtet. Es orientiert sich am eingangs bereits erwähnten Nie-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 15
derländischen Sozialinformatik-Curriculum (Lieshout 1998), das vier idealtypische<br />
Phasen der Wissensvermittlung und -aneignung in der Sozialinformatik<br />
beschreibt.<br />
Dem hier vorgestellten Konzept liegt weiterhin die Überlegung zugrunde, dass<br />
die Sozialinformatik im bereits sehr breit gefächerten Themenspektrum des Sozialarbeit-Studiums<br />
nicht zu einer weiteren Aufblähung der Studieninhalte führen<br />
sollte. Deutlich sinnvoller erscheint es, wo möglich an vorhandene Ausbildungsstrukturen<br />
anzudocken und IT-Themen in diese Lehrinhalte zu integrieren.<br />
Einerseits ist heute im Berufsalltag häufig fundiertes IT-Anwenderwissen<br />
gefordert, andererseits sollen in der Grundausbildung keine berufsfremden IT-<br />
Spezialkenntnisse wie Programmierung, Datenbankmanagement oder Netzwerk-Administration<br />
vermittelt werden, die nicht zur Kernkompetenz Sozialer<br />
Arbeit zählen. Solche Kenntnisse könnten bestenfalls auf drittklassigem Niveau<br />
vermittelt werden. Sie würden darüber hinaus das noch immer fragile Berufsprofil<br />
mit Ballast aus berufsfernen Welten verwässern und damit der Professionsentwicklung<br />
Sozialer Arbeit einen Bärendienst erweisen.<br />
Soweit dem Autor bekannt, ist die IT-bezogene Ausbildung in den einschlägigen<br />
Studiengängen bislang nur selten klar strukturiert. Oftmals ist das Lehrangebot<br />
zunächst aus persönlichen Fähigkeiten und Neigungen einzelner Lehrender<br />
entstanden. Für die Studierenden ist es in solchen, eher beliebig erscheinenden<br />
Angeboten schwer, Orientierung zu finden und ihre eigene IT-Qualifikation auf<br />
Fähigkeiten, Interessen und Erfordernisse der Berufspraxis auszurichten.<br />
Daher wird hier eine Gliederung in vier grundlegende Ausbildungsbereiche vorgeschlagen,<br />
die als Bausteine flexibel in verschiedene Studiengangsstrukturen<br />
eingepasst werden können:<br />
• IT-Grundqualifikation<br />
• Berufsbezogene IT-Aufbauqualifikation<br />
• Arbeitsfeld- und aufgabenbezogener IT-Einsatz (horizontaler Aspekt der Sozialinformatik)<br />
• Sozialinformatik (vertikaler Aspekt)<br />
Als weitere Bausteine der IT-bezogenen Ausbildung können diejenigen Elemente<br />
der Medienpädagogik betrachtet werden, die sich auf computergestützte Medien<br />
beziehen. Dazu gehört etwa die Computergrafik, die Bild- und Videobear-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 16
eitung oder die Erstellung von Internet-Seiten in pädagogischen Settings. Da<br />
sich hier seit weit über einem Jahrzehnt ein eigenständiger fachlicher Diskurs<br />
mit methodisch-didaktischen Ansätzen gebildet hat (vgl. etwa Baacke 1997),<br />
erscheint es nicht sinnvoll, die Medienpädagogik unter die Sozialinformatik zu<br />
subsumieren. Dies schließt freilich enge Kooperationen in der Ausbildungspraxis<br />
keineswegs aus, wenn sich in einzelnen Themenbereichen oder Projekten<br />
Berührungspunkte ergeben.<br />
a) IT-Grundqualifikationen<br />
Da noch immer nicht alle Studienanfänger die IT-Grundqualifikationen in erforderlichem<br />
Umfang aus der Schule oder dem privaten Umfeld mitbringen, müssen<br />
die Hochschulen solche Angebote optional mindestens noch für eine gewisse<br />
Zeit vorhalten.<br />
Die IT-Grundqualifikationen umfassen insbesondere folgende Bereiche:<br />
• Windows Betriebssystem: Basisfunktionen, nutzerspezifische Desktop-<br />
Konfiguration, Programm- und Treiber-Installation, Verwaltung von Ordner<br />
und Dateien<br />
• Textverarbeitung, insbesondere für wissenschaftliches Arbeiten<br />
• Browser-Nutzung und Internet-Recherche<br />
• E-Mail-Nutzung, v.a. mit dem Mail-Client der jeweiligen Hochschule<br />
Da es hier nicht um fachbezogenes Wissen geht, kann diese Grundausbildung<br />
auch in fachbereichsübergreifenden Lehrveranstaltungen oder in Kooperation<br />
mit externen Bildungseinrichtungen vermittelt werden. Ein qualifizierter Test zu<br />
Beginn des Studiums kann von diesen Lehrveranstaltungen befreien, wenn entsprechende<br />
Kenntnisse nachgewiesen werden.<br />
b) Berufsbezogene IT-Aufbauqualifikation<br />
Diese Qualifikationsstufe ist wie die Grundqualifikation auf die Nutzung von<br />
Standardsoftware ausgerichtet. Die Lehrveranstaltungen vermitteln Kompetenzen,<br />
die auf das aktuelle Anforderungsprofil der Praxisfelder Sozialer Arbeit abgestimmt<br />
sind. Wichtige Elemente davon sind derzeit:<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 17
• Vertiefung der Textverarbeitung für typische Büro-Anwendungen: Serienbriefe,<br />
Formulare, gegliederte Konzepte, einfache Werbemedien (Flyer)<br />
• Grundlagen und spezifische Anwendungsformen der Tabellenkalkulation<br />
(z.B. Dienstplanung, Pflegesatz-Kalkulation, Fallstatistiken mit grafischer<br />
Darstellung)<br />
• Aufbau und Gestaltung von Bildschirm- und Beamer-Präsentationen (z.B.<br />
mit Microsoft Powerpoint)<br />
• IT-gestützte Team- und Projektarbeit: Terminmanagement, Kontaktdaten,<br />
Kommunikation usw. mit Organizer- und Mail-Software (z.B. Microsoft Outlook)<br />
c) Arbeitsfeld- und aufgabenbezogener IT-Einsatz<br />
Die Konzeption dieses Ausbildungsbereichs basiert auf der Tatsache, dass<br />
fachspezifische IT-Anwendungen sich mittlerweile quer über nahezu alle Arbeits-<br />
und Aufgabenfelder der Sozialen Arbeit erstrecken. So gibt es etwa hoch<br />
spezialisierte Fachprogramme für Felder wie Schuldnerberatung, Sozialpsychiatrie,<br />
Jugendämter oder Einrichtungen der Erziehungshilfe. Vieles spricht dafür,<br />
die Nutzung dieser Software und ihre fachliche Reflexion in die jeweiligen Lehrfächer<br />
zu integrieren. Gleiches gilt für arbeitsfeld-übergreifende Aufgaben von<br />
Fach- und Führungskräften, wie die Nutzung elektronischer Rechtsauskunftssysteme<br />
oder die Anwendung von Spezialsoftware für statistische Analysen.<br />
In diesen Kontexten tritt die Sozialinformatik nicht als eigenes Fach in Erscheinung,<br />
sie ist horizontal in den unterschiedlichen Lehrfächern verankert und stellt<br />
darin einen Teilaspekt der Ausbildung dar. Dies ist nicht nur didaktisch im Sinne<br />
einer praxisorientierten Wissensvermittlung sinnvoll, sondern auch praktisch<br />
notwendig, da kaum ein Sozialinformatiker die Lehrinhalte all dieser Fächer in<br />
genügender Tiefe kennen dürfte. Beispiele für eine Realisierung dieses Ansatzes<br />
wären:<br />
• Statistische Analysen mit SPSS in Lehrveranstaltungen zu sozialwissenschaftlichen<br />
Methoden und Arbeitsweisen<br />
• Software-gestützte Hilfe- und Erziehungsplanung sowie Falldokumentation<br />
in einem Methodenseminar zu erzieherischen Hilfen<br />
• Nutzung von Juris, Solex oder verschiedenen Internetquellen zu sozialrechtlichen<br />
Fragen innerhalb von Übungen zum Sozialrecht<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 18
• Erstellung von Entschuldungsplänen und Überprüfung von Kreditverträgen<br />
mit Hilfe von Fachsoftware in Schuldnerberatungs-Seminaren.<br />
d) Sozialinformatik<br />
Die Sozialinformatik als eigenständiges Fach konzentriert sich primär auf die<br />
vertikalen Aspekte, also diejenigen Themen, die über die einzelfachspezifischen<br />
Anwendungsformen der Informationstechnologie hinausreichen und gleichsam<br />
eine Klammer um sie bilden.<br />
Für einführende Lehrveranstaltung im Grund- oder Hauptstudium bieten sich<br />
folgende Themenbereiche an:<br />
• Soziale Arbeit in der Informations- und Wissensgesellschaft<br />
• Fachsoftware für Soziale Arbeit: Entwicklungslinien, grundlegender Aufbau,<br />
Funktionen und Anwendungsbereiche, ggf. verbunden mit exemplarischen<br />
Übungen<br />
• Fachspezifische Formen der Internet-Nutzung: Online-Beratung, Auskunftssysteme,<br />
Fachportale<br />
• Grundlagen von Datenschutz und IT-Sicherheit<br />
• Chancen und Risiken der IT-Nutzung in der Sozialen Arbeit<br />
Innerhalb eines Studienschwerpunktes Sozialinformatik konzentriert sich die IT-<br />
Ausbildung auf Fragestellungen an der Schnittstelle zwischen Management,<br />
Fachlichkeit und Informationstechnologie. In diesem Rahmen ist partiell die Integration<br />
spezieller IT-Kenntnisse wie Aufbau und Struktur von Datenbanken<br />
und Netzwerken sinnvoll, um Zusammenhänge begreifbar zu machen und die<br />
Sozialinformatiker zum kompetenten Dialog mit IT-Fachkräften zu befähigen.<br />
Wichtige Themen und Inhalte in diesem Kontext sind:<br />
• Grundlegende Architekturen von IT-Systemen, Netzwerken, Datenbanken,<br />
Anwenderprogrammen<br />
• Entwicklungslinien und Trends in der Informationstechnologie<br />
• Informations- und Prozessmanagement in sozialen Organisationen<br />
• IT-Strategien und Formen des IT-Managements<br />
• Definition von Anforderungen an und Mitgestaltung von IT-Lösungen<br />
• Prozesse und Methoden der Auswahl und Einführung von IT-Lösungen sowie<br />
der laufenden Anwenderunterstützung<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 19
• Praktische Übungen zum Einsatz und zur Administration von Fachsoftware<br />
• Rechtliche Rahmenbedingungen des IT-Einsatzes<br />
• Organisatorisch-technische Grundlagen von IT-Sicherheit und Datenschutz<br />
Ein tieferer Einstieg in IT-spezifische Fragen erscheint nur im Rahmen eines<br />
eigenständigen Studiengangs der Sozialinformatik sinnvoll. Neben einer ausführlicheren<br />
Behandlung der oben genannten Themen könnten dazu etwa folgende<br />
Themenbereiche gehören:<br />
• Planung und Administration verschiedener Netzwerk-Topologien<br />
• Datenbank-Administration und Abfragen mittels SQL<br />
• Erstellung von Skripten, kleinen Programmen oder Datenbank-Anwendungen<br />
mit Sprachen wie Pearl oder Visual Basic zur Füllung softwaretechnischer<br />
Lücken im Betriebsalltag<br />
• Projektierung und Steuerung von Prozessen der Software-Entwicklung<br />
4. Fazit<br />
Die Zeit scheint reif, die Sozialinformatik dauerhaft in Lehre und Forschung der<br />
Sozialen Arbeit und Sozialwirtschaft zu verankern. Zu wünschen ist, dass sich<br />
das neue Fach trotz aller Variationsbreite in der praktischen Ausgestaltung an<br />
den Kernaufgaben der Profession orientiert und so ein klar erkennbares Profil<br />
gewinnt, das seine Verbreitung und Akzeptanz in den Praxisfeldern Sozialer<br />
Arbeit fördert.<br />
Literatur<br />
Baacke, Dieter 1997: Medienpädagogik. Tübingen<br />
Boeßenecker, Karl-Heinz / Markert, Andreas 2003: Studienführer Sozialmanagement/Sozialwirtschaft<br />
an Hochschulen in Deutschland, Österreich und der<br />
Schweiz. Baden-Baden<br />
Eugster, Reto 2002: Ein Ostschweizer Weg zur Sozialinformatik? In: Sozial<br />
aktuell, Nr. 15, S. 12-14<br />
Halfar, Bernd 1997: Sozialinformatik unerläßlich. In: Blätter der Wohlfahrtspflege,<br />
Nr. 6, S. 113-114<br />
Jurgovsky, Manfred 2004: Sozioinformatik. Ein Vorschlag zur Neupositionierung<br />
der Informatik in der Sozialen Arbeit. In: Archiv für Wissenschaft und Praxis<br />
der sozialen Arbeit, Nr. 1. S. 40-48<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 20
Kirchlechner, Berndt / Kolleck, Bernd 1991: Überlegungen zur EDV-<br />
Ausbildung in den Sozialwesenfachbereichen. In: Soziale Arbeit, Nr. 1, S. 18-22<br />
Kirchlechner, Berndt 2000: Curriculum "Informatik der Sozialarbeit". In:<br />
Wendt, Wolf Rainer 2000: Sozialinformatik: Stand und Perspektiven. Baden-<br />
Baden, S. 111-134<br />
Kreidenweis, Helmut 2002: Plädoyer für eine Sozialinformatik. In: Sozial Extra,<br />
H. 7-8, 26. Jg., S. 41-43<br />
Kreidenweis, Helmut 2003: Informationstechnologie-Ressourcen durch integriertes<br />
Management besser nutzen. In: SOCIALManagement Nr. 5, S. 22-24<br />
Kreidenweis, Helmut 2004: Sozialinformatik. Baden-Baden.<br />
Kreidenweis, Helmut / Wüstendörfer, Werner 2004: Sozialinformatik. In:<br />
Kreft, D. / Mielenz, I. (Hrsg.) Wörterbuch Soziale Arbeit, 5. Auflage (im Ersch.)<br />
Kolhoff, Ludger 2003: Sozialmanager brauchen Sozialinformatik. In: SOCI-<br />
ALmanagement, Nr. 3, S. 9-11<br />
Ley, Thomas 2004: Sozialinformatik. Zur Konstitution einer neuen (Teil-)Disziplin.<br />
In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, Nr. 1. S. 3-39<br />
Lieshout, Herman van 1998: Mehr als Komputer! – Niederländische Ansätze<br />
in der EDV-Ausbildung für soziale Berufe. In: Kreidenweis, H. u.a.: EDV im Sozialwesen.<br />
Kongress-Dokumentation Cosa ´97., Freiburg 1998<br />
Ohnemüller, Bernhard 1996: Was müssen Profis künftig können? EDV-<br />
Ausbildung für die Soziale Arbeit. In: Kreidenweis, H. u.a. Hrsg.: EDV im Sozialwesen.<br />
Kongress-Dokumentation COSA ' 96. Freiburg<br />
Ostermann, Rüdiger / Trube, Achim 2002: Sozialinformatik lehren – aber<br />
wie? In: Sozialmagazin H. 7-8, 27. Jg., S. 66-71<br />
Peterander, Franz 2001: Sozioinformatik als neuer Weg in der Sozialen Arbeit.<br />
In: König, J.; Oerthel, Ch.; Puch, H.-J. (Hrsg.): Wege zur neuen Fachlichkeit.<br />
Qualitätsmanagement und Informationstechnologien. Starnberg<br />
Stempfle, Katja / Rosenkranz, Doris 2003: Der Stellenmarkt für die Soziale<br />
Arbeit. Einstellungsvoraussetzungen & Chancen. Eine empirische Analyse. In:<br />
Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit, Nr. 6, S. 52-58<br />
Visser, Albert / Lieshout, Herman van 1996: Welzijnswerk en computers.<br />
Méér dan tekstverwerken. Bussum (Niederl.)<br />
Wendt, Wolf Rainer 2000: Sozialinformatik: Stand und Perspektiven. Baden-<br />
Baden<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 21
Sozialinformatik studieren im virtuellen Seminarraum<br />
Ursula Mosebach / Hans-Jürgen Göppner<br />
Damit der Zug in die Wissens- und Informationsgesellschaft nicht ohne die Soziale<br />
Arbeit abfährt, finden an vielen Fachhochschulen Veranstaltungen in Sozialinformatik<br />
statt, an einigen ist dieses Lehrgebiet inzwischen auch hauptamtlich<br />
besetzt. Eine besondere Einheit von Form und Inhalt liegt vor, wenn Sozialinformatik<br />
im virtuellen Seminarraum studiert werden kann.<br />
Mit diesem Vorhaben steht man vor dem Problem, wie man reflektiert und<br />
sachkundig an die Sache hergehen kann, um eine „digitale Hochstapelei” („studieren<br />
per Internet ist bequemer als im Hörsaal sitzen, aber das Angebot ist<br />
dürftig” textet der UniSPIEGEL 2002) zu vermeiden.<br />
Seit Sommersemester 2004 haben StudentInnen aus Bayern die Möglichkeit,<br />
bei der virtuellen Hochschule Bayern (VHB; siehe auch http://www.vhb.org) ein<br />
virtuelles Seminar zur Sozialinformatik zu besuchen, das von den beiden Autoren/innen<br />
angeboten wird. 1 Dieses ist unseres Wissens das bisher einzige im<br />
deutschsprachigen Raum.<br />
Im Folgenden wollen wir unsere Erfahrungen von vier Semestern Online-Lehre<br />
im Sinne eines Projektberichts darstellen und unsere inhaltlichen und didaktischen<br />
Entscheidungen beschreiben, um sie diskutierbar und reflektierbar zu<br />
machen. Wir wollen damit KollegInnen bei der Entwicklung von Projekten unterstützen<br />
und die neue Form des Lernens und Lehrens für Studierende und als<br />
berufsbegleitende Fortbildung exemplarisch demonstrieren. Studierende und<br />
PraktikerInnen könnten eine Vorstellung davon bekommen, welche Inhalte mit<br />
welchen Relevanzen zu einem Basiskurs der Nutzung von Informationstechnologie<br />
(IT) in der Sozialen Arbeit gehören und was dieser Schwerpunkt für die<br />
Praxis der Sozialen Arbeit bedeuten könnte.<br />
1 In einer Projektlaufzeit von zwei Jahren wurde das Seminar in einem Team aus Hochschuldozenten/innen<br />
und Praxisvertretern/innen erstellt. Die Aktualität der Inhalte wird durch die breit<br />
gestreute fachliche Kompetenz des Projektteams im Bereich der Sozialinformatik gewährleistet:<br />
Prof. Dr. Paul Gödicke, KSFH München; Prof. Dr. Doris Rosenkranz, FH Würzburg-Schweinfurt;<br />
Prof. Helmut Kreidenweis, KI Consult Augsburg und FH Neubrandenburg; Alexander Nacke<br />
(Lernmanagementsystem und die multimediale Kursplattform); Fa. Europhin, Regensburg; Susanne<br />
Staudinger, Fa. Syntegral Abensberg; Dipl.-Soz.Päd (FH) Petra Schopp, Kids-Hotline<br />
München; Dipl.-Soz.Päd. (FH) Stephanie Bauer, KU-Eichstätt.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 22
1. Profil der virtuellen Lehrveranstaltung Sozialinformatik<br />
Grundsätzliche Fragen etwa zum Verhältnis von Informatik und Sozialer Arbeit<br />
bzw. Sozialarbeitswissenschaft, wie sie z. B. von Jurgovsky (2002, 2004) und<br />
Ley (2004) diskutiert werden (s. a. Göppner und Hämäläinen 2004, Kap. 11.6),<br />
mussten bei der Konzeptionierung vorläufig unberücksichtigt beiseite gelassen,<br />
viele Entscheidungen eher intuitiv gefällt werden. Mit Hilfe von Online-Texten,<br />
einem interaktiven Rollenspiel und Übungsbeispielen setzen sich die TeilnehmerInnen<br />
in virtuellen Arbeitsgruppen über Forum und Chat kritisch mit sechs<br />
Modulen auseinander, die im Umfang einem einsemestrigen Seminar mit zwei<br />
Semesterwochenstunden entsprechen.<br />
Sie erhalten dadurch einen Überblick über den Entwicklungsstand von Internet-<br />
Plattformen, Fachsoftware für die Soziale Arbeit, sammeln Erfahrungen in der<br />
Online-Beratung und erhalten Informationen über Datenschutz und Datensicherheit.<br />
Der virtuelle Kurs "Sozialinformatik 1" ist auf dem Kurs-Server der<br />
Fachhochschule Regensburg gespeichert und wird über die folgende Internet-<br />
Adresse angeboten: http://kurse.fh-regensburg.de/sozinfo. 2<br />
2. Lernziele und Inhalte der Module<br />
Modul 1: Basiskompetenzen für die Sozialinformatik<br />
Lernziele/Inhalte: Einführung in die Grundprinzipien des Internets und Kennen<br />
lernen von Internetdiensten, die für die Lehrveranstaltung benötigt werden.<br />
Modul 2: Informationstechnologien für die Soziale Arbeit<br />
Lernziele/Inhalte: Beschäftigung mit dem Gegenstand und den Aufgabengebieten<br />
der Sozialinformatik. Als Übung ist von der virtuellen Arbeitsgruppe ein Leserbrief<br />
zu einem Zukunftsszenario aus dem Sozialen Arbeit zu schreiben und<br />
in das Forum einzustellen.<br />
Modul 3: Internetplattformen für soziale Fragen<br />
Lernziele/Inhalte: Vermittlung von grundlegenden Informationen zum Stellenwert<br />
von Expertenplattformen innerhalb der Sozialen Arbeit am Beispiel von<br />
http://www.bayris.de Auskunfts- und Informationssystem des bayerischen Sozialmarktes.<br />
Als Übungen werden eine Anbietersuche anhand eines Fallbeispiels<br />
angeboten und die Möglichkeit als Online-RedakteurIn eine fiktive Institution im<br />
2 Alle Studenten/innen, die an einer bayerischen Hochschule immatrikuliert sind, können sich<br />
kostenlos über die virtuelle Hochschule Bayern (http://www.vhb.org) jeweils zum Semesterbeginn<br />
zum Kurs anmelden. Für andere InteressentenInnen ist der Kurs kostenpflichtig.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 23
Redaktionssystem (Content Management System) von http://www.bayris.de<br />
aufzunehmen.<br />
Modul 4: Sozialberatung im Internet<br />
Lernziele/Inhalte: Reflexion der inhaltlichen und methodischen Anforderungen<br />
an eine professionelle Sozialberatung und der Standards und Prinzipien der<br />
Online-Beratung.<br />
Als Übung wird u.a. ein virtuelles Rollenspiel im Rahmen der peer-to-peer Beratung<br />
für junge Menschen im Internet http://www.kids-hotline.de angeboten. Darin<br />
simulieren die Studierenden einen Beratungsverlauf in dem sie von Fachberatern<br />
unterstützt werden und nehmen anschließend kritisch über ein Online-<br />
Evaluationsformular dazu Stellung.<br />
Modul 5: Fachsoftware für Soziale Arbeit<br />
Lernziele/Inhalte: Überblick über die Entwicklungsgeschichte und heutigen<br />
Stand von Fachsoftware; Fähigkeit zur kritischen Bewertung und Sensibilisierung<br />
für Anforderungen einer Fachsoftware FÜR Soziale Arbeit („Wo Soziale<br />
Arbeit draufsteht, muss auch Soziale Arbeit drin sein“). Überblick über Basisfunktionen<br />
(z. B. Sortieren, Suchen), administrative Funktionen (Stammdaten-<br />
Verwaltung, Leistungserfassung, Abrechnung und Statistik), fachliche Funktionsbereiche<br />
(sozialarbeiterische Kernfunktionen: Klassifikation der klientenbezogenen<br />
Probleme, Klassifikation der „Dienstleistungen“ an Klienten (Hilfeplan),<br />
fachliche Dokumentation des Hilfeprozesses, Steuerung des Abläufe und Sicherstellung<br />
von Qualitätsstandards, Evaluation, Kontrolle der Zielerreichung).<br />
Da dieses Modul eine hohe Informationsdichte enthält, wird als Lernzielkontrolle<br />
ein Multiple-Choice-Test angeboten. Darüber hinaus werden die Studierenden<br />
aufgefordert, Fachsoftware anhand von Produktbeschreibungen im Internet zu<br />
bewerten, ob sie den Anforderungen an den Dokumentations- und Planungsbedarf<br />
in der Sozialen Arbeit genügen, ob die oben genannten Basisfunktionen,<br />
administrativen Funktionen und sozialarbeiterisch-fachlichen Kernfunktionen in<br />
den einzelnen Programmen angesprochen werden.<br />
Modul 6: Datenschutz und Datensicherheit.<br />
Lernziele/Inhalte: Einführung in den rechtlichen Hintergrund des Datenschutzes<br />
und praktische Hinweise zur Datensicherheit. Als Übung sollen anhand eines<br />
Fallbeispiels notwendige Datenschutzmaßnahmen entworfen und im Forum zur<br />
Diskussion gestellt werden.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 24
Diese Themen stellen nur einen Ausschnitt des stark im Wachstum begriffenen<br />
Fachs Sozialinformatik dar. Bei einer Weiterentwicklung der Veranstaltung wären<br />
weitere curriculare Ergänzungen denkbar: aus Kapazitätsgründen konnte<br />
z.B. die Erstellung von Websites für Sozialeinrichtungen nicht eingebaut werden,<br />
obwohl dies von Seiten der StudentInnen bei der Evaluation oft gewünscht<br />
wurde. Auch die Installation von Workflow-Systemen oder Fragen der<br />
Implementation von Programmen in den Einrichtungen (vgl. Rudlof 2005) sind<br />
denkbar und nicht zuletzt auch die kritische Reflexion der Nutzerfreundlichkeit<br />
und der Konzeptionierung von Fachsoftware für Soziale Arbeit.<br />
Da sich aufgrund technischer und inhaltlicher Neuerungen im Bereich der IT<br />
laufend Änderungen ergeben, wird eine Weiterentwicklung des Kurses im 2-<br />
jährigen Turnus notwendig sein. Die Servertechnik an den Hochschulen lässt<br />
Downloads und Installation von Software in PC-Räumen meist nicht zu. Deshalb<br />
war die ursprünglich geplante Fallarbeit mit Hilfe von Fachsoftware im Modul<br />
5 bisher nicht umsetzbar, was auch einen Einschnitt in die Interaktivität des<br />
Seminars bedeutet.<br />
3. Theoretischer Exkurs zur didaktischen Vermittlung und Betreuung<br />
Bildung mit digitalen Medien benötigt eine neue Lehrkultur und führt zu einer<br />
neuen Lernkultur (Reinmann-Rothmeier 2001, S. 297). Ein „frontaler“ Wissenstransport,<br />
bei dem Lehrende versuchen, objektive Inhalte so zu übermitteln,<br />
dass die Lernenden letztlich das gleiche Wissen haben, ist nicht mehr sinnvoll.<br />
Es geht also nicht nur um Entscheidungen über Inhalte (Kreidenweis 2004, Ostermann<br />
/ Trube 2002, Wendt 2000).<br />
Auf die Diskussion zu den theoretischen Grundlagen können wir hier nicht eingehen<br />
(vgl. Röll 2003, Schindler u. a. 2001, Reinmann-Rothmeier 2001, 2003,<br />
Reinmann-Rothmeier / Mandl 2001), wir versuchen lediglich die von uns getroffenen<br />
didaktischen Entscheidungen in den als relevant erachteten Punkten zu<br />
beschreiben, um sie nachvollziehbar und reflektierbar zu machen.<br />
Röll (2001, S. 298 - im Anschluss an Bauer/Philippi) formuliert vier notwendige<br />
Komponenten, um von E-Learning sprechen zu können:<br />
• Multimedia-Technik: Verknüpfung multimedialer Techniken (Text, Fotografie,<br />
Simulation, Animation, Video) mit Ansprechen multimodaler<br />
Rezeptoren (auditive, visuelle, kognitive).<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 25
• Autonomes und interaktives Lernen: gutes E-Learning ermöglicht<br />
nicht nur Selbstbestimmung des zeitlichen Ablaufes, sondern fördert<br />
aktive und explorative Lernformen. Es bietet sich auch an, die Kommunikations-Technologien<br />
für kooperative Lernformen zu nutzen<br />
(kommunikatives Lernen in einer vernetzten Lerngemeinschaft).<br />
• Tutoring: Anleiten und Begleiten beim Erwerb von Wissen.<br />
• Nutzung von Datennetzen: die Organisation von Seminaren erfolgt<br />
über Netzkommunikation (E-Mails, Newsgroups, Chatrooms, virtuelle<br />
Klassenräume).<br />
Einen interessanten Weg, die Qualität von E-Learning aus Lernersicht zu<br />
bestimmen, beschreitet Ehlers (übrigens in deutlicher Abhebung von der üblichen<br />
Übernahme von QS-Konzepten aus dem gewerblichen Bereich). Er<br />
kommt zu Dimensionen im Modell subjektiver Qualität (Ehlers 2004, S.<br />
239f), die als empirisch gesicherte Vermittlungsgrundlagen von virtuellen<br />
Seminaren verwendet werden können:<br />
• Tutorieller Support: Interaktionsorientierung, Lernmoderation, individualisierte<br />
Lernerunterstützung, Lernziel- und Entwicklungsorientierung,<br />
• Kooperation und Kommunikation: soziale und diskursive Kooperation,<br />
• Lerntechnologie: Personalisierung und nutzerangepasste Bedienungsmöglichkeit,<br />
synchrone Kommunikationsmöglichkeiten, technische<br />
Verfügbarkeit der Inhalte,<br />
• Kosten - Erwartungen - Nutzen: Orientierung an individuellen Lernbedürfnissen,<br />
Praxistransfererwartungen, Interesse am Internet und an<br />
Wissenserwerbsstrategien,<br />
• Informationstransparenz bei Angebot und Anbieter: Beratung zu<br />
Kursbeginn, Kursauswahl, Lernmethoden, Transparenz der Ziele und<br />
Inhalte, anbieterbezogene Informationen (Tutorqualifikation, Erfahrungsberichte<br />
u. ä.),<br />
• Kursverlauf/Präsenzveranstaltungen: kursbegleitende interpersonale<br />
Unterstützung des Lernprozesses (reale Aushandlungsprozesse),<br />
thematisch-inhaltliche und technische Einführung, Vermittlung rezeptiv-anwendender<br />
und instrumentell-qualifikatorischer Kompetenzen,<br />
• Didaktik: inhaltliche Gestaltung des Kursmaterials, mediengerechte<br />
multimediale Materialaufbereitung, strukturiertes und lernzielorientier-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 26
tes Kursmaterial, Rückkoppelung des Lernens (Tests und Übungsaufgaben,<br />
Feedback).<br />
Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Effektivität des E-Learning stieß<br />
man auf die Rolle der emotionalen Kommunikation (Schachtner 2001) und der<br />
Gruppenprozesse. „Lost in Cyberspace“ zu sein, erweist sich als wenig animierend<br />
und blockierend für selbstgesteuertes Lernen. Das Fehlen nonverbaler<br />
Kommunikation und sozialer Kontexthinweise und die damit verbundene Verringerung<br />
der sozialen Präsenz in Online-Lernsituationen bewirkt, dass nicht<br />
automatisch begünstigende Lernpotentiale erschlossen werden. Es muss auf<br />
andere Weise als im Alltag zu einer positiven Kommunikation kommen, um sich<br />
verstanden zu fühlen, für die kooperative Verfolgung von Lernzielen motiviert zu<br />
sein und in virtuellen Lerngemeinschaften zu profitieren.<br />
Neuere Forschungen setzen daher auf die Form des „Blended Learning“ (vermischtes<br />
Lernen) (vgl. u.a. Reinmann-Rothmeier 2003; Buchegger 2004, Röll<br />
2003, Ehlers 2004). Darunter ist ein Methodenmix aus Präsenzschulungen und<br />
E-Learning zu verstehen.<br />
4. Didaktische Umsetzung<br />
Ein wichtiges Element und auch die Chance in der Didaktik virtueller Lehrveranstaltungen<br />
ist die Interaktivität. „Von Online-Lernen kann nicht die Rede sein,<br />
wenn lediglich der Lerninhalt elektronisch zur Verfügung steht. Online-Lernen<br />
erfordert Aktion, Interaktion, Reflexion und Anwendung.“ (Baltes, 2001, S. 116).<br />
StudentInnen sollen demnach nicht nur wie in einem Buch eindimensional Texte<br />
am Bildschirm lesen, sondern auch die Möglichkeit zum Dialog im IT-System<br />
mit den DozentInnen, KommilitonInnen und Fachleuten aus der Sozialen Arbeit<br />
haben. Über die Teilnahme an dieser Lehrveranstaltung erleben sie ein praktisches<br />
Beispiel vernetzten Arbeitens. Dafür stehen verschiedene technische<br />
Möglichkeiten der synchronen (z.B. Chat, Video-Konferenz) und asynchronen<br />
(z.B. Forum, E-Mail, Recherche in Expertenplattformen) Kommunikation zur<br />
Verfügung.<br />
In diesem virtuellen Seminar wurde bewusst Wert auf eine übersichtliche und<br />
einfache Steuerung gelegt. Das bedeutet Verzicht auf umfangreiche Downloads<br />
(Software, Animationen usw.), da den Kursteilnehmern/innen dafür oft die notwendige<br />
Hardware- und Softwareausstattung fehlt. Bisher wird nur in einem<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 27
Modul (4) synchrone Kommunikation über einen Chat angeboten, ansonsten<br />
nur asynchrone Kommunikation über ein Forum und E-Mail.<br />
Alle TeilnehmerInnen stellen sich nach ihrer erfolgreichen Anmeldung bei der<br />
VHB und dem Erhalt eines Begrüßungs-Emails auf der TeilnehmerInnen-Seite<br />
mit einem Foto (virtuelles Klassenzimmer) und im Forum mit einem kurzen Text<br />
zu ihren Seminarerwartungen vor. Um die Motivation der StudentInnen zu steigern<br />
und zu garantieren, dass die Quote der erfolgreichen Abschlüsse möglichst<br />
hoch ist, wird für jedes Semester ein Zeitplan zur Abarbeitung der Module<br />
erstellt. Außerdem erhalten die TeilnehmerInnen als Lernzielkontrolle bei den<br />
virtuellen Arbeitsgruppen und für die Erledigung von Übungsaufgaben Smilies,<br />
die auf der TeilnehmerInnen-Seite veröffentlicht werden.<br />
Zum Schutz der StudentInnen ist das Seminar nur über ein Passwort zugänglich.<br />
Um künftigen StudentInnen jedoch einen Einblick zu gewähren, ist das<br />
Einführungsmodul offen zugänglich. Die Texte stehen zusätzliche als Skript<br />
zum Download zur Verfügung.<br />
Jedes Modul enthält interaktive Übungsaufgaben, die teilweise in virtuellen Arbeitsgruppen,<br />
teilweise als Multiple-Choice-Test gelöst werden müssen. Die<br />
virtuellen Arbeitsgruppen werden nach Anmeldeschluss durch die DozentInnen<br />
zusammengestellt (pro Gruppe ca. 4-5 StudentInnen). Jede Gruppe wählt eine/n<br />
Gruppensprecher/in, der/die dafür verantwortlich ist, dass die Gruppenaufgabe<br />
termingerecht in die Newsgroup eingestellt wird. Diese kooperative Lernstruktur<br />
wurde bewusst gewählt, um die Teamfähigkeit, der TeilnehmerInnen zu<br />
erhöhen, die auch beim Arbeiten in vernetzten Systemen erforderlich ist (Aufgaben<br />
verteilen, Kompromisse eingehen, ggf. Konflikte regeln und sich auf ein<br />
Ergebnis einigen) (vgl. Baltes, 2001, S.72 f). Über die Präsentation im Forum<br />
können die TeilnehmerInnen zeit- und ortsunabhängig ihre Lernergebnisse vergleichen<br />
und sich gegenseitig Feedback geben.<br />
Nach Abschluss jedes Moduls erhält die Arbeitsgruppe bzw. die Studierenden<br />
individuell ein Feedback per E-Mail oder im Forum durch die Dozenten. Die weitere<br />
fachliche Betreuung und der technische Support erfolgt über individuelle E-<br />
Mails. Die Studierenden werden darauf hingewiesen, den Kurszeitplan im Interesse<br />
einer erfolgreichen Gruppenarbeit unbedingt einzuhalten.<br />
Präsenzveranstaltungen finden teilweise zu Beginn statt, um technische Fragen<br />
des Anmeldeverfahrens und der Handhabung der Kursplattform zu klären.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 28
Ein virtuelles Rollenspiel zum Thema Peer-Beratung (incl. Chat) wird im Rahmen<br />
des Moduls 4 im Beratungsforum von "Kids Hotline" (http://www.kidshotline.de)<br />
angeboten.<br />
Im Modul 3 wird die Interaktivität dadurch erhöht, dass die TeilnehmerInnen<br />
sich probeweise als Online-Redakteure in der Internetplattform für Soziale Fragen<br />
(http://www.bayris.de) betätigen können.<br />
Die Betreuungsarbeit für die KursTeilnehmerInnen gestaltet sich insbesondere<br />
zu Beginn des Kurses sehr zeitintensiv, da sehr viele technische Fragen zu klären<br />
sind und die Übungsantworten in allen Modulen individuell beantwortet werden<br />
(geschätzter Zeitaufwand ca. 30 Minuten pro Teilnehmer/in/Woche). Dieser<br />
hohe Zeitaufwand ist nur durch die Betreuung der beiden Autoren und durch die<br />
Unterstützung der TutorInnen zu leisten.<br />
5. Erste Erfahrungen und Evaluationsergebnisse<br />
Im WS 03/04 fand ein Pilotkurs mit Studenten aus Eichstätt und Benediktbeuern<br />
statt, aufgrund der Evaluationsergebnisse in einigen Teilen wurden Verbesserungen<br />
vorgenommen (z.B. Anzahl der Übungen und Rückmeldung zu den Ü-<br />
bungen, Einführung einer Teilnehmerbeschränkung auf 25 pro Semester).<br />
Bisher haben ca. 70 StudentInnen von fast allen Hochschulstandorten in Bayern<br />
die Lehrveranstaltung besucht (gleichmäßige Verteilung auf Semester 1-8).<br />
Ca. 50 Prozent konnten ein Leistungsnachweis (aufgrund einer Klausur) ausgestellt<br />
werden. Die Quote der KursabbrecherInnen ist damit im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen<br />
als relativ hoch einzustufen. Die Gründe dafür sind schwer<br />
zu ermitteln, da sich diese TeilnehmerInnen in der Regel auch nicht mehr an<br />
der Online-Evaluation am Kursende beteiligen. TeilnehmerInnen die sich „unterwegs“<br />
abmelden, nennen als Grund meist zeitliche Belastung oder technische<br />
Probleme mit dem eigenen Computer.<br />
Hinsichtlich der Kursbewertung waren bei den Teilnehmern/innen, die den Kurs<br />
bis zu Ende besuchten, keine großen Abweichungen festzustellen. Die Evaluation<br />
der bisherigen Lerngruppen hat ergeben, dass die TeilnehmerInnen kaum<br />
technische Probleme mit dem Lernmanagementsystem hatten. Dem kam zugute,<br />
dass der Kursserver stabil läuft und es während des letzten Jahres zu keinem<br />
Ausfall kam. Der Zeitplan, Umfang der Lerninhalte und Übungen und das<br />
Anspruchsniveau wurden im Wesentlichen als angemessen bewertet, ca. ein<br />
Viertel der StudentInnen würde sich eine Reduzierung wünschen. Der durch-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 29
schnittliche Lernaufwand wird mit ein bis zwei Stunden pro Woche angegeben.<br />
Die Beschäftigung mit weiterführender Literatur und Links über das Seminarangebot<br />
hinaus wurde in jedem Semester nur von einem Student angegeben.<br />
Als sehr sinnvoll für die Motivation der StudentInnen erwies sich das Bonussystem<br />
(Smilies) für die erfolgreiche Erledigung der Übungen. Auch die Aufforderung,<br />
sich nach erfolgreicher Anmeldung in der Newsgroup vorzustellen und<br />
sich in den virtuellen Arbeitsgruppen bekannt zu machen, führte zu einer Steigerung<br />
der Kommunikation über dieses Medium.<br />
Fast alle Student/innen waren sich einig, dass diese Form des selbstgesteuerten<br />
Lernens ihrem persönlichen Lernstil entgegen kommt. Als Gründe werden<br />
hierfür genannt: „flexible Zeiteinteilung - wobei der Zeitplan schon sehr sinnvoll<br />
war - weil man sonst sehr schnell vergisst, wieder was zu tun“, „freie Zeiteinteilung<br />
und autonomes Arbeiten zu Hause“, „Zeit, mein Kind nebenbei zu betreuen“,<br />
„keine Abhängigkeit von Mitstudenten (außer in der Arbeitgruppe)“, „ich<br />
habe keine Fahrkosten zum Präsenzort“, „ist neben Beruf machbar“.<br />
Bedauert wurde, dass kein eigener Chatroom zur Verfügung steht. Die StudentInnen<br />
haben allerdings Möglichkeit eines einmalig moderierten Chats über<br />
Kids-Hotline zur Vorbereitung des virtuellen Rollenspiels im Modul 4 Onlineberatung.<br />
Der Lernerfolg dieser Übung wurde von den StudentInnen am höchsten bewertet.<br />
Auch die Nachhaltigkeit der Texte und Kommentare im Forum wurde begrüßt.<br />
Als Nachteile der virtuellen Veranstaltung gegenüber der Präsenzlehre nennen<br />
die StudentInnen folgende Gründe: „Es ist umständlicher Verständnisfragen zu<br />
stellen, bzw. kommen die Antworten verzögert und sind vielleicht schon nicht<br />
mehr wichtig“, „es war im Gegensatz zu Präsenzveranstaltungen ein hoher<br />
Mehraufwand für mein Empfinden“, „ich empfand es auch als schwierig immer<br />
vor dem PC zu hocken und zu studieren“, „Nachfragen sind schwieriger - weil<br />
nicht unmittelbar zum Lehrstoff nachgefragt werden kann (in Vergleich zu<br />
Präsenzlehre) - auch vermisse ich Kontakt (zwischenmenschlich) zu<br />
Mitstudenten, um sich über Inhalte noch intensiver auszutauschen“, „hoher<br />
Selbstständigkeitsgrad - von Vorteil aber kann auch schnell von Nachteil sein -<br />
daher war Idee mit Zeitplanung und Erinnerungsemails eine sehr gute<br />
Einrichtung“.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 30
Die größten Probleme entstanden dadurch, dass sich nicht alle StudentInnen<br />
mit gleichem Aufwand an den Übungen der virtuellen Arbeitsgruppen beteiligten<br />
und somit bei den Aktiven der Eindruck entstand, dass sich einige KommilitonInnen<br />
auf ihre Kosten durch das Seminar „mogeln“.<br />
Erstaunlicherweise haben alle StudentInnen auf die Frage, ob sie diese Veranstaltung<br />
weiterempfehlen würde mit „ja“ geantwortet. Dafür werden eine Reihe<br />
von Gründen genannt: „man lernt etwas, verliert die Berührungsängste vor PCs,<br />
man ist nicht an strenge Termine gebunden“, „es ist eine Veranstaltung, die ich<br />
für die Soziale Arbeit sehr wichtig erachte - denn in Zukunft wird es genau um<br />
diese Fragen und Probleme gehen und ich finde es gut, dafür gerüstet zu sein.“<br />
6. Qualitätsanspruch und Ausblicke<br />
Abschließend erfolgt eine Bewertung des Kursangebots unter Berücksichtigung<br />
der von Ehlers formulierten Qualitätsdimensionen (s.o.) und es werden Überlegungen<br />
zur konzeptionellen Weiterentwicklung formuliert.<br />
Es scheint kaum vorstellbar zu sein, ein komplettes Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik<br />
nur online anzubieten. Untersuchungen haben ergeben,<br />
dass E-Learning-Angebote besonders dann erfolgreich sind, wenn sie in ein<br />
Lernarrangement eingebunden sind, welches neben virtuellen Elementen, auch<br />
konventionelle Präsenz-Lernformen umfasst (vgl. Ehlers 2004). Dies entspricht<br />
auch dem Wunsch der TeilnehmerInnen der Veranstaltung Sozialinformatik<br />
nach mehr sozialen Kooperationsformen (a.a.O., S.239 f). Umzusetzen wäre<br />
dieser Bedarf z.B. durch die Etablierung von hochschulinternen studentischen<br />
Arbeitsgruppen, die sich 2-3 mal im Semester zum Erfahrungsaustausch treffen,<br />
mit oder ohne tutorieller Unterstützung (Kostenfrage!). Synchrone Kommunikation<br />
in Form von regelmäßigen Chats werden von den StudentInnen zwar<br />
oft gewünscht. Erfahrungen zeigen aber, dass diese aus terminlichen Gründen<br />
und/oder technischen Hürden dann doch nur von einem Teil der Lerngruppe<br />
genutzt werden (s. Probleme beim Chat im virtuellen Rollenspiel, Modul 4). Zur<br />
Lernziel- und Lernfortschrittskontrolle dient bisher ein Bonussystem (Smilies).<br />
Farbliche Kennzeichnung und die Einrichtung eines „persönlichen Arbeitsplatzes“<br />
zur Ablage von Notizen und Kommentaren auf der Lernplattform könnten<br />
hier noch unterstützend wirken. Foren werden nur dann genutzt, wenn sie thematisch<br />
gut strukturiert sind und die Diskussion dort über die Übungsaufgaben<br />
gefordert wird. Auch in virtuellen Seminaren dürfen gruppendynamische Pro-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 31
zesse nicht unterschätzt werden. Die TeilnehmerInnen übernehmen die selben<br />
Rollen, wie in Präsenzarbeitsgruppen (Sprecherrolle, Lernpartnerschaften, MitläuferInnen,<br />
„MoglerInnen“). Zu Beginn des Kurses war die Arbeit in den virtuellen<br />
Arbeitsgruppen bisher durch hohe Motivation (z.B. ausführliche und pünktliche<br />
Arbeitsergebnisse im Forum) geprägt. Im Verlauf des Kurses entstanden in<br />
einigen Gruppen Konflikte durch unzuverlässige TeilnehmerInnen. Zwei Gruppen<br />
lösten sich deshalb auf, da kein Interesse an einer Kooperation mehr bestand<br />
(die Lernautonomie der anderen StudentInnen wird zu stark eingeschränkt,<br />
wenn sie auf die Rückmeldung von Kommilitonen/innen zu lange warten<br />
müssen). Hier bedarf es offensichtlich der Einführung konkreterer Spielregeln.<br />
Eine offene Frage ist die Bewältigung der sozial-emotionalen Seite der<br />
Gruppendynamik, ein Ausbau von Präsenzveranstaltungen ist nicht ohne weiteres<br />
realisierbar, da die Anfahrten sehr aufwendig würden. Ergänzt könnte die<br />
Kursdidaktik noch durch die Entwicklung von problemorientierten Aufgaben<br />
werden, anhand derer Fachsoftware für die Soziale Arbeit hinsichtlich ihrer Praxisrelevanz<br />
überprüft werden kann. Interessant erscheint auch die Selbsteinschätzung<br />
der TeilnehmerInnen zu sein, dass der Besuch der virtuellen Lehrveranstaltung<br />
nicht nur ein inhaltlicher Gewinn zum Thema Sozialinformatik ist,<br />
sondern grundsätzlich die eigene Medienkompetenz fördert, die sowohl die kritische<br />
Reflexion der Informationstechnologie in Bezug zur Sozialen Arbeit, wie<br />
auch die sinnvolle Nutzung und Handhabung der Technik umfasst.<br />
Literatur<br />
Baltes, B. (2001): Online-Lernen, Schwangau: Huber<br />
Buchegger, B. (2004): Jugendliche, Pädagogen/innen und Lehrer/innen lernen<br />
verschieden - Zielgruppenspezifische Konsequenzen beim Online-Lernen, in:<br />
Schindler, Bildung und Lernen online, München: Kopäd, S. 183-193<br />
Ehlers, U.-D. (2004): Qualität im E-Learning aus Lernersicht. Grundlagen, Empirie<br />
und Modellkonzeption subjektiver Qualität. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften<br />
Eugster, R. (2002): Wissenswertes Wissen?<br />
http://www.sonews.ch/Download/wissensmanagement.pdf (Stand: 10. 09. 02)<br />
Göppner H.-J. und Hämäläinen, J. (2004): Die Debatte um Sozialarbeitswissenschaft.<br />
Auf der Suche nach Elementen für eine Programmatik. Freiburg/Br.:<br />
Lambertus-Verlag<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 32
Gierke, Ch., Schlieszeit, J. und Windschiegel H. (2003): Vom Trainer zum E-<br />
Trainer, Offenbach: Gabal<br />
Jurgovsky, M. (2002): Was ist Sozialinformatik“ In: Neue Praxis, 3, S. 297 –<br />
303<br />
Jurgovsky, M. (2004): Sozialinformatik, Ein Vorschlag zur Neupositionierung<br />
der Informatik in der Sozialen Arbeit. In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der<br />
sozialen Arbeit. 36, 1, S. 40 - 49<br />
Kreidenweis, H. (2004): Sozialinformatik. Baden-Baden: Nomos<br />
Ley, T. (2004): Sozialinformatik. Zur Konstituierung einer neuen (Teil-) Disziplin.<br />
In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit. 36, 1, S. 3 - 39<br />
Otto, H.-U., Kutscher, Nadia (2004): Informelle Bildung Online, Perspektiven<br />
für Bildung, Jugendarbeit und Medienpädagogik, Weinheim u. München: Juventa<br />
Ostermann, R. und Trube, A. (2002): Sozialinformatik lehren – aber wie? Ein<br />
Lehrkonzept zum niedrigschwelligen Einstieg für den Einsatz von EDV in der<br />
Sozialen Arbeit. In: Sozialmagazin, 7-8, S. 66 – 71<br />
Poseck, O., (Hrsg.) (2001): Sozialarbeit Online, Neuwied, Kriftel: Luchterhand<br />
Röll, F. J. (2003): Pädagogik der Navigation. Selbstgesteuertes Lernen durch<br />
Neue Medien. München: kopaed<br />
Rudlof, C. (2006): Benutzerzentrierte Anforderungsanalyse als Bestandteil der<br />
Sozialinformatik. In diesem Band<br />
Schachtner, C. (2001): Netfeelings. Das Emotionale in der computergestützten<br />
Kommunikation. In: Schindler, W. u. a. (Hrg.), S. 301 – 317<br />
Schindler, W., Bader, R. und Eckmann, B. (Hrsg.) (2001): Bildung in virtuellen<br />
Welten. Praxis und Theorie außerschulischer Bildung mit Internet und Computer.<br />
Frankfurt/M.: Gemeinschaftswerk der Evang. Publizistik, Abt. Verl.,<br />
Reinmann-Rothmeier, G. (2001): Bildung mit digitalen Medien. Möglichkeiten<br />
und Grenzen für Lehren und Lernen. In : Schindler, W. u. a. (Hrg.), S. 275 – 300<br />
Reinmann-Rothmeier, G. und Mandl, H. (2001): Virtuelle Seminare in Hochschule<br />
und Weiterbildung. Drei Beispiele aus der Praxis. Bern: Huber<br />
Reinmann-Rothmeier, G. (2003): Didaktische Innovation durch Blended Learning,<br />
Bern: Huber<br />
Wendt, W.R., (2000): Sozialinformatik. Stand und Perspektiven, Baden-Baden:<br />
Nomos<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 33
Benutzerzentrierte Anforderungsanalyse als Bestandteil der<br />
Sozialinformatik<br />
Christiane Rudlof<br />
1. Einleitung<br />
In der Sozialwirtschaft werden in den nächsten Jahren IT-Lösungen zu einem<br />
unverzichtbaren Faktor für Effizienz und Output der sozialen Einrichtungen<br />
werden, sei es im innerbetrieblichen Einsatz oder bei der Vernetzung von Organisationen.<br />
Damit ändert sich auch die Positionierung der Informations- und Kommunikationstechnik<br />
in diesen Organisationen. Wurden EDV, besser IT Aspekte bisher<br />
vorwiegend als rein infrastrukturelle Arbeiten gesehen, wird sich dieser Bereich<br />
in die Verantwortung des Managements verlagern müssen. Es geht um die<br />
aufgabenangemessene Technik-Unterstützung der zu erbringenden Dienstleistungsprozesse<br />
und deren ständige Verbesserung bzw. Ausrichtung an den<br />
Klientenbedürfnissen.<br />
IT-Verantwortliche in Sozialeinrichtungen werden den Technikeinsatz gezielt<br />
planen, geeignete Systeme auswählen und einführen und pflegen, interne Anwenderunterstützung<br />
leisten oder Mitarbeiter in der Software-Anwendung zu<br />
schulen.<br />
Dies bedeutet für ein Curriculum der Sozialinformatik das die Studenten Grundkenntnisse<br />
des Software-Entwicklungs- und Einführungsprozesses kennen lernen<br />
sollten. Des Weiteren sollte der Zusammenhang zwischen Organisationsentwicklung<br />
und Technikeinsatz belegt werden können und einige rechtliche<br />
Besonderheiten beim Kauf von Hard- und Software vermittelt werden.<br />
2. Wie gut kenne ich mein Unternehmen, oder was kommt vor der Software?<br />
Beim IT-Einsatz im Bereich Sozialer Arbeit und deren Management sollte immer<br />
mit der Priorität "Organisation vor Technik" gehandelt werden. Dies bedeutet<br />
dass man die zugrunde liegenden Prozesse der eigenen Dienstleistungsangebote<br />
ebenso kennen muss, wie es eine abgestimmte Organisation der Aufbauund<br />
der Ablauforganisation geben muss.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 34
Erst wenn eine Prozessausrichtung der Organisation gegeben ist, kann eine<br />
sinnvolle Entscheidung über die Unterstützung durch Informations- und Kommunikationstechnik<br />
getroffen werden. Technikeinsatz ist kein Selbstzweck,<br />
sondern erfordert eine sorgfältige fachliche Anforderungsermittlung. Anderenfalls<br />
muss sich ggfs. die Organisation der neuen Technik anpassen, mit der<br />
Folge dass sich vermutlich die Arbeitskosten durch „work arounds“ erhöhen.<br />
Die Planung einer Technikunterstützung kann auch katalysatorische Wirkung<br />
haben, in dem Sinne das überholte eingefahrene Abläufe hinterfragt und neu<br />
modelliert werden können.<br />
3. Wie wird Software entwickelt?<br />
Man kann Software-Lösungen nach verschiedenen Handlungsfeldern, wie Altenarbeit,<br />
Arbeitsförderung, Behindertenarbeit, Gesundheitsförderung/ Prävention,<br />
Kinder-/Jugendarbeit und Sozialberatung kategorisieren.<br />
Eine weitere Kategorisierung kann nach Fachsoftware, fachspezifische Internet-<br />
Anwendungen oder Management-Informationssysteme getroffen werden.<br />
Eine weitere Kategorisierung kann nach so genannter Standardsoftware oder<br />
Individualsoftware getroffen werden.<br />
Mindestens sind auch in Organisationen der Sozialwirtschaft die Softwarearten<br />
Betriebssysteme, Datenbanken, Fachanwendungen, Standardbürokommunikationssoftware<br />
(MS Office) usw. zu unterscheiden.<br />
Über diese Unterschiede müssen im Bereich der Sozialinformatik Grundkenntnisse<br />
vermittelt werden.<br />
3.1 Software-Entwicklungsvorgehensmodelle<br />
Unabhängig davon, um welche Art von Software es sich handelt, ist der „weichen<br />
Ware“ (Software) immanent, dass sie sich in ständiger Veränderung befindet.<br />
Ob es sich um eine neue Version einer Standardsoftware handelt oder<br />
um die permanente Pflege oder Wartung einer laufenden Software. Dies bedeutet,<br />
das es auch einen ständigen Abgleich der Softwarefunktionen mit den sich<br />
verändernden Prozessen der Dienstleistungserstellung geben muss. Und dieses<br />
ist Leitungsaufgabe.<br />
Grundsätzlich wird bei der Entwicklung von Software in Phasen wie Analyse,<br />
Entwurf, Programmierung, Test und Einführung unterschieden, wobei die Abgrenzung<br />
zwischen den einzelnen Phasen nicht fix ist. Zieht man zusätzlich in<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 35
Erwägung das in Organisationen verschiedene Releasestände zu pflegen sind,<br />
ist deutlich das auch hierüber Grundkenntnisse vorhanden sein sollten.<br />
3.2 Die Rolle der Analyse<br />
Jeder Software -Nutzung geht eine Anforderungsanalyse voraus. Dieses ist die<br />
Phase der engen Zusammenarbeit zwischen Fach- und IT-Personal. Hierbei<br />
muss klar sein, das es um einen Abgleich der verschiedenen Sichten auf die<br />
Organisation geht. Die Sicht des Klienten, die Sicht der Verwaltung, die Sicht<br />
der Sozialarbeiter, die Sicht der Leitung. Jeder dieser Gruppen hat eine etwas<br />
andere Sichtweise auf die Organisation und deren Abläufe. Diese müssen für<br />
die Softwaresystemgestaltung in Übereinstimmung gebracht werden. Dies kann<br />
nur durch Beteiligung der Betroffenen, durch ergebnisorientierte Arbeitsweise,<br />
Visualisierung der Ergebnisse und iterative Softwareentwicklung erreicht werden.<br />
Außerdem geht es in dieser Phase um die Analyse des IST-Zustandes und die<br />
Erarbeitung eines Soll-Konzeptes, will man nicht alte, überholte Abläufe in<br />
Software zementieren.<br />
Hier kann die Systementwicklung durchaus katalysatorische Wirkung auf Organisationsentwicklung<br />
haben.<br />
3.3 Benutzungsqualität und Barrierefreiheit<br />
Im Rahmen des Arbeitsschutzes in Deutschland fordert die Bildschirmarbeitsverordnung,<br />
das beim Erwerb, der Auswahl, der Neuanschaffung, der Entwicklung,<br />
und der Änderung von Software sowie bei der Gestaltung der Tätigkeit an<br />
Bildschirmgeräten ergonomische Mindestkriterien erfüllt sein müssen. Ergonomische<br />
Qualität von Software wird definiert, als das Maß in dem die effektive,<br />
effiziente und zufrieden stellende Nutzung eines Softwareprodukts gemäß den<br />
Erfordernissen des Nutzungskontextes gewährleistet ist. Dabei ist offensichtlich,<br />
dass man konkretisiert haben muss, was man als Softwarequalität erwartet.<br />
Im Bereich Sozialinformatik sollten deshalb Grundzüge der benutzerzentrierten<br />
Software-Entwicklung (also der Weg hin zu einem guten Produkt) vermittelt<br />
werden.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 36
Für die Sozialwirtschaft nicht zu ignorieren sind die Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes<br />
(BGG), die in der ISO 16071 (Richtlinien für Barrierefreiheit<br />
an Mensch-Rechner-Schnittstellen) konkretisiert sind.<br />
Es handelt sich um Konzepte, die einen universellen Zugang zu Informationsund<br />
Kommunikationstechnologien, insbesondere für Benutzer mit spezifischen<br />
Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellen.<br />
Dies sind Benutzer mit permanenten und temporären physischen, sensorischen<br />
und kognitiven Beeinträchtigungen. Des Weiteren Benutzer die mit mobilen<br />
oder technologisch eingeschränkten Geräten, z. B. ohne Maus oder Keyboard,<br />
mit begrenzten Übertragungsraten, nicht aktuellen Browser Versionen, kleinen<br />
Displays oder nur alphanumerischen Anzeigemöglichkeiten, auf Informationen<br />
zugreifen möchten. Und schließlich Benutzer die keine oder nur eingeschränkte<br />
Kenntnisse der Sprache haben, in der der Content in einem System bereitgestellt<br />
wird. Es sollen keine programmiertechnischen Feinheiten vermittelt<br />
werden, sondern das konzeptionelle Herangehen an diese besondere Form der<br />
Schnittstellengestaltung.<br />
4. Wie wird Software eingeführt?<br />
Je nach Größe einer Organisation bzw. des Projektes sollte eine neue Software<br />
sofort an einem Tag an allen Arbeitsplätzen eingeführt werden oder z.B.<br />
erst an 2-3 Pilotarbeitsplätzen, um dort den Echteinsatz zu prüfen.<br />
Bevor Software zum Echteinsatz kommt müssen systematische Tests nicht nur<br />
der Funktionalität erfolgt sein. Dieses ist eine Aufgabe des Projektmanagements<br />
für die Softwareentwicklung.<br />
Darüber hinaus sind eine Reihe von weiteren Aspekten zu berücksichtigen:<br />
Wie und wann erfolgt die Ablösung eines eventuellen Altsystems, wie wird die<br />
Unterstützung für Einarbeitungsprobleme (nicht zu verwechseln mit überdauernden<br />
Nutzungsproblemen) gewährleistet. Schulungen sind zeitnah zur Einführung<br />
durchzuführen, dies alles ist in der Regel während des normalen Tagesgeschäfts<br />
zu organisieren.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 37
5. Wie wird Software weiterentwickelt?<br />
Nach allgemeiner Erfahrung liegen die Wartungs- und Nutzungskosten einer<br />
Software während des Produktivbetriebes weit höher als die Anschaffungskosten.<br />
Deshalb ist ab Inbetriebnahme einer Software ein Prozess zu organisieren<br />
und eine verantwortliche Person zu benennen, die sich um die Weiterentwicklung<br />
der Software kümmert.<br />
Ein derartiges Änderungsmanagement dient dazu Veränderungen der Anforderung<br />
wie auch Fehlermeldungen zu managen. Dies bedeutet im Einzelnen, das<br />
die Änderungsanforderungen gesammelt, beschrieben, verifiziert (ggf. verworfen),<br />
kategorisiert (Fehler, Mangel, Änderung), bewertet (Aufwand, Kosten, Nutzen<br />
der resultierenden Maßnahmen), priorisiert und gegebenenfalls umgesetzt<br />
werden.<br />
Da eine Veränderung der Arbeitsprozesse eine Veränderung der Software zur<br />
Folge haben kann, sind diese Aktivitäten in ggfs. vorhandene Qualitätskonzepten,<br />
wie Balanced Scorecard oder EFQM zu integrieren.<br />
6. Rechtliche Grundlagen<br />
Ausgehend davon, das in Organisationen der Sozialwirtschaft keine hauptamtlichen<br />
Juristen bei der Vertragsgestaltung in Bezug auf IT-Einführung zur Verfügung<br />
stehen, ist es notwendig, das einige Grundkenntnisse über die Spezifika<br />
von Verträgen in diesem Bereich zu vermitteln.<br />
Dies ist insbesondere deshalb sinnvoll, da eine unprofessionelle Vertragsgestaltung<br />
hohe finanzielle Konsequenzen für die Organisation haben kann.<br />
7. Zusammenfassung<br />
Dieser Curriculumsteil soll das bisher beschriebene „Produktwissen“ der I-und<br />
K-Technologien in Hinsicht auf die Prozessgestaltung erweitern. Dies bezieht<br />
sich zum einen auf die Abläufe zur Erstellung einer Dienstleistung, aber auch<br />
auf die Abläufe der Software- Pflege. Nur so ist der grundsätzliche Ansatz „Organisation<br />
vor Technik“ zu gewährleisten.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 38
II. OPTIONEN DES <strong>IN</strong>TERNETS<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 39
Sozialberatung im Internet 1<br />
Hans-Joachim Gehrmann<br />
1. Sozialberatung im Internet – eine Problemskizze<br />
Wenn Sozialinformatik fachliche Verantwortung für den Produktionsfaktor Information<br />
im System sozialer Dienstleistungen wahr zu nehmen hat (Wendt<br />
2000), dann<br />
• müssen ihre Aufgaben und ihre Leistungen aus den Anforderungen der<br />
sozialen Arbeit heraus definiert und bewertet werden,<br />
• hat Sozialinformatik in den Kernbereichen der Sozialer Arbeit wirksam<br />
zu werden,<br />
• sollte gefragt werden, welchen Stellenwert sie im Feld der sozialen Beratung<br />
hat.<br />
Aktuelle Daten zeigen jedoch einen noch sehr geringen Stellenwert der „Sozialberatung<br />
im Internet“ sowohl in der Beratungspraxis als auch in der Fachdiskussion<br />
der Sozialinformatik.<br />
Dabei steht die Sozialberatung vor folgenden Problemen und Herausforderungen:<br />
• Gesellschaftliche Modernisierung schafft Beratungsbedarf, wenn Sozialberatung<br />
eine „Abfangeinrichtung“ im risikoreichen Prozess der Inklusion/<br />
Exklusion moderner Gesellschaften ist.<br />
• Raumgebundene Beratungsangebote berücksichtigen inhaltlich und organisatorisch<br />
nicht ausreichend den sozialstrukturellen Wandel.<br />
• Neue Kommunikationsstrukturen verlangen neue (virtuelle) Beratungsangebote<br />
und –strukturen.<br />
1 Bei diesem Beitrag handelt es sich lediglich um das Manuskript zum Vortrag nicht aber um<br />
eine ausgearbeitete und überarbeitete Fassung. (Anmerkung der Herausgeber)<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 40
Steigender Beratungsbedarf bei sinkenden Ressourcen<br />
• Steigender Beratungsbedarf<br />
aufgrund von<br />
– Arbeitsteilung<br />
– Unübersichtlichkeit<br />
– Differenziertheit<br />
– Bedürftigkeit<br />
– Arbeitslosigkeit<br />
– …<br />
• Sinkende Ressourcen<br />
im sozialen Bereich<br />
– Steuereinnahmen<br />
– Mittelkürzung<br />
– Personalabbau<br />
– …<br />
Träger der Sozialberatung können effizient<br />
• Telearbeit nutzen<br />
• Marktpräsenz verbessern<br />
• Uno-actu-Prinzip entzerren,<br />
• qualifizierte Ehrenamtliche gewinnen<br />
• BeraterInnen von Routineanfragen entlasten<br />
• Einstellung von Beratungsangeboten abwenden<br />
• flexible und differenzierte Beratungsangebote für mobile Ratsuchende<br />
schaffen<br />
• Effektiveres und effizienteres Beratungs-Setting entwickeln.<br />
Digitale Spaltung und Exklusion<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
b & l<br />
pro familia<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
Hauptschule<br />
10<br />
Mittlerer Abschluss<br />
Abitur<br />
Hochschule 0<br />
Wohnbevöl ker ung Inter netnutzer T-onl i ne<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 41
Da ein wesentlicher Abbau der digitalen Spaltung auf absehbare Zeitz trotz aller<br />
Anstrengungen im Prozess der Weiterentwicklung der Wissensgesellschaft<br />
nicht zu erwarten ist, müssen für die Benachteiligten Wege gesucht werden, die<br />
ihre Informations-/ Lebenschancen nicht noch weiter verschlechtern:<br />
2. Empirische Befunde zur Sozialberatung im Internet<br />
Aus den Daten einer von Beranet 2003 durchgeführten Onlinebefragung bei<br />
über 500 Beratungsstellen konnten u.a. folgende Befunde herausgearbeitet<br />
werden (vgl. Gehrmann 2004b):<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 42
Funktionen der Internetpräsenz:<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Fachinformation<br />
ÖffentlArbeit<br />
Klientenkontakt<br />
Onlineberatung<br />
Diakonie<br />
AWO<br />
Caritas<br />
anderer<br />
Selbsthilfe<br />
Gesamt<br />
Anteil der e-Mail-Beratung mit Sicherheitsstandard<br />
( web-basiert)<br />
Selbsthilfe<br />
freie Träger<br />
Diakonie<br />
Caritas<br />
AWO<br />
web-basiert<br />
offen wie<br />
z.B.outlook<br />
Gesamt<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 43
Sozialberatung im Chatroom:<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
anderer<br />
AWO<br />
Caritas<br />
Diakonie<br />
evangl. Kirche<br />
Selbsthilfeorganisation<br />
hat kein<br />
Interesse an<br />
Beratung im<br />
Chatroom<br />
möchte es in<br />
Zukunft gerne<br />
anbieten<br />
hat es als festen<br />
Beratungbestand<br />
teil<br />
Finanzierung der Internetpräsenz durch Kommune oder Land:<br />
(differenziert nach Bundesländer)<br />
100%<br />
80%<br />
0%<br />
BW<br />
Bayern<br />
Berlin<br />
Brandenburg<br />
Bremen<br />
Hamburg<br />
Hessen<br />
Nieders<br />
NRW<br />
RPP<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Sachsen<br />
SWH<br />
60%<br />
40%<br />
ja<br />
nein<br />
20%<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 44
3. „Helpline Mainz“ als Entwicklungs- & Studienprojekt in der Praxis<br />
In einem Modellprojekt zwischen einem Wohlfahrtsverband (BCV Mainz), einer<br />
Agentur für digitale Kommunikation (Zone 35 / Beranet Berlin) und der Hochschule<br />
soll versucht werden, innovative Wege in der Praxis und Ausbildung zur<br />
Verbesserung des Beratungsangebotes zu gehen und den Prozess des Aufbaus<br />
und der Ausweitung der Beratung im Internet gemeinsam zu analysieren.<br />
Das Helpline-Nutzer Portal:<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 45
Das Helpline-Berater-Portal:<br />
Vgl. http://www.das-beratungsnetz.de/helpline<br />
Das virtuelle Sprechzimmer :<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 46
Erste Erfahrungen:<br />
• Inhaltlich: Angebotsstruktur, Nutzerverhalten....<br />
• Personell: Engagement, Motivation, „Informatik“-Kenntnisse , Kooperation<br />
Praxis – Hochschule als Innovationsträger<br />
• Organisatorisch: Einbindung in die bestehenden Beratungsstrukturen<br />
und Leistungsprofile, technische Ausstattung , räumliche Vernetzung....<br />
…und Konsequenzen:<br />
• Lernen, in neuen virtuellen Strukturen zu denken und zu handeln<br />
• Verbesserung der Kenntnisse über Einsatzmöglichkeiten und Funktionen<br />
der Beratungssoftware<br />
• Optimierung der Nutzerfreundlichkeit durch gezielten Einsatz der Sozialinformatik<br />
4. Schlussfolgerungen für die Entwicklung der SozialinformatikNoch hat<br />
Sozialberatung im Internet eine eher marginale Bedeutung – sowohl in der Beratungspraxis<br />
als auch in der Fachdiskussion der Sozialinformatik<br />
Notwendig sind daher neben<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 47
• Bemühungen um differenzierte interdisziplinäre Evaluation von Projekten<br />
wie z.B. „Helpline Mainz“<br />
• Empirische Untersuchungen als Follow-up Studie für die bisherige<br />
Onlinebefragung incl. der bisher netzfernen Einrichtungen/Träger<br />
insbesondere<br />
• Ausbau der virtueller Sozialberatungsräume durch den gezielten Einsatz<br />
der Sozialinformatik in Lehre, Forschung und Praxis, um den<br />
Bedingungen und Anforderungen einer Wissensgesellschaft Rechnung<br />
zu tragen<br />
• Qualifikation der Träger und ihrer (zukünftigen) Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter, um die eigene dafür notwendige Motivation und Mobilität<br />
aufbringen zu können<br />
• Noch stärkere Berücksichtigung der personellen, organisatorischen<br />
und gesellschaftspolitischen Situation der sozialen Dienste durch die<br />
Sozial-Informatik<br />
Zur gesellschaftlichen Funktion der Sozialinformatik:<br />
Literatur<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 48
Castells, Manuel 2001: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Teil 1 der Trilogie<br />
Das Informationszeitalter, Opladen.<br />
Gehrke, Gernot (Hrsg.) 2004: Digitale Teilung – Digitale Integration, München.<br />
Gehrmann, Hans-Joachim 2002: Sozialberatung per Internet, in: Caritas 2002.<br />
Jahrbuch des Deutschen Caritasverbandes, Freiburg, S. 245 - 248<br />
Gehrmann, Hans-Joachim 2004a: Digitale Spaltung und sozialwirtschaftliches<br />
Handeln, in: neue caritas, Politik – Praxis – Forschung, Heft 13 /2004, S.<br />
24<br />
Gehrmann, Hans-Joachim 2004b: Situation der Beratungslandschaft. Ergebnisse<br />
der Onlinebefragung „Bedarfsermittlung 2003 zum Thema Onlineberatung“,<br />
Online unter: http://www.fbs.fh-darmstadt.de/HOMEPAGES/Gehrmann/<br />
gehrmann_auswertung_onlinebefragung.pdf<br />
Knatz, Birgit u. Dodier, Bernard 2003: Hilfe aus dem Netz. Theorie und Praxis<br />
der Beratung per E-Mail, Stuttgart<br />
Kreidenweis, Helmut 2004: Sozialinformatik, Baden-Baden<br />
Ley, Thomas 2004: Sozialinformatik. Zur Konstituierung einer neuen (Teil-)Disziplin.<br />
In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, 35. Jg., S.3-39<br />
Wendt, Wolf Rainer 2000: Sozialinformatik: Stand und Perspektiven, Baden-<br />
Baden<br />
Wimmer, Andreas 2004: 24 Hilfen auf einen Klick – Psychosoziale Beratung<br />
im Internet, in: Wolf Müller u. Ulrike Scheuermann (Hg.): Praxis Krisenintervention,<br />
Stuttgart , S. 289 - 299<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 49
Modernisierung sozialer Institutionen durch eGovernment als<br />
Herausforderung für die Sozialinformatik<br />
Harald Mehlich<br />
1. Fragestellung<br />
Mit der vorliegenden Arbeit soll herausgearbeitet werden, inwieweit sich infolge<br />
der nahezu flächendeckenden Vernetzbarkeit von Organisationen über das Internet<br />
auch für die Gestaltung sozialer Dienstleistungsprozesse neuartige Rahmenbedingungen<br />
gebildet haben, die für die Sozialinformatik eine neue Herausforderung<br />
darstellen.<br />
Im sozialen Sektor ist von den mittlerweile fortgeschrittenen Entwicklungen des<br />
Electronic Government im Bereich der öffentlichen Verwaltung bisher noch immer<br />
relativ wenig zu verspüren. Entwicklungen dieser Art im Sozialsektor finden<br />
sich vereinzelt auch mit dem Begriff Electronic NonProfit (Lenz 2001) belegt.<br />
Kaum ein Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge bleibt mittlerweile von den<br />
technischen Innovationsansätzen aus dem Umfeld des Internet ausgespart.<br />
Dies belegen zahlreiche “eBegriffe” wie eDemocracy, eVoting, eJustice,<br />
eTaxes, eHealth, eAdministration, eProcurement, eInformation, eService, eOrganization,<br />
eWork, eCollaboration, eCensus, ePolicy (Mehlich 2002, S. 1). Insofern<br />
verwundert es nicht, dass inzwischen auch wesentliche Teile des Sozialbereichs<br />
in die Einflusssphäre dieser wohl kaum aufzuhaltenden Entwicklung geraten<br />
sind. In der Identifizierung des Gestaltungspotentials, das sich hieraus<br />
abzeichnet, liegt eine vordringliche Aufgabe der Sozialinformatik. Hierfür ist es<br />
letztlich gleichgültig, ob Begriffskonstellationen wie „eGovernment im Sozialwesen“<br />
oder „Electronic Nonprofit“ zur Charakterisierung dieser Entwicklung Anwendung<br />
finden.<br />
Die Begriffe eNonprofit bzw. eGovernment werden bewusst gewählt, weil sie<br />
weiter gefasst erscheinen als Begriffe wie Cyber Social Work oder Sozialarbeit<br />
online (Poseck 2001), bei denen die in der Regel enge Verzahnung zwischen<br />
der Klientenarbeit vor Ort (Front-Office) mit spezifischen Datenlagen und Geschäftsprozessen<br />
im Back-Office eher unterbeleuchtet bleibt.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 50
Unter eGovernment soll in einer ersten Annäherung eine umfassende elektronische<br />
Reform von Arbeitsprozessen, Organisation und Klientenbeziehungen im<br />
gesamten Sozialwesen verstanden werden, was durch die Internettechnologien<br />
historisch erstmals flächendeckend ermöglicht wird.<br />
2. eGovernment und eBusiness - Schrittmacher für die Sozialinformatik?<br />
Zunächst ist herausarbeiten, inwiefern dem Electronic Government überhaupt<br />
die Funktion eines Schrittmachers für die Sozialinformatik zuteil werden kann.<br />
Hierbei ist zu beachten, dass die Sozialinformatik noch immer eine in Forschung,<br />
Lehre und Praxis wenig etablierte Fachdisziplin darstellt, die allerdings<br />
in den letzten Jahren zunehmend Konturen gewinnt (Kreidenweis 2004; Wendt<br />
2000; Jurgovsky 2002; Trube / Ostermann 2002).<br />
In dem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die Wirtschaftsinformatik bereits<br />
vor etlichen Jahren mit dem eBusiness einen Sammelbegriff gefunden<br />
hatte, um die Dienstleistungsproduktion in vernetzten Umgebungen vor allem in<br />
der Privatwirtschaft zu analysieren. Der Wirtschaftsinformatik sind dadurch zahlreiche<br />
neue Fragestellungen vermittelt worden (Meier / Stormer 2005).<br />
In der Verwaltungsinformatik macht diese Entwicklung spätestens seit der Ende<br />
der 90er Jahre unter der Bezeichnung Electronic Government bzw. eGovernment<br />
Furore. Wohnsitzummeldungen, Kfz-Zulassungen über das Internet, Online-Bauanträge,<br />
elektronische Steuererklärungen, schließlich auch der Online-<br />
Sozialhilfeantrag sowie weitergehende Phasen der Prozessabwicklung über<br />
das Internet stehen auf der Agenda.<br />
Wozu dient der Hinweis auf Wirtschaft und Verwaltung, wo es hier doch um<br />
Fragestellungen der Sozialinformatik geht?<br />
Soziale Arbeit findet zwar vorwiegend in Nonprofit-Organisationen statt, etwa in<br />
Wohlfahrtsverbänden, bei freien Trägern und kirchlichen Einrichtungen. Sie findet<br />
aber auch im öffentlichen Dienst statt, wobei kommunale und staatliche Einrichtungen<br />
wie Jugend-, Gesundheits- und Sozialämter, Arbeitsagenturen sowie<br />
der Strafvollzug nur exemplarisch zu nennen sind. Darüber hinaus sind zahlrei-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 51
che privatwirtschaftliche Einrichtungen zu nennen. Die dortigen Entwicklungen<br />
werden eben maßgeblich durch eGovernment und eBusiness beeinflusst, wobei<br />
dort naturgemäß eher administrative und ökonomische – und eben keine sozialen<br />
– Sichtweisen vorherrschen.<br />
Für die Sozialinformatik erscheint es angebracht, einen eigenständigen „e-<br />
Begriff“ herauszuarbeiten, der der spezifischen Logik des Sozialwesens optimal<br />
entspricht. Denn nur auf diese Weise lassen sich die Besonderheiten bei der<br />
Herstellung und beim Vertrieb sozialer Dienstleistungsprozesse zur Geltung<br />
bringen.<br />
Ohne ausreichende Kompetenzen zur Einschätzung des Potentials der angewandten<br />
Informatik im Sozialwesen liegt nahe, dass die in Wirtschaft und Verwaltung<br />
entwickelten Informatikkonzepte im 1:1-Maßstab auf das Sozialwesen<br />
übertragen werden, wobei jedoch zu fragen ist, inwieweit Konzepte der elektronischen<br />
Steuerakte eine sinnvolle Vorlage für die Akten der Jugendgerichtshilfe<br />
abgeben bzw. welche Anforderungen für sinnvolle Softwarelösungen in diesem<br />
Bereich zu stellen sind.<br />
3. Sozialinformatik in der Zeit vor dem Internet<br />
Der Übergang zur flächendeckenden Verbreitung des Internet in den 90er Jahren<br />
bedeutet einen Meilenstein auch für die Art und Weise der künftigen Erbringung<br />
sozialer Dienstleistungen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der EDV-<br />
Einsatz in Wirtschaft, Verwaltung und Teilen des Sozialwesens bereits seit den<br />
60er Jahren stattgefunden hat. Bezeichnenderweise sprach man seinerzeit a-<br />
ber weder von eGovernment noch von eNonprofit oder eBusiness. Vielmehr<br />
herrschte im Sprachgebrauch die Abkürzung EDV für elektronische Datenverarbeitung<br />
vor. Im öffentlichen Dienst sprach man dagegen von der ADV – automatisierte<br />
Datenverarbeitung. Dies umfasste z.B. automatisierte Abrufverfahren<br />
zwischen Einwohnermeldeamt und Finanzamt zum Zwecke des Lohnsteuerkartenversandes.<br />
Der EDV-Einsatz im Sozialwesen hatte bis zur Verbreitung des Internet in den<br />
90er Jahren folgende Schwerpunkte (Mehlich 1996):<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 52
• Fachneutrale Standard-PC-Software (z.B. Textverarbeitung als „kostspielige<br />
Schreibmaschine“ bis hin zum integrierten Paket oder zur Office-Suite).<br />
• Lokale Netze in den Einrichtungen, z.B. auf Basis von Novell Netware<br />
• Fachanwendungs-Software, vorwiegend zur Unterstützung von<br />
Routineprozessen in der Administration. Beispiele sind die Zahlbarmachung<br />
von Leistungen sowie Finanzbuchhaltung, Personal- und<br />
Einrichtungsverwaltung.<br />
• Ansatzweise gibt es Softwareunterstützung für die Soziale Arbeit im engeren<br />
Sinne, also etwa bei der Sozialplanung und bei der Klientenarbeit vor Ort:<br />
• Fachanwendungen für Falldokumentation<br />
• Software zur Unterstützung der Fachplanung etwa in der Jugendhilfe<br />
• Schuldnerberatung<br />
• Statistik<br />
• Datenbanken für Hilfsmittel für Behinderte<br />
• Rechenzentrumsbetrieb mit Großrechner und mittlerer Datentechnik. Dies<br />
spielte vor allem bei der Haltung von Daten sowie den meist über Terminal<br />
bzw. Terminalemulation zugänglichen Anwendungssystemen in zentralen<br />
Verwaltungen und dem Datenaustausch zwischen Kostenträgern wie<br />
Kommunen und Versicherungen eine Rolle.<br />
Diese Situation hält im Prinzip bis heute an und lässt sich durch die folgenden<br />
Merkmale näher charakterisieren:<br />
Es herrschen Daten- und Anwendungsinseln mit geringem Integrationsgrad vor.<br />
Die papierförmige Datenhaltung dominiert nach wie vor.<br />
Der Wirkungsradius der elektronischen Datenverarbeitung ist durch Gebäudebzw.<br />
Organisationsgrenzen wie z.B. einzelne Abteilungen begrenzt. Dem entspricht<br />
eine organisatorisch hochgradig zersplitterte Trägerlandschaft, auf die<br />
die Arbeitsprozesse bei komplexer Zuständigkeitslage verteilt sind.<br />
Der Anwendungsschwerpunkt des EDV-Einsatzes liegt bei gut strukturierten<br />
Daten, z.B. Adress-, Familien- und Personenstandsdaten von Klienten und Institutionen.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 53
Die verfügbaren EDV-Lösungen unterstützen den Gesamtprozess der Herstellung<br />
und des Vertriebes sozialer Dienstleistungen lediglich punktuell bzw. über<br />
kleinere Phasenabschnitte des Gesamtprozesses.<br />
4. Sozialinformatik und die beginnende Verbreitung des Internet<br />
Dieser Befund ändert sich auch mit der beginnenden Verbreitung des Internets<br />
zunächst nicht. Das Internet steht zu Beginn zunächst als Hypertextsystem im<br />
Vordergrund. Die schnelle Bereitstellung multimedialer Information auf Webseiten<br />
macht dabei seinen Kern aus. Auch kommunikative Funktionen werden<br />
durch das Internet unterstützt. Beispielhafte Internetdienste sind eMail, Chat<br />
und Newsgroups.<br />
Zur massenhaften Verbreitung des Internet haben dabei wohl vor allem die zunehmend<br />
benutzerfreundlichen Mail-, Chat- und Browserprogramme mit grafischen<br />
Oberflächen beigetragen. Die entsprechenden Internetdienste haben<br />
mittlerweile im Sozialwesen Verbreitung gefunden, und zwar sowohl bei der<br />
professionellen Sozialarbeit wie auch zumindest bei Teilen der Klientel. Insbesondere<br />
trifft dies für die Nachwuchskräfte im Sozialwesen zu. Eine Befragung<br />
bei den Studenten an der Universität Bamberg im WS 2003/2004 hat gezeigt,<br />
dass über 90% der Befragten Internetdienste nutzen.<br />
Das Internet wird im sozialen Bereich bisher vor allem als Informations- und<br />
Kommunikationsmedium genutzt, wobei medienpädagogische Fragestellungen<br />
vorherrschen. Inzwischen lässt sich hier eine Veralltäglichung der Internetnutzung<br />
als modernes Medium der Information und Kommunikation beobachten.<br />
Demgegenüber haben sich nachhaltige Auswirkungen auf die Strukturen und<br />
Prozesse in der Erbringung sozialer Dienstleistungen mit der Verbreitung des<br />
Internet bisher kaum ergeben. Wesentliche Aufgabenbereiche der Sozialarbeit<br />
finden nach wie vor weitgehend offline statt.<br />
5. Internettechnologie als Basis-Infrastruktur zur Produktion<br />
sozialer Dienste<br />
Das Internet ist zwar als Informations- und Kommunikationsinfrastruktur inzwischen<br />
weltweit etabliert. Mit Diensten wie Chat, Mail und Webinformationen<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 54
wird heute aber erst ein sehr geringer Anteil des nutzbaren Anwendungspotentials<br />
des Internet erschlossen.<br />
Dies gilt für den Kernbereich der öffentlichen Verwaltung und insbesondere für<br />
den sozialen Bereich. Wenn es künftig um die Erschließung weiterführender<br />
Anwendungspotentiale des Internet geht, stehen vor allem komplexere Arbeitsund<br />
Dienstleistungsprozesse im Vordergrund, die über mehrere Organisationen<br />
und Träger verteilt sind und die bisher oft noch an fehlenden rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
und mangelnden elektronischen Standards zwischen den<br />
Anwendungssystemen scheitern.<br />
6. Front-Office<br />
Diese Entwicklung sei hier nur exemplarisch für zwei Bereiche ausgeführt, nämlich<br />
für die vielgestaltigen Varianten des Front-Office und des Back-Office in<br />
moderner elektronischer Form.<br />
Das Front-Office betrifft die Schnittstelle zwischen dem freien Träger bzw. der<br />
Behörde und den jeweiligen Kunden. Externe Kunden sind etwa Klienten und<br />
Leistungsempfänger, interne Kunden sind die Mitarbeiter. Über das Front-Office<br />
erfolgt der Zugang zu den sozialen Dienstleistungen sowie deren Vertrieb an<br />
die Kundschaft. Hier ist ein Trend zu verzeichnen, die Dienstleistungen über<br />
eine Webschnittstelle zu erbringen, sofern ihre Onlinefähigkeit gegeben ist.<br />
Auch für die Mitarbeiter eines freien Trägers lassen sich zahlreiche Dienste ü-<br />
ber ein Intranet online bereitstellen, z.B. Urlaubsantrag, Beantragung einer<br />
Dienstreisegenehmigung oder Ausstellung einer Bescheinigung zur Vorlage bei<br />
einem Versicherungsträger.<br />
Auch die Klienten können bereits einfache soziale Dienstleistungen über das<br />
Internet im Wege der Selbstbedienung in Anspruch nehmen. Dies sind z.B. einfache<br />
Formen der Beratung oder die Ermittlung von Leistungsansprüchen mittels<br />
Online-Rechner.<br />
Die allgegenwärtige Vernetzung erweist sich zumal als eine günstige Rahmenbedingung,<br />
um mobile Arbeitsplätze telekooperativ in die Arbeitsprozesse beim<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 55
Träger einbinden. Damit erstreckt sich die Computerunterstützung erstmals direkt<br />
auf die Hilfesituation vor Ort.<br />
7. Back-Office<br />
Bevor komplexere Dienstleistungsprodukte über das Internet anzubieten sind,<br />
sind zahlreiche Probleme vor allem im Back-Office zu überwinden. Dies ist der<br />
Ort, an dem die sozialen Dienstleistungen hergestellt werden. Speziell im sozialen<br />
Bereich sind freilich Herstellung und Vertrieb von Dienstleistungen nicht<br />
immer klar zu trennen. Bei Beratung und Pflege und beim Klienten vor Ort bildet<br />
dies oft eine Einheit.<br />
Für Bürger und Klienten erweist sich ein breit angelegtes browservermitteltes<br />
Online-Dienstleistungsangebot rund um die Uhr (Verwaltung24) zwar als<br />
höchst komfortabel. Für das Jugendamt oder den freien Träger bringen jedoch<br />
online angestoßene Dienstleistungsprozesse – z.B. Sozialhilfeantrag – zunächst<br />
keine nennenswerten Einspar- oder Effizienzvorteile, solange ihre Weiterverarbeitung<br />
im Back-Office nach wie vor mit traditionellen Mitteln wie Hauspost,<br />
Aktenordner und Papierformular als Offline-Prozess erfolgt.<br />
Konsequenterweise unterliegt das Back-Office derzeit einem unübersehbaren<br />
Anpassungsdruck zur durchgängigen elektronischen Abwicklung von Dienstleistungsprozessen<br />
bei weitgehender Vermeidung von Medienbrüchen.<br />
Unter Nutzung des Internet lassen sich Arbeitsprozesse im Rahmen virtueller<br />
Organisationsansätze trägerübergreifend gestalten (Brosch / Mehlich 2005).<br />
Ansatzpunkte gibt es bei interkommunalen Projekten zum Aufbau von Internetportalen,<br />
auf die verschiedene Träger wie Arbeiterwohlfahrt, Sozial- und Jugendämter<br />
und Arbeitsverwaltung gemeinsamen Zugriff haben. Dies kann die<br />
Aufgabenwahrnehmung in Problembereichen wie Arbeitsbeschaffung und Armutsbekämpfung<br />
unterstützen.<br />
Auch lassen sich Intranets über das Internet zu Extranets verkoppeln. Dies<br />
kann dem Aufbau von Wissensmanagementsystemen dienen, die verschiedenen<br />
Nutzergruppen über Portale zugänglich sind. Sie integrieren den Zugriff auf<br />
hilferelevante Datenbestände des eigenen Trägers und dritter Einrichtungen –<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 56
auch im Mobilbetrieb. Die Sozialraumorientierung lässt sich unterstützen, indem<br />
Klienten zeitnah über einen geeigneten Platz in einer Jugendhilfeeinrichtung<br />
informiert werden.<br />
8. Voraussetzungen fortgeschrittenen eGovernments: Integration und<br />
Standardisierung<br />
Innovationen beim elektronischen Front- und Back-Office sind auf zahlreiche<br />
Vorleistungen angewiesen, die heute entweder fehlen oder nicht ausreichend<br />
erbracht sind. Dies betrifft vor allem Integrationsbestrebungen auf technischem<br />
und auf organisatorischem Gebiete.<br />
Hervorzuheben ist zunächst die erforderliche stärkere Integration bei Datenbanken<br />
und Anwendungssystemen als bisher. Erst dies ermöglicht eine weitgehend<br />
durchgängige elektronische Aktenführung und Dokumentenhaltung bei<br />
Minimierung von Medienbrüchen, z.B. im Verbund räumlich verteilter Institutionen<br />
wie Jugendamt, Jugendgerichtshilfe, Strafvollzug, Staatsanwaltschaft etc.<br />
Auch die hoch integrierten ERP-Systeme erweisen sich aus der Gesamtperspektive<br />
einer hochgradig zersplitterten Anwendungslandschaft oft als Insellösungen<br />
(Mehlich 2002, S. 156 f., 190).<br />
Verbesserungen in dieser Hinsicht erfordern eine weit reichende Einigung der<br />
zahlreichen involvierten Akteure auf Standards bei der Definition von Datenstrukturen<br />
und Schnittstellen zwischen den Fach-Anwendungssystemen. Hier<br />
zeichnen sich inzwischen Optimierungsansätze ab, z.B. im Rahmen von<br />
DeutschlandOnline, einer eGovernment-Initiative auf Bundesebene<br />
(http://www.deutschland-online.de). Einen speziell für das Sozialwesen interessanten<br />
Standard dokumentiert das XML-basierte XSozial (http://www.osci.de).<br />
Mit diesem Teilprojekt von DeutschlandOnline wurde 2004 begonnen. Ziel ist<br />
der elektronische Austausch von Fachdaten zwischen sozialen Trägern und<br />
Behörden auf standardisierter Grundlage, um den papierförmigen Datenaustausch<br />
zu reduzieren und fehlerarm zu gestalten.<br />
Vergleichbare Projekte aus anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes sind<br />
etwa<br />
• XMeld im Meldewesen,<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 57
• XKfz bei Kfz-Zulassungen,<br />
• XGewerbe beim Gewerberegister,<br />
• XBau für das Bauwesen,<br />
• XJustiz.<br />
Diese Aktivitäten setzen eine enge Kooperation zwischen Trägern, Kassen und<br />
öffentlichen Einrichtungen bei der Entscheidung für gemeinsame Standards<br />
voraus. Angesichts der vorherrschenden organisatorischen Zersplitterung und<br />
der zumeist vorhandenen Organisationshoheit der handelnden Akteure bedeutet<br />
dies eine anspruchsvolle Aufgabe.<br />
Weitgehend offen ist die Beantwortung der Frage, wer die Internet-Infrastruktur<br />
im Sozialwesen künftig bereitstellen und betreiben wird. Hierzu gehören etwa<br />
Sicherheits-, Bezahl-, Applikations- und Formulardienste. Weitere Beispiele sind<br />
elektronische Einkaufsplattformen, der Betrieb sozialer Internetportale oder trägerübergreifende<br />
Plattformlösungen für das Wissensmanagement. Da der Aufbau<br />
dieser Infrastruktur ein kostspieliges Unterfangen darstellt, kann hier nicht<br />
jeder Träger das Rad jeweils neu erfinden, vielmehr sind intensivere Kooperationen<br />
als bisher gefragt. In diesem Rahmen vermag etwa ein Träger elektronische<br />
Dienstleistungen zu entwickeln, die er dann nicht nur selbst nutzt, sondern<br />
auch dritten Nachfragern bietet. Dies kann auch unter der Einbeziehung privater<br />
Dienstleister im Sinne von Public-Private-Partnerships (PPP) erfolgen.<br />
9. Resümee: Soziale Arbeit und Informatisierung<br />
Der oben geschilderte Trend zum Aufbau zunehmend komplexer sozialer<br />
Dienstleistungsnetzwerke (Brüggemeier / Röber 2002) auf Internetgrundlage ist<br />
sicherlich nicht mehr umkehrbar, obgleich sich das Tempo und der konkrete<br />
Entwicklungsverlauf in den verschiedenen Anwendungsbereichen mit höchst<br />
unterschiedlicher Schrittgeschwindigkeit vollziehen.<br />
Auch bei den freien Trägern im Sozialwesen unterliegt die Herstellung von<br />
Dienstleistungen einem zunehmenden Außendruck, der eine Umstellung auf<br />
Internettechnologien nahe legt. Der Druck geht zum einen von Institutionen wie<br />
Kommunen, Privatwirtschaft und Krankenversicherungen aus. Änderungsdruck<br />
resultiert aber auch von wachsenden Teilen der Klientel sowie vom Beschäftig-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 58
tennachwuchs im Sozialwesen, der zunehmend auf eine „Internet-Sozialisation“<br />
zurückblicken kann.<br />
Als Resümee für die Sozialinformatik lässt sich folgende Aussage treffen:<br />
Soziale Arbeit war unter dem Aspekt der Informatisierung schon immer eine<br />
sperrige Materie. Dies liegt in der weitgehenden „Offenheit“ der spezifischen<br />
Situationen, in denen die Beziehungsarbeit mit dem Klienten stattfindet. Soziale<br />
Arbeit ist in wesentlichen Teilen generischer Natur, wobei wenig strukturierte<br />
Ad-hoc-Situationen häufig vertreten sind. Der Situationsverlauf wird durch die<br />
beteiligten Klienten und Sozialarbeiter bestimmt – und nicht durch eine<br />
Workflow-Engine. Hierin dürfte ein zentraler Unterschied zu den workflowgesteuerten<br />
Systemen bei stärker routineförmigen Abläufen liegen, die in der<br />
öffentlichen Verwaltung und den administrativ geprägten Bereichen der Nonprofit-Organisationen<br />
stärker verbreitet sind. Gefragt sind hier eher Intuition, Erfahrungswissen<br />
und informelle Strukturen, die prinzipiell nicht algorithmisierbar und<br />
damit auch nicht vollständig auf Software übertragbar sind. Wohl aber spezifische<br />
Phasenabschnitte des Gesamtprozesses sowie etwa Unterstützungsfunktionen<br />
wie beispielsweise Archivierungssysteme!<br />
Brauchbare Software für die Soziale Arbeit kommt nur dann zustande, wenn die<br />
besonderen Anforderungen des sozialen Dienstleistungssektors in die Anforderungsanalysen<br />
einfließen. Diese lassen sich jedoch nur dann angemessen geltend<br />
machen, wenn eine ausreichende IT-Kompetenz zur Beurteilung der gegebenen<br />
technischen Möglichkeiten vorhanden ist.<br />
Heute bedeutet das vor allem das Erfordernis einer realistischen Einschätzung<br />
zur optimalen Ausschöpfung des Potentials, das innovativen Systemlösungen<br />
bei der künftigen Gestaltung sozialer Dienstleistungen zukommt.<br />
Aufgrund bereits vorliegender Erfahrungen im öffentlichen Bereich erscheint es<br />
ertragreich, den aktuellen eGovernment-Prozess speziell unter dem Aspekt des<br />
Erfahrungstransfers näher zu verfolgen. Zahlreiche Strukturanalogien zwischen<br />
den Geschäftsprozessen des Sozialwesens und denen des übrigen öffentlichen<br />
Dienstleistungssektors legen dies nahe.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 59
Literatur<br />
Brosch, Dieter / Mehlich, Harald 2005: E-Government und virtuelle Organisation.<br />
Bedeutung für die Neugestaltung der sozialen Sicherungssysteme und<br />
Perspektiven für die Kommunalverwaltung. Wiesbaden<br />
Brüggemeier, Martin / Röber, Manfred 2002: Stand und Entwicklungsperspektive<br />
der Arbeitsorganisation im öffentlichen Dienst. In: Koch, R. / Conrad,<br />
P. (Hg.): New Public Service. Wiesbaden 2002. S. 123 – 154<br />
Jurgovsky, Manfred 2002: Was ist Sozialinformatik? In: Neue Praxis, H. 3, 32.<br />
Jg., S. 297-303<br />
Kreidenweis, Helmut 2004: Sozialinformatik, 1. Auflage, Baden-Baden 2004.<br />
Lenz, Thilo 2001: E-Government und E-Nonprofit. Management von Internetprojekten<br />
in Verwaltung und Nonprofit-Organisationen. Stuttgart<br />
Mehlich, Harald 1996: Einsatzperspektiven und Wirkungen des Computereinsatzes<br />
im Sozialwesen: Ein Beitrag zur Sozialinformatik. In: Zeitschrift für Sozialreform<br />
42 (1996). Heft 3. S. 180-201.<br />
Mehlich, Harald 2002: Electronic Government. Die elektronische Verwaltungsreform.<br />
Grundlagen –Entwicklungsstand – Zukunftsperspektiven. Wiesbaden<br />
2002<br />
Meier, Andreas / Stormer, Henrik 2005: eBusiness & eCommerce. Berlin et<br />
al.<br />
Poseck, Oliver (Hrsg.) 2001: Sozial@rbeit Online. Neuwied<br />
Trube, Achim; Ostermann, Rüdiger 2002: Sozialinformatik lehren - aber wie?;<br />
in: Sozialmagazin, 27.Jhg. Heft 7/8 2002, S. 66-71<br />
Wendt, Wolf Rainer 2000: Sozialinformatik: Stand und Perspektiven, 1. Auflage,<br />
Baden-Baden 2000<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 60
III. IT-GESTÜTZTE DOKUMENTATION<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 61
Einige Anmerkungen zu IT-gestützten Dokumentationssystemen<br />
in der Sozialen Arbeit<br />
Silke Axhausen<br />
Fachleute, die sich mit IT-gestützter Dokumentation beschäftigen, gehen von<br />
einer Selbstverständlichkeit aus, dass sich Fachsoftware relativ schnell in der<br />
Sozialen Arbeit durchsetzen werde. Dies tun sie allerdings schon seit gut zehn<br />
Jahren. Da die Praxis nur zögerlich Informationstechnologie für Dokumentation<br />
einsetzt, möchte ich mich damit beschäftigen, wie die Lage beschaffen ist, die<br />
IT-Befürworter und IT-Skeptiker gleichermaßen hervorbringt.<br />
Ich möchte im Folgenden zunächst darauf eingehen, was Dokumentation in der<br />
Sozialen Arbeit eigentlich bedeutet und dies vor allem im Bereich der Jugendhilfe,<br />
speziell in den erzieherischen Hilfen vertiefen. Anschließend möchte ich kurz<br />
auf den Stand der Implementation von IT-gestützten Dokumentationssystemen<br />
in der Sozialen Arbeit eingehen und erst am Schluss schlaglichtartig auf einzelne<br />
Programme. 1<br />
1. Zum Begriff von Dokumentation<br />
Ich verstehe unter Dokumentation „systematisches Festhalten von Sachverhalten<br />
im Verlauf der Erziehungspraxis“ (Moch 2004, 57).<br />
Selbstverständlich findet Dokumentation auch in den Bereichen der Sozialen<br />
Arbeit statt, in denen es nicht um Erziehung geht. Dokumentation interessiert<br />
vor allem dort, wo es um Veränderung des Verhaltens durch gezielte Beeinflussung<br />
geht.<br />
Festgehalten werden in der Dokumentation vor allem „Sachverhalte“, die das<br />
sich verändernde Erleben und Verhalten einzelner Kinder und Jugendliche<br />
kennzeichnen. Gemeint dabei ist nicht abweichendes Verhalten, sondern die<br />
gesamte individuelle Entwicklung.<br />
Meines Erachtens gehört dieses „systematische Festhalten von Sachverhalten“<br />
zu jeder professionellen Tätigkeit und entspricht dem wissenschaftlichen Inte-<br />
1 Mein persönlicher Hintergrund für dieses Thema besteht weniger in Expertenwissen als<br />
hauptsächlich in der Neigung: Datenbanksysteme können - richtig eingesetzt - viel eintönige<br />
Arbeit ersparen und viel zur Erkenntnis beitragen. Der derzeitige Stand an Wissen über Soziale<br />
Arbeit verdient durch Datensammlungen in der Dokumentation Sozialer Arbeit vorwärts<br />
gebracht zu werden.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 62
esse an der Tätigkeit und ihrer gekonnten Durchführung. Insofern ist Soziale<br />
Arbeit von Beginn an vom Interesse an den Lebensumständen des Klientels<br />
und seinen Lebenswelten (als Begriff für die individuelle Deutung dieser Lebensverhältnisse)<br />
begleitet. 2<br />
”Von den Pionierinnen selbst wurde stets eine forschende Grundhaltung vertreten,<br />
weil von der Erforschung der Lebensumstände und der Verarmungsprozesse<br />
zurecht Erkenntnisgrundlagen fürsorgerischen Handelns erwartet wurden.<br />
Und auch die Überprüfung der Wirkung des beruflichen Tuns, also Evaluationsforschung,<br />
war von Beginn an Gegenstand der theoretischen Bemühungen.<br />
Dennoch blieb der Forschungsertrag der Sozialschulen gering, weil der<br />
Handlungs- und Entscheidungsdruck der Praxis dem Forschungsinteresse wenig<br />
Raum ließ.” (Mühlum / Bartholomeyczik / Göpel 1997, 56)<br />
Eher erklärungsbedürftig ist, warum diese selbstverständliche Grundhaltung der<br />
eigenen Tätigkeit gegenüber - wissen zu wollen, mit wem man es zu tun hat,<br />
was aus Menschen wird, was man selbst erreicht hat, auf welchem Wege dies<br />
geschah usf. - warum diese selbstverständlichen Grundfragen im Beruf der Sozialen<br />
Arbeit eben nicht so selbstverständlich sind. Dass „der Handlungs- und<br />
Entscheidungsdruck der Praxis dem Forschungsinteresse wenig Raum ließ“,<br />
wird schon so sein. Warum dies in einem Beruf so ist, der immerhin eine wissenschaftliche<br />
Ausbildung verlangt, ist damit nicht erklärt.<br />
Staub-Bernasconi schreibt in einem Email-Kommentar zu Dokumentationssoftware<br />
in der Sozialen Arbeit, dass darin eigentlich nur die „explizite Nennung<br />
der W-Fragen“, die für eine Fallerfassung notwendig wären, erfolgte. 3 Wenn die<br />
systematische Stellung dieser „W-Fragen“ in der Profession erst eingeführt<br />
werden muss, verweist das auf einen Stand der Profession, der eben nicht auf<br />
einem Standard an Wissen für die Praxis beruht. Dies ist nicht nur „ein Armutszeugnis<br />
für die Ausbildung“.<br />
2 Man erinnere sich an die Begründung der „Sozialen Diagnose“ durch Alice Salomon in<br />
Deutschland, die als berufliche Grundlage die genaue Erfassung einzelner Klienten und ihres<br />
Umfelds erläuterte, um Handlungsstrategien zu ihrer Förderung zu entwickeln. Auf einer anderen,<br />
nämlich mehr soziologisch begründeten, Basis werden im Umfeld von Jane Addams<br />
die „Maps und Papers“ im Zusammenhang mit Hull House in Chicago erstellt – um nur zwei<br />
prominente Beispiele aus den Anfängen der Sozialen Arbeit zu nennen.<br />
3 „Die fast allseits bezeugte erhöhte Reflexionskompetenz ist eigentlich ein Armutszeugnis für<br />
die Ausbildung, die es offenbar nicht fertig bringt, die einfachsten W-Fragen als erkenntnistheoretische<br />
Grundlage wie ganz praktische Anleitung für eine Fallerfassung zu lehren! Was<br />
diese Software liefert, ist eigentlich nur die explizite Nennung dieser W-Fragen.“ (E-Mail vom<br />
21.05.2005)<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 63
1.1 Zum Nutzen von Dokumentation<br />
Regelmäßige Dokumentation ist keine Selbstverständlichkeit in der Sozialen<br />
Arbeit. Erst seit Sozialmanagement ein Thema ist und in der Praxis durch gesetzliche<br />
Grundlagen Qualitätsentwicklung verankert wurde (§ 93 BSHG, §78a<br />
KJHG), stellten sich Anstrengungen ein, die Praxis genauer zu erfassen. Noch<br />
heute gibt es für die Bundesrepublik bis auf wenige Ausnahmen keine einheitlichen<br />
Standards, nach denen in den verschiedenen Arbeitsfeldern dokumentiert<br />
wird. 4<br />
Dennoch ist meines Erachtens der Nutzen von Dokumentation öfter schon beschrieben<br />
und wird bei jedem Projekt, in dem Dokumentation in Einrichtungen<br />
der Sozialen Arbeit entwickelt wird, von neuem benannt.<br />
Von Spiegel nennt schon 1994 „Wissenschaftliche Kontrolle und Aufklärung,<br />
Qualifizierung, und Innovation“ als Funktionen von Dokumentation und Evaluation<br />
(von Spiegel 1994). Durch Dokumentation werden Daten erhoben, in Bereichen,<br />
in denen sonst häufig nur Vermutungen vorliegen. Dafür müssen die Ziele<br />
der Arbeit klar bestimmt sein. Kolleginnen und Kollegen, die diese Datenerhebungen<br />
durchführen, verständigen sich über wissenschaftliche Kategorien, mit<br />
denen ihre Arbeit und Klienten zu beschreiben sind und qualifizieren sich dabei.<br />
Häufig gewinnen sie ein neues Bild von Klienten und ihrem Umfeld und entwickeln<br />
dabei neue Zugänge und Konzepte. Insofern ist Dokumentation häufig<br />
Hebel von Innovation in der Praxis.<br />
Martin Schmid hebt in diesem Prozess noch die Funktion der „Modernisierung“<br />
als eigene hervor. Damit meint er, dass sich Fachteams in dieser Verständigung<br />
selbst reflektieren und auf moderne Anforderungen an ihre Arbeit durch<br />
erneuerte Praxis reagieren (Schmid 2006). 5<br />
4 Eine Ausnahme bildet v.a. der Suchtbereich: Verschiedene Länderministerien haben Wert<br />
darauf gelegt, dass eine einheitliche Dokumentation in den Einrichtungen der Suchthilfe gewährleistet<br />
wird. Insofern gibt es einen nationalen und sogar europäischen Datensatz in diesem<br />
Bereich, der durch verschiedene Software erhoben werden kann. Was die Qualität dieser<br />
Daten angeht, ist eine andere Frage. Immerhin ist ein Verfahren gefunden, bei dem die<br />
Einrichtungen einheitliche Basisdaten erheben und die Möglichkeit haben, weitere zusätzliche<br />
Informationen für sich zu gewinnen.<br />
5 Von Fachkräften in der Praxis selbst werden zwei Bedeutungen von Dokumentation am häufigsten<br />
genannt: Zum einen besteht fast immer eine Unsicherheit darüber, worin die eigene<br />
Leistung eigentlich besteht. Bewirkt Soziale Arbeit überhaupt etwas? Wird mehr als Verwaltungsarbeit<br />
geleistet? Man könnte das mit Selbstvergewisserung beschreiben, die offensichtlich<br />
in diesem Beruf nötig ist. Zum anderen kann mit den Daten das Arbeitsfeld präzise beschrieben<br />
werden. Zum Beispiel: Meine Klienten sind ärmer geworden. Die Jugendlichen sind<br />
früher für harte Drogen anfällig. Mädchen rauchen früher usf.. Die Härte der Daten kommt der<br />
Sozialen Arbeit durchaus zupass, wenn sie präzise Aussagen über das Klientel treffen will,<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 64
Middendorf, in dessen Projekt es um die Entwicklung eines elektronischen<br />
Gruppentagebuches in der Erziehungshilfe ging, beschreibt beispielhaft diesen<br />
Prozess:<br />
„Schon jetzt läßt sich allerdings berichten, daß die Einführung des elektronischen<br />
Gruppenbuches einen Prozeß initiiert hat, der eine methodische Ausrichtung<br />
des pädagogischen Handelns fördert. Die Entwicklung von Checklisten für<br />
die Dokumentation und die durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen befördern<br />
diesen Prozeß. Zielbezogenheit, Reflexion und Überprüfbarkeit der eigenen<br />
Leistungen und Qualität werden zu einem selbstverständlicheren Bestandteil<br />
der Erziehungsleistungen der Fachkräfte. Damit wird durch institutionell gesetzte<br />
Rahmenbedingungen in der Praxis Qualitätsentwicklung nicht nur auf der<br />
Strukturebene sondern insbesondere im schwierigen Feld der Prozeßebene in<br />
Gang gesetzt, was nicht zuletzt allen Beteiligten zu Gute kommen soll (Evaluationsfrage<br />
4).“ (Middendorf 2004, 25)<br />
Und auch Kreidenweis weist daraufhin, dass die Einführung von Software in<br />
den Jugendämtern eine Reflexion und Veränderung des Prozesses der Hilfeplanung<br />
bewirkt hat: „In allen Jugendämtern wurde der Hilfeplanungsprozess im<br />
Zuge der Software-Einführung umgestaltet. [...] ‚Mit der Hoffnung eben, daß der<br />
Computer mehr Klarheit verschafft.’ “ (Kreidenweis 2005, 40)<br />
So klar der Nutzen von Dokumentation ist, so unbeliebt ist sie zugleich und so<br />
wenig wird sie in der Praxis durchgeführt:<br />
Nirgends wird der Zeitaufwand bei der Entwicklung und Einführung von Dokumentation<br />
extra berücksichtigt und deswegen mehr Personal kalkuliert und bezahlt.<br />
Selten werden Rechner in den Haushaltsplänen berücksichtigt, geschweige<br />
denn die Folgekosten zur Schulung, zur Erneuerung der Systeme, zur<br />
Reparatur usf. in der nötigen Höhe.<br />
Mitarbeiter und ihre gewerkschaftlichen Vertretungen befürchten eine Verschlechterung<br />
ihrer Arbeitsbedingungen und eine Erhöhung ihres Arbeitsdrucks,<br />
wenn den Geschäftsleitungen detailliertere Daten über ihre Arbeit vorlägen.<br />
mit denen sie die Politik und Öffentlichkeit überzeugen will, d.h. auch erfolgreich für mehr Mittel<br />
werben will.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 65
Die Software, die es gibt, bietet in vielen Arbeitsbereichen der Sozialen Arbeit<br />
keine überzeugenden Lösungen und keine einheitliche Dokumentation, so dass<br />
auch keine flächendeckenden und darin aussagekräftigen Erhebungen möglich<br />
sind. Es geht meistens nur um in der Aussage sehr begrenzte Insellösungen.<br />
Auch wenn es noch nicht einmal um eine IT-gestützte Dokumentation geht,<br />
sondern um eine Dokumentation in Papierform, liegen keine wissenschaftlich<br />
abgesicherten Kategoriensysteme für die vielen Arbeitsbereiche der Sozialen<br />
Arbeit vor, so dass der Entwicklungsaufwand für jede Einrichtung oder jedes<br />
Amt enorm hoch ist und die Ergebnisse in jedem Fall umstritten sind.<br />
Insofern gibt es immer wieder dieselben Klagen und Berichte, wenn Dokumentation<br />
doch Thema ist: Keine oder zuwenig Zeit, um sinnvolle Kategorien für die<br />
Erfassung der Praxis zu entwickeln. Unklare begriffliche Kategorien, kein amtsübergreifender<br />
Konsens über die Begriffsinhalte und Auswertungsmethoden;<br />
keine vernünftigen Grundlagen, wenn Systeme angeschafft werden. Pädagogische<br />
Mitarbeiter wissen zuwenig über eine betriebswirtschaftliche Kalkulation<br />
oder die Erstellung von Pflichtenheften; selbst Ministerien verhandeln ungeschickt<br />
mit Firmen (vgl. Kreidenweis 2005, 59)<br />
In der Folge entstehen häufig Daten mangelhafter Qualität, da unwillige Mitarbeiter<br />
entweder gleich viele Felder gar nicht ausfüllen (die berühmten „missing<br />
data“, mit denen sich die auswertenden Wissenschaftler herumschlagen müssen)<br />
(Schmid 2006) oder Felder mit sehr unterschiedlicher Deutung ausfüllen.<br />
Auch bei bester Motivation verlangt die Software manchmal Umwege, was ein<br />
Mitarbeiter aus einem Jugendamt folgendermaßen charakterisiert:<br />
„Ich mache das nur um sozusagen die Software zu beruhigen“ (Kreidenweis<br />
2005, 46). Soweit zur Effizienz der Arbeit.<br />
Diese vielfältigen Misslichkeiten aus dem Alltag Sozialer Arbeit lassen sich sicher<br />
auf ein mangelndes Interesse an Aufklärung in diesem Bereich zurückführen.<br />
So sehr es erstaunt, dass so wenig Interesse an wirklichen Daten aus diesem<br />
großen Bereich besteht, so wenig soll es hier weiter Thema sein. Aber eine<br />
Gesellschaft, die es sich leistet, so viele Menschen an ihren Maßstäben scheitern<br />
zu lassen, und eher noch einen ganzen Berufsstand dafür ausbildet, sich<br />
mit diesen scheiternden Existenzen individuell zu beschäftigen, verlangt offen-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 66
sichtlich keine Klarheit darüber, wie diese Probleme rationell zu bewältigen wären.<br />
Die Frage danach, wie Soziale Arbeit kostengünstig und zielorientiert geleistet<br />
werden kann, ist eben eine andere.<br />
„Gutes Dokumentieren ist nur möglich in einer an guten Leistungen interessierten<br />
Gesellschaft, Jugendhilfe und öffentlicher Erziehung“(Blandow 2004, 55).<br />
Und: Gutes Dokumentieren ist umgekehrt ein Schritt in diese Richtungen.“<br />
(ebd.)<br />
„Zum guten Dokumentieren gehört dann auch, dass sinnloses Dokumentieren<br />
zurückgewiesen wird [...]“. Und: „dass Dokumentieren nur dann Sinn macht,<br />
wenn es zu etwas nutze ist. Ohne den Wunsch, sie (die Daten – Anmerkung<br />
von Silke Axhausen) auszuwerten und aus ihnen für die Zukunft zu lernen, sind<br />
sie überflüssig und rauben mir Zeit, die ich sinnvoller verbringen kann.“ (ebd.)<br />
Mit diesen schlichten Grundzügen legt Blandow zunächst fest, dass die Dokumentation<br />
für eine sinnvolle Reflexion und Veränderung der Praxis ausgerichtet<br />
sein muss. Und dass nur so die Motivation der Mitarbeiter geweckt werden<br />
kann.<br />
Im Folgenden entwickelt er – nicht eine Theorie der Jugendhilfe – aber zumindest<br />
ein Gerüst an Dokumentation, dass ich vorstellen will. Er unterscheidet fünf<br />
verschiedene Bereiche der Dokumentation, dementsprechend viele verschiedene<br />
Formen, um den unterschiedlichen Anforderungen, die in diesem Fall an<br />
Jugendhilfe gerichtet werden, gerecht zu werden. Ich möchte sie darstellen, um<br />
anschließend Software, die für Jugendhilfe vorliegt, an diesen Maßstäben zu<br />
messen.<br />
1.2 Zur Dokumentation in der Jugendhilfe<br />
Blandow spricht zunächst davon, dass Erziehungshilfe Dokumente entwickelt,<br />
die wegen ihres Charakters als öffentliche Erziehung nötig sind. Dafür führt er<br />
auf<br />
• den Entwicklungsbericht<br />
• die Konzeption einer Einrichtung<br />
• das Qualitätshandbund oder die Leistungsbeschreibung.<br />
Diese Berichte werden erstellt, um der öffentlichen Hand, meist dem Jugendamt,<br />
inhaltlich darzustellen, dass der öffentliche Auftrag ordnungsgemäß verrichtet<br />
wird.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 67
Einen weiteren, relativ formalen Bereich sieht er darin begründet, dass in der<br />
Institution berufliche Arbeit geleistet wird. Dies erfordert:<br />
• Dienstpläne usf.<br />
• Hausordnungen, Dienstanweisungen, Protokolle von Dienstbesprechungen<br />
• Stellenpläne- oder Arbeitsplatzbeschreibungen sowie<br />
• Informationen bei Übergabe zwischen den Schichten<br />
Schließlich geht es um die pädagogische Falldokumentation. Hier sind aufzuführen:<br />
• Psychosoziale und biographische Diagnose, Beobachtungen, Gesprächsprotokolle,<br />
Hypothesen<br />
• Gesprächsprotokolle und Selbstäußerungen von Kindern und Jugendlichen<br />
zur systematischen Auswertung<br />
• Tonbandprotokoll bestimmter wiederkehrender Situationen (Lehren für<br />
die bessere Gestaltung)<br />
Während er die vorgenannten Instrumente allein den Fachkräften zuordnet, bestimmt<br />
er einen weiteren Bereich, in dem es um Koproduktion in der Pädagogik<br />
geht. Dafür führt er an:<br />
• Biografische Interviews mit Jugendlichen<br />
• Pädagogische Verträge und Hilfepläne<br />
• Gemeinsam erstellte Mitbestimmungsmodelle, Regeln, Strategieentwicklung<br />
für Vorstellungsgespräch<br />
Und auch mit diesen Instrumenten ist seine Liste noch nicht vollständig. Als<br />
letzten Bereich nennt er noch ausdrücklich Dokumentationsformen, die als Mittel<br />
des Erziehungs- und Unterstützungsprozesses selbst gelten können,<br />
nämlich:<br />
• Life-story-books<br />
• Projekt, in dem sich die Jugendlichen in Pose setzen<br />
• Rollenspiele, Video-Experimente, gestaltpädagogische Experimente<br />
(alles Blandow 2004, 44ff.)<br />
Natürlich wird in dieser Aufzählung vor allem anderen augenfällig, wie wenige<br />
dieser Instrumente bisher in Software übertragen sind.<br />
Überzeugend ist dabei aber, dass viele Elemente aus der pädagogischen Praxis,<br />
die unter „Mitarbeit“ der Jugendlichen und Kinder zustande kommen, aussagekräftige<br />
Formen der Dokumentation einer Entwicklung darstellen.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 68
M.E. kann mit den letztgenannten Instrumenten noch eine weitere Rolle der<br />
Sozialen Arbeit ausgefüllt werden: Aussagen der Kinder und Jugendlichen<br />
selbst sind besonders geeignet, ihre Lebenswelt zu charakterisieren. So kann<br />
Soziale Arbeit nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht Deutungen der Klientel<br />
realitätsgetreu abbilden, um ihr Verhalten zu erklären, sondern auch in politischer<br />
Hinsicht sich zum Sprachrohr machen. 5<br />
Inwieweit diese Selbstaussagen von Kindern und Jugendlichen sogar notwendig<br />
sind, um Heimerziehung sachgerecht abzubilden, möchte ich anhand einer<br />
Darstellung von Klaus Wolf, der ich in weiten Teilen zustimme, in einem weiteren<br />
Punkt zeigen (Wolf 2000).<br />
1.3 Der Nutzen der Kindersicht für Evaluation<br />
• Dokumentation und Evaluation in der Jugendhilfe tendiert nicht nur<br />
weiterhin zu einer defizitären Sicht von Kindern und Jugendlichen; sie<br />
tendiert auch dazu, den Anteil der öffentlichen, gezielten Heimerziehung,<br />
der bewussten Interventionen, zu überschätzen. Nicht zuletzt<br />
die Erfordernisse der Qualitätsentwicklung nach KJHG zwingen ja<br />
nachgerade dazu, Erziehungserfolge monokausal auf Leistungen der<br />
Einrichtungen zurückzuführen. Kinder und Jugendliche werden bei<br />
dieser Sicht zu Objekten: „Gestörte Kinder kommen ins Heim, um<br />
dort repariert zu werden. […] Erziehungserfolge werden abrechenbar“<br />
(Wolf 2000, 6 alle folgenden Zitate aus diesem Aufsatz)<br />
• Und selbst wenn bestimmte Verhaltensänderungen wirklich durch<br />
den Einfluss der Heimerziehung erreicht werden – werden dadurch<br />
nicht unter Umständen andere wesentliche erzieherische Ziele vernachlässigt?<br />
Wenn Jugendliche, um einer Berufsausbildung nachzugehen,<br />
regelmäßig geweckt werden, so „wird aber möglicherweise<br />
ein Lernfeld arrangiert, in dem die Jugendlichen Selbstkontrolle und<br />
die Fähigkeit, Selbstzwang auszuüben, nicht weiterentwickeln können.<br />
Hinsichtlich dieses Zieles ist das Lernfeld also ungünstig.“ (ebd.,<br />
9) Dokumentation und Evaluation, die sich notgedrungen an erzieherischen<br />
Maßstäben orientiert, Kinder und Jugendliche auf die beste-<br />
5 „Früher konnte ich unterm Teppich Stelzen gehen“ – diese Aussage einer ehemaligen Sozialhilfeempfängerin,<br />
mit der sie beschreibt, wie sehr inzwischen im Verlauf einer Umschulungsmaßnahme<br />
ihr Selbstbewusstsein gewachsen ist, weil sie Arbeit hat, und insofern in dieser<br />
Gesellschaft „mitreden“ kann – diese Aussage ist ein Bespiel für eine Äußerung, deren Bild in<br />
einer wissenschaftlichen Äußerung an Anschaulichkeit nicht überboten werden kann.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 69
henden Zwänge unserer Gesellschaft vorzubereiten, vernachlässigt<br />
unter Umständen andere Ziele, die aber für die Entwicklung der Betroffenen<br />
mindestens genauso relevant wären.<br />
• Ein dritter Einwand gegen zu reparierende Verhaltensdefizitlisten:<br />
Täuschen wir uns nicht oft darüber, welcher Einfluss wirklich Wirkungen<br />
bei den Kindern und Jugendlichen erreicht, bzw. für sie wirklich<br />
von Bedeutung ist? Wissen wir nicht auch ganz genau, dass sie viele<br />
erzieherische Schritte nur berechnend durch vorgetäuschtes Wohlverhalten<br />
beantworten, wirklich aber ganz anders denken und handeln<br />
(wollen)?<br />
„Wenn die Absicht der Verhaltensänderung allzu deutlich im Mittelpunkt steht,<br />
löst dies bei Kindern – und erst recht bei Jugendlichen – eher Widerstände<br />
aus.“ (ebd., 10) Und: „Über ein Repertoire an Methoden, mit denen wir eindeutig<br />
gezielte Effekte im Denken und Fühlen von Menschen erreichen können,<br />
verfügen wir nicht. […] Das Denken, dass wir Erwachsenen die Kinder in bestimmter<br />
Weise behandeln können und dabei gezielt geplante Effekte erzielen,<br />
stammt aus dem medizinischen Kontext und erscheint mir für pädagogische<br />
Arrangements eher ungeeignet.“ (ebd., 11)<br />
Insoweit Erfolgsmessungen nur eine pädagogisch lineare Zielebene abbilden,<br />
gehen sie an den wirklichen Entwicklungen von Kindern und Jugendlichen, die<br />
sich mit solchen Anforderungen auseinandersetzen, sie weitgehend als unangenehm<br />
und nicht einzusehen umgehen, ihnen teilweise nachkommen, sie verachten,<br />
sie ganz anders verstehen, sie vielleicht wegen des Wohlwollens der<br />
Erzieher erfüllen usf., vorbei.<br />
Schließlich: Eine Erfolgsmessung mit eindimensionalen Verhaltenszielen, die es<br />
zu erreichen gilt, oder mit Defiziten, die es abzustellen gilt, stellt immer Kind<br />
oder Jugendlichen mit seinen Fähigkeiten als wesentliche Ursache in den Mittelpunkt,<br />
anders ausgedrückt „Krankheit oder Sünde“ des Klienten. (ebd., 13)<br />
Nicht die Erziehungsplanung oder die einzelnen Interventionen, vielleicht auch<br />
äußere Strukturen und Bedingungen kommen ins Blickfeld, sondern klassisch<br />
der Einzelfall, der seiner eigenen Reparatur im Wege steht, weil er nicht kann<br />
oder nicht will, was als seine Unfähigkeit oder moralische Schwäche behandelt<br />
wird, wenn sich der gewünschte erzieherische Erfolg nicht einstellt. Oft genug<br />
ist das Kind dann nicht mehr bloß das Erziehungsobjekt, sondern in seinen per-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 70
sönlichen Eigenschaften das Hemmnis, das seiner eigenen Besserung entgegensteht.<br />
Ganz sicher aber ist der Erzieher derjenige, der „alles versucht“ hat.<br />
Um nicht in dieses sich selbst reproduzierende Setting zu geraten, stellt Wolf<br />
eine Methode der Evaluation aus Kindersicht gegenüber, die wie aus einem<br />
narrativen Interview aus den Aussagen der Kinder ihre Entwicklungswege rekonstruiert,<br />
und so ein ganz anderes Licht auf ihr Erleben des Heimalltags wirft.<br />
Dass dieses Erleben eine Auseinandersetzung mit den erwünschten Verhaltensweisen<br />
ist und keine eindimensionale Übernahme von Normen, weil Erzieher<br />
sie einfordern, ist dabei nur eine, aber eine notwendige Dimension, um das<br />
wirkliche Erziehungs- und Entwicklungsgeschehen zu beschreiben. (Und vielleicht<br />
ist der wichtigste Gedanke dabei, dass Kinder Erzieher nicht nur als für<br />
sie abgestellte Erziehungsspezialisten betrachten, auch wenn ihnen der funktionale<br />
Charakter dieser Beziehung klar ist, sondern als Menschen, um deren<br />
Zuneigung es ihnen geht.)<br />
Die „sechs Leidensursachen“, die er auf diese Weise ermittelt (Biografische<br />
Brüche, Sanktionen, Funktionalisierung von Beziehungen, Aussonderungsverfahren,<br />
Zukunftshoffnungen und Zukunftsangst sowie Elternbild, ebd. 26) seien<br />
der Diskussion in der Heimerziehung überlassen, für das Gebiet der Dokumentation<br />
und Evaluation sei aber entnommen, dass diese Art der Erhebung, die<br />
nur in Freitextform zu integrieren ist, auch mit dem Standard der IT-gestützten<br />
Dokumentation unbedingt zu vereinbaren ist, will man nicht wesentliche Dimensionen<br />
des Geschehens in der Sozialen Arbeit für die Darstellung und Erfolgsmessung<br />
vernachlässigen.<br />
2. Zum Stand der Implementation von IT-gestützter Dokumentation in der<br />
Sozialen Arbeit<br />
Ich verfolge seit einiger Zeit die Entwicklung von Software, die Soziale Arbeit<br />
dokumentiert. So sehr ich zu Beginn dieser Entwicklung auch fasziniert war von<br />
dieser neuen technischen Erhebungsmöglichkeit und überzeugt, dass sie sich<br />
sehr schnell durchsetzen werde, so sehr sehe ich derzeit einen Bruch, der die<br />
Landschaft kennzeichnet. Auf der einen Seite die Software-Firmen, Mitarbeiter,<br />
die die Entwicklung vorantreiben und einige Fachhochschullehrer – auf der anderen<br />
Seite viele skeptische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen<br />
der Sozialen Praxis und skeptische Studierende. Davon, dass es nur um ein<br />
Generationenproblem ginge, kann heute keine Rede mehr sein. Auch wenn<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 71
sich die Computerliteracy bei den heutigen Studierenden verbessert hat, ist ihre<br />
Zuneigung zu IT-gestützter Dokumentation keineswegs gestiegen. Deswegen<br />
ein kurzes Schlaglicht auf den derzeitigen Stand bei der Einführung von ITgestützter<br />
Dokumentation in der Praxis aus meinem Erfahrungsbereich, um die<br />
Aussagen von Kreidenweis zu erschüttern: „Spätestens gegen Ende dieses<br />
Jahrzehnts wird die elektronische Dokumentation aller Voraussicht nach zum<br />
Standard in nahezu allen Einrichtungsarten gehören.“ (Kreidenweis 2005, 249f)<br />
Eine Jugendhilfe-Einrichtung in einer Großstadt mit vielen einzelnen Stationen,<br />
die schon seit fünf Jahren eine Software eingeführt hat und mit der Firma weiterentwickelt,<br />
überlegt sich, ob sie zur Dokumentation in Form von Excel-<br />
Tabellen zurückkehrt. Verpflichtend eingeführt wurden vor allem Items aus dem<br />
Verwaltungs- und Abrechnungsbereich. Pädagogische Dokumentation wurde<br />
nur in einzelnen Projekten erprobt. Die Akzeptanz der Dokumentation bei den<br />
Mitarbeitern ist nicht hoch, auch wenn es vereinzelte Enthusiasten gibt. Die<br />
Ausstattung macht viele Probleme in dieser dezentralen Organisation. Die Frage<br />
ist, ob sich die Software für den begrenzten Einsatz überhaupt lohnt.<br />
Ein Jugendamt in der Umgebung meiner Fachhochschule, zunächst sehr engagiert<br />
in Modellprojekten und bei der Entwicklung vieler Items Vorbild, hat das<br />
Problem, dass die verwendete Software aufgekauft worden ist. Das Modellprojekt<br />
steht still. Die viele investierte Arbeit war umsonst. Auch wenn die einzelnen<br />
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch interessiert sind, kommen sie an das<br />
Produkt ihrer Entwicklung gar nicht mehr heran. Es herrscht Resignation.<br />
In der Lehre an den Fachhochschulen hat sich nach meinem Erfahrungsausschnitt<br />
IT-gestützte Dokumentation nicht durchgesetzt. In der Konkurrenz der<br />
vielen Teilwissenschaften und Methodenansätze spielt sie weiter eine untergeordnete<br />
Rolle.<br />
Selbst die Grundkenntnisse der Studierenden in den einfachen Anwendungsprogrammen<br />
(Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation und Datenbanken<br />
sowie Internetbrowsern und –recherche) sind oberflächlich. Kenntnisse<br />
in Dokumentation und Evaluation gehören nicht zum Grundkanon. IT-gestützte<br />
Dokumentation wird vom technischen Standard her weitgehend als unrealisier-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 72
ar verstanden. 6 Nur Einzelne, an Informationstechnologie Interessierte, beschäftigen<br />
sich intensiver mit diesem zukunftsträchtigen Thema. 7<br />
Von dieser skeptischen Bilanz nun weiter zu einem kurzen Blick auf die Programme,<br />
deren Entwicklung natürlich von dieser Bilanz betroffen sind und deren<br />
Entwicklung auch unter der finanziellen Situation der Sozialministerien leidet.<br />
3. Aus Programmen, die in der Sozialen Arbeit eingesetzt werden können<br />
Hier ist nicht der Platz, um einen repräsentativen Überblick über den derzeitigen<br />
Stand geben zu können. Ich möchte anhand eines relativ unbekannten Programms<br />
Grundstrukturen, wie die meisten Programmen angelegt sind, den<br />
Inhalten nach darstellen. 8<br />
Dazu gehören im Regelfall als Formulare aufgebaute Screens, deren auszufüllende<br />
Felder oft erweiterbar sind oder ganz durch die Einrichtungen gestaltet<br />
werden können.<br />
3.1 Arbeitsorganisatorische Funktionen wie Kalender, Terminplanung,<br />
Gruppenkalender u.ä.<br />
Hier werden vielfach Funktionalitäten aus den gewohnten Programmen benutzbar<br />
gemacht, so dass zum Beispiel ein Kalender aus Outlook verwendbar ist<br />
oder Email wie Outlook Express mit der Adressenverwaltung aus diesem Programm<br />
verwendet werden kann.<br />
3.2 Das Blatt für die Stammdaten<br />
Diese Datenerfassung variiert in der Darstellung selten (dem Inhalt natürlich<br />
stark nach den verschiedenen Arbeitsfeldern). Namen, Adressen, Angaben zum<br />
Netzwerk der Person, zu Versicherungen u.ä. werden aufgenommen.<br />
Die Programme variieren danach, wie viele Arbeitserleichterungen wie Sozialbericht<br />
auf Knopfdruck u.ä. auf Grundlage der hier erhobenen Daten möglich<br />
sind.<br />
6 Studierende aus dem Hauptstudium meines Fachbereiches, die mit solchen Programmen<br />
konfrontiert waren, kommentierten sie mit „nicht überzeugend, viel zu teuer für die Praxis“ usf.<br />
7 vgl. verschiedene Diplomarbeiten: Fessler 1999, Grahn 2000, Boyer 1998<br />
8 Leider ist auch hier nicht der Ort, die technische Struktur der Programme zu diskutieren, obwohl<br />
das eine sehr sinnvolle Arbeit wäre, um die sparsamsten und zugleich für die Auswertung<br />
effektivsten Datenbankstrukturen zu ermitteln.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 73
Abb. 1: Pädnet Stammdaten<br />
3.3 Daten des Klienten und seiner Entwicklung eingeschlossen Hilfeplanung<br />
und Grad der Zielerreichung<br />
In diesem Bereich liegen die inhaltlich interessanten Kategorien, die auch nach<br />
unterschiedlichem wissenschaftlichen Hintergrund und Konzeption stark variieren.<br />
Variationen liegen vor allem darin, wie viel mit Freitext oder stark vorstrukturierten<br />
Feldern gearbeitet wird.<br />
Das vorliegende Beispiel (vgl. Abb. 2) wählt eine interessante Mischung: Im<br />
Datenfeld wird auf Dokumente verwiesen, die in Freitext verfasst sind. Zugleich<br />
werden die „Kernaussagen“ der Dokumente aufgeführt. Dies zwingt zur kurzen<br />
aussagekräftigen Zusammenfassung und ermöglicht einen schnellen Überblick<br />
über Informationen, ohne ausführliche Texte öffnen zu müssen. Auf der anderen<br />
Seite werden sinnvolle längere Texte eingebunden.<br />
Zunächst geht es um die Diagnose:<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 74
Es folgt ein Hilfeplan, hier Behandlungsplanung genannt:<br />
Abb. 1: Pädnet Diagnose<br />
Abb. 3: Pädnet Behandlungskonzept<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 75
Bei diesem „Behandlungskonzept“ (Abb. 3) ist die Frage nach den Ressourcen<br />
hervorzuheben, sowie die klare Struktur: So wird zur zielorientierten Arbeit angeleitet.<br />
Häufig werden auch quantitative Befunde erhoben (Abb. 4). Allerdings beruhen<br />
sie meistens auf nicht weiter validierten Einschätzungen der Mitarbeiter.<br />
Abb. 4: Pädnet Evaluation<br />
Nur in medizinischen oder heilpädagogischen Bereichen sind objektivere quantitative<br />
Erhebungen integriert.<br />
3.4 Leistungen der Einrichtungen<br />
Manchmal werden die Leistungen der Einrichtung erhoben bis hin zu minutengenauen<br />
Darstellung der Tätigkeiten der Mitarbeiter. Dieser Teil der Software,<br />
der von einem der Pioniere der IT-gestützten Dokumentation „Horizont“ entwickelt<br />
worden ist, versuchte eine Leistungsbeschreibung analog zur Ziffernsystematik<br />
der Ärztegebührenordnung zu gestalten und damit für die Einrichtung<br />
wie für den Kostenträger mehr Transparenz herzustellen.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 76
3.5 Exportfunktionen und Schnittstellen für die Auswertung und Weiterleitung<br />
der Daten<br />
In diesem Bereich geht es darum die Daten für die Auswertung anderen Programmen<br />
zur Verfügung zu stellen. Früher gab es integrierte Auswertungstools,<br />
die sich aber den Bedürfnissen der Praxis gegenüber als zu starr und zu<br />
schwierig zu handhaben, herausgestellt haben.<br />
3.6 PädNet - Ein Versuch systemisches Denken in Software umzusetzen<br />
Zum Schluss sei noch auf eine Besonderheit des vorgestellten Programms<br />
PädNet hingewiesen: Mit der folgenden Grafik versucht dieses Programm erstmals<br />
den in der Praxis sehr verbreiteten Ansatz des systemischen Arbeitens in<br />
eine Software zu integrieren und auch in der Entwicklung abzubilden.<br />
Abb. 5: Systemische Visualisierung<br />
Zwar wird in der Form des Diagramms ansatzweise versucht, ein Netz darzustellen;<br />
und sicherlich kommen alle Akteure auf einmal ins Blickfeld in Bezug<br />
auf bestimmte Fragestellungen. Dennoch ist es eigentlich unredlich, Verbindungslinien<br />
zwischen den verschiedenen eingetragenen Werten zu ziehen.<br />
Welche Verbindung sollte da bestehen?<br />
Vielleicht wird auch daran deutlich, wie viel Entwicklungsbedarf für eine Dokumentation<br />
der Erziehungspraxis noch besteht.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 77
Literatur<br />
Blandow, Jürgen: Dokumentation in der Heimerziehung. Reflexionen über<br />
Sinn und Zweck, Voraussetzungen und Probleme. In: Henes, Trede 2004, S.42-<br />
56<br />
Boyer, Andrea: High-Touch with High-Tech? Some Aspects on the Impact of<br />
Information Technologies in Social Work Counselling. Master Thesis at Gothenburg<br />
University 1998<br />
Fessler, Sven: Computergestützte Dokumentationssysteme in Feldern Sozialer<br />
Arbeit - Grundlagen, Anforderungen, Nutzen und Perspektiven anhand eines<br />
Vergleiches verschiedener Programme. Unveröffentlichte Diplomarbeit an der<br />
Fachhochschule Kiel 1999<br />
Grahn, Wolfram: Der Beratungsprozess in der Sozialen Arbeit und der Einsatz<br />
EDV-gestützter Dokumentationssysteme. Unveröffentlichte Diplomarbeit an der<br />
Fachhochschule Kiel 2000<br />
Henes, Heinz; Trede, Wolfgang: Dokumentation pädagogischer Arbeit. Grundlagen<br />
und Methoden für die Praxis der Erziehungshilfen. Frankfurt am Main<br />
2004<br />
Kreidenweis, Helmut: Die Hilfeplanung im Spiegel ausgewählter Software Produkte.<br />
Expertise Januar 2005, Online im Internet unter:<br />
http://www.dji.de/bibs/209_4520_Expertise-Software.pdf<br />
Kreidenweis, Helmut: IT-gestützte Dokumentation – Entwicklungen, Chancen<br />
und Grenzen moderner Softwaresysteme. In: Henes, Trede 2004, S. 242-250<br />
Moch, Matthias: Wenn Daten für sich sprechen – Fallstricke des Dokumentierens<br />
in pädagogischen Einrichtungen. In: Henes, Trede 2004, S. 57-75<br />
Schmid, Martin: Chancen und Grenzen IT-gestützter Dokumentation am Beispiel<br />
der Drogenhilfe. In diesem Band. 2006<br />
Von Spiegel, Hiltrud: Arbeitshilfen für das methodische Handeln. In: Heiner,<br />
Maja; Meinhold, Marianne; Spiegel, Hiltrud von; Staub-Bernasconi, Sylwia: Methodisches<br />
Handeln in der Sozialen Arbeit. Freiburg i. Brsg. 1994<br />
Wolf, Klaus: Heimerziehung aus Kindersicht als Evaluationsstrategie. In: Sozialpädagogisches<br />
Institut im SOS-Kinderdorf (Hrsg.): Heimerziehung aus Kindersicht.<br />
München 2000 S. 6-39<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 78
Chancen und Grenzen IT-gestützter Dokumentation am Beispiel<br />
der Drogenhilfe<br />
Martin Schmid<br />
Das Drogenhilfesystem in Deutschland ist ein vergleichsweise junges Hilfesystem,<br />
das als Reaktion auf den ansteigenden Drogenkonsum Jugendlicher Ende<br />
der 60er und Anfang der 70er Jahre entstand und seither auf einen rund 35<br />
Jahre andauernden Prozess der Ausdifferenzierung und Professionalisierung<br />
zurückblicken kann (Schmid 2003). Bereits in den 70er Jahren wurde versucht,<br />
ein einheitliches Dokumentationssystem in diesem Hilfesystem einzuführen.<br />
Heute wird in vielen Drogenhilfeeinrichtungen mit moderner Hard- und Software<br />
dokumentiert, und im Vergleich zu anderen Hilfesystemen hat sich ein elaboriertes<br />
Dokumentationssystem entwickelt. Dieser Entwicklungsprozess verlief<br />
allerdings keineswegs gradlinig. Typische Probleme, die an mehreren Stellen<br />
dieses Prozesses auftraten, waren technische Schwierigkeiten auf Seiten der<br />
Soft- und Hardware, die zunächst geringe Akzeptanz für Dokumentation und<br />
organisationsspezifische Probleme. Im Folgenden wird zunächst kurz die Geschichte<br />
der Dokumentation in der Drogenhilfe skizziert. Der aktuelle Stand wird<br />
anhand zweier Beispiele konkretisiert. Schließlich werden die Zielvorstellungen,<br />
die mit der Einführung IT-gestützter Dokumentation in der Drogenhilfe verbunden<br />
waren, zusammengefasst und mit dem bislang Erreichten verglichen.<br />
1. Zur Geschichte IT-gestützter Dokumentation in der Drogenhilfe<br />
Als Ende der 60er Jahre der Konsum von Cannabis und Amphetaminen, später<br />
dann auch von Heroin und Kokain sprunghaft anstieg, wurde die Gesellschaft<br />
mit einer neuen Form von Suchtproblemen konfrontiert. Bestehende Behandlungs-<br />
und Beratungseinrichtungen wie die Psychiatrie, die Medizin, die Jugendhilfe<br />
und die Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen für Menschen mit<br />
Alkoholproblemen waren mit jugendlichen Cannabiskonsumenten und den ersten<br />
Heroinabhängigen überfordert. Das Drogenhilfesystem differenzierte sich in<br />
Deutschland nicht aus dem Gesundheitssystem heraus, sondern entstand als<br />
Mischung aus Teilsegmenten dieser Hilfesysteme mit der Release-Bewegung,<br />
die wiederum mehr mit der Jugendprotestbewegung der 60er und 70er Jahre<br />
verband als mit den etablierten Institutionen des Sozial- und Gesundheitssys-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 79
tems (Schmid 2003). Die ersten Drogenhilfeeinrichtungen – Release-Zentren<br />
und Wohnkollektive – verstanden sich eher als politische Unterstützungsgruppen<br />
für jugendliche Drogenexperimentierer denn als Beratungs- und Therapieangebote.<br />
In diesem Selbstverständnis fand Dokumentation zunächst keinen<br />
Platz.<br />
Die Professionalisierung dieser Einrichtungen vollzog sich in mehreren Schritten.<br />
Von zentraler Bedeutung war dabei, das „Großmodell“ genannte, Bundesmodellprogramm<br />
„Zur Beratung und Behandlung drogen- und alkoholgefährdeter<br />
und -abhängiger junger Menschen“ (Bühringer 1981), das von 1971 bis 1978<br />
dauerte und dem bis zum Jahr 2000 14 weitere Bundesmodellprogramme folgten.<br />
Die Grundidee war dabei immer, in ausgewählten Einrichtungen neue Ansätze<br />
und Angebote zu erproben, diese durch ein wissenschaftliches Institut zu<br />
evaluieren und im Erfolgsfall in das Hilfesystems zu übertragen. Die besondere<br />
Schwierigkeit im „Großmodell“ lag nun darin, dass eine verhaltenstherapeutisch<br />
orientierte Forschergruppe auf Einrichtungen stieß, die einem völlig anderen<br />
Milieu entstammten. Im Rückblick der Forscher liest sich das so: „Die nahe liegende<br />
Idee, in der Anfangszeit der Behandlung von Drogenabhängigen zunächst<br />
einmal therapeutische Konzepte, Strukturen von Einrichtungen, die Zahl<br />
der Mitarbeiter und Klienten sowie die Charakteristika der Klienten zu dokumentieren,<br />
wurde als abwegig bis reaktionär betrachtet“ (Bühringer 1999: 94).<br />
Die Einrichtungen waren zu unterschiedlich und verfügten meist weder über<br />
eine schriftliche Konzeption noch über eine geregelte Form der Aktenführung<br />
oder Statistik. Die geplante vergleichende Therapiestudie konnte unter diesen<br />
Bedingungen nicht durchgeführt werden. Stattdessen entschied sich die „Projektgruppe<br />
Rauschmittelfragen“, den Stand der Entwicklung der einzelnen Einrichtungen<br />
systematisch zu dokumentieren und dazu geeignete Instrumente zu<br />
entwickeln. Parallel dazu wurden „Mindestkriterien“ erarbeitet, denen die Einrichtungen<br />
künftig nachkommen mussten, um weiterhin im Rahmen der Modellförderung<br />
finanziell unterstützt zu werden. Die Mitarbeit am neuen Dokumentationssystem<br />
gehörte zu diesen Mindestkriterien.<br />
Grundlage des Dokumentationssystems war 1974 eine Karteikarte mit 20 Fragen.<br />
Für jeden Klienten mit mehr als einem Kontakt zur Einrichtung sollte eine<br />
solche Karteikarte ausgefüllt werden. 1976 einigten sich zwei Wohlfahrtsverbände<br />
und die „Projektgruppe Rauschmittelabhängigkeit“ auf ein Verfahren, um<br />
mit diesem System einrichtungsübergreifend Klientendaten zu sammeln und<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 80
auszuwerten. In den Einrichtungen wurden die Daten auf den Karteikarten für<br />
jeden Klienten und jede Klientin gesammelt. Am Jahresende wurden alle in der<br />
Einrichtung gesammelten Daten ausgezählt und in aggregierter Form anonymisiert<br />
an die „Projektgruppe Rauschmittelabhängigkeit“ weitergegeben. Dort<br />
wurden dann bundesweite, träger- und einrichtungsspezifische Auswertungen<br />
in Form einfacher Häufigkeitstabellen erstellt. Damit war die Grundlage für das<br />
„Einrichtungsbezogene Informationssystem“ – abgekürzt EBIS – gelegt (Simon<br />
1999).<br />
Vor der Verbreitung des PC führte dieses Verfahren zu umständlichen Auswertungsroutinen:<br />
„Das in den Beratungsstellen verwendete System war noch weit<br />
entfernt von diesen ‚neuen Technologien‘ und im wahrsten Sinne des Wortes<br />
selbstgestrickt. Es basierte auf einer Randlochkarteikarte, auf die während der<br />
Betreuung der KlientInnen die wesentlichen Informationen mittels Ankreuzen<br />
von Alternativkategorien untergebracht werden konnten. Da sich eine zentrale<br />
Auswertung der Karteikarten außerhalb der Beratungsstellen aus Datenschutzgründen<br />
verbot, traf man sich – bei eingeschränktem oder sogar eingestelltem<br />
Publikumsverkehr – am Jahresende ein paar Tage in der Beratungsstelle, um<br />
die Jahresauswertung vorzunehmen. Mit einer Zange wurden dabei die angekreuzten<br />
Stellen der Karten so gelocht, dass – je nach Kategorie – das Loch bis<br />
zum Kartenrand reichte oder nicht. Anschließend wurden alle Karten auf einen<br />
Stapel gelegt und mit einer Stricknadel aufgespießt. Je nach Art der Lochung<br />
blieben nun beispielsweise die männlichen Klienten ‚auf der Nadel hängen’,<br />
während die Frauen vom Spieß herunterfielen und einen neuen Stapel bildeten.<br />
Eine spezielle Auswertungsanleitung sah mehrere 100 Nadelungsvorgänge vor,<br />
in deren Verlauf bis zu 25 verschiedene Stapel gebildet und wieder zusammengeführt<br />
werden mussten. Jeder fallende Kartenstapel wurde gezählt und die<br />
Ergebnisse jeweils in einen Auswertungsbogen übertragen“ (Strobl 1999: 86).<br />
Angesichts dieses Arbeitsaufwandes, der Verknüpfung der Beteiligung an der<br />
Dokumentation mit der Finanzierung und weiterhin bestehenden programmatischen<br />
Differenzen zwischen Forschern und Mitarbeitern in den Einrichtungen<br />
war die Akzeptanz für das neue Dokumentationssystem eher mäßig und die<br />
Kritik daran weit verbreitet. Immerhin konnten bereits Ende der 70er Jahre erste<br />
vergleichende Analysen auf der Grundlage des neuen Dokumentationssystems<br />
durchgeführt werden (Bühringer 1981). In den 80er Jahren stieg die Zahl der<br />
Einrichtungen, die sich an EBIS beteiligten, an, und jährlich wurden aggregierte<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 81
Auswertungen auf Bundesebene publiziert. Insgesamt blieb der Erkenntnisgewinn<br />
aus den EBIS-Daten bescheiden, da die Einrichtungen aus Gründen des<br />
Datenschutzes nur aggregierte Daten weitergaben, so dass statistische Verfahren<br />
nur begrenzt eingesetzt werden konnten. Aussagen zur Anzahl der Klientinnen<br />
und Klienten (z.B. in einer Stadt oder Region) waren nicht möglich, da Personen,<br />
die mehrere Einrichtungen aufgesucht hatten, auch mehrfach dokumentiert<br />
wurden und ein Personencode fehlte. Auch Zeitreihenanalysen waren nur<br />
auf der Grundlage der aggregierten Daten möglich. Doch ungeachtet dieser<br />
Schwierigkeiten verbreitete sich allmählich eine Liste von Erhebungsmerkmalen<br />
in der Drogenhilfe, die damit zum Standard der Dokumentation und wahrscheinlich<br />
auch der Anamnese wurde.<br />
Als 1989 die erste PC-Version von EBIS auf 5 ¼-Zoll-Disketten interessierten<br />
Einrichtungen zur Verfügung gestellt wurde, waren weder die Einrichtungen,<br />
noch das für die Auswertung zuständige Institut „davon überzeugt, dass dies<br />
notwendig oder sinnvoll sei“ (Simon 1999: 40). Fünf Jahre später war das alte<br />
manuelle System aus den Einrichtungen verschwunden und durch die PC-<br />
Version ersetzt. Parallel dazu deutete sich eine neue Entwicklung an: Konkurrenzprodukte<br />
drängten sich auf den Markt, die mit anderen Dokumentationskonzepten,<br />
Itemlisten und Zusatzmodulen ausgestattet waren. Was Brack und<br />
Geisler Ende der 90er Jahre für die Aktenführung in der sozialen Arbeit insgesamt<br />
beobachtet haben, traf in der Drogenhilfe in besonderem Maße (und vielleicht<br />
etwas früher) zu: „Nach jahrelangem relativen Stillstand, ja nach einer<br />
eigentlichen ‚Friedhofsruhe’ im Bereich der Aktenführung sind neue Aktivitäten<br />
festzustellen“ (Brack/Geiser 2000: 13).<br />
Mitte der neunziger Jahre hatte die Debatte um Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung<br />
und neue Steuerungsmodelle die Drogenhilfe erreicht. Dabei wurde<br />
auch das Thema Dokumentation neu aufgegriffen. So nannte z.B. der damalige<br />
Hamburger Drogenbeauftragte Bossong 1995 in einem viel beachteten Vortrag<br />
die Jahresberichte der Drogenhilfeeinrichtungen „lyrisch verklärte Dateninterpretationen“,<br />
die durch „mehr oder weniger populistische Ausführungen zur jeweiligen<br />
Weltsicht“ auffielen, nicht aber erkennen ließen, „zu welchem Problem<br />
welche (passenden oder unpassenden) Maßnahmen mit welchem Erfolg oder<br />
Mißerfolg ergriffen wurden“. Mangels geeigneter Dokumentation „wissen weder<br />
die staatlichen Finanziers, noch die interessierte Fachöffentlichkeit, ja oft nicht<br />
einmal das Team der Kollegen (und vielleicht sogar der Sozialarbeiter am Ende<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 82
selbst nicht), was im Einzelfall geschehen, was warum und in welcher Zeit zum<br />
Erfolg oder zum Misserfolg geführt hat“. Die Informationssysteme in den Einrichtungen<br />
beständen – so Bossong – aus „mehr oder weniger sorgfältig gepflegten<br />
Leitz-Ordnern“ mit „Selbstdarstellungsbroschüren diverser Therapieeinrichtungen“.<br />
Insgesamt sei die Drogenhilfe „in ihrer Organisationsform Lichtjahre<br />
entfernt vom Stand der modernen Dienstleistungstechnik, wie wir sie in der<br />
freien Wirtschaft längst überall als pure Selbstverständlichkeit vorfinden“ (Bossong<br />
1995).<br />
Bossong initiierte in Hamburg einen Modernisierungsprozess, in dessen Verlauf<br />
eine „Rahmenvereinbarung über Qualitätsstandards für die ambulante Suchtund<br />
Drogenarbeit in Hamburg“ zwischen Behörde und Trägern abgeschlossen<br />
wurde. Die Träger verpflichteten sich darin zur Teilnahme an einem komplexen<br />
Dokumentationssystem (der Hamburger Basisdatendokumentation), das teilweise<br />
wissenschaftlichen Analysen, teilweise auch der Leistungsdokumentation<br />
dienen sollte. Dafür übernahm die Behörde die Kosten für die Hard- und Software<br />
und stattete alle ambulanten Drogenhilfeeinrichtungen mit Apple-<br />
Rechnern, Netzwerken und Zubehör aus. Mit der neuen (für Apple-<br />
Betriebssysteme geschriebenen) Klientendokumentationssoftware „Moonlight“<br />
wurde eine neue Dokumentationsphilosophie verfolgt: Im Gegensatz zum damaligen<br />
EBIS konnten jetzt nicht mehr nur Stichtagserhebungen zu einem reduzierten<br />
Datensatz erfolgen, sondern umfangreiche Merkmallisten erlaubten<br />
eine historische und beratungsbegleitende Dokumentation zu Klienten und Leistungen,<br />
bei der alte Einträge nicht überschrieben, sondern fortgeschrieben wurden.<br />
In den Einrichtungen sollte damit die klassische Aktenführung in Papierform<br />
durch eine elektronische Klientenakte abgelöst werden. Eine jährliche<br />
Auswertung auf der Stadtebene sollte Planungsdaten für die Weiterentwicklung<br />
des Hilfesystems liefern. Ein detailliertes Datenschutzsystem und eine einzelfallbezogene<br />
Codierung ermöglichten die Zuordnung mehrerer Datensätze zu<br />
gleichen Personen und damit Aussagen zur Zahl der Klientinnen und Klienten<br />
und fallbezogene Zeitreihenanalysen.<br />
Obgleich bei der Einführung der Hamburger Basisdatendokumentation mehr<br />
Wert auf die Beteiligung von Trägern und Fachkräften aus dem Hilfesystem gelegt<br />
wurde, gab es auch hier zunächst deutliche Akzeptanz-Probleme, die sich<br />
u.a. in den „Missing-data“-Raten der einzelnen Merkmale/Fragen zeigten. Vergleicht<br />
man die jährlichen Auswertungsberichte (im Internet unter<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 83
http://www.bado.de), so zeigt sich, dass der Anteil gültiger Antworten über die<br />
Jahre kontinuierlich angestiegen ist.<br />
Andere Bundesländer zogen nach, und das veraltete EBIS-System bekam jetzt<br />
Konkurrenz durch mehrere EDV-gestützte Dokumentationssysteme, die in der<br />
Drogenhilfe Aktenführung und Monitoring erleichtern sollten. Das neu erwachte<br />
Interesse wurde noch von einer anderen Seite aus unterstützt. 1993 wurde von<br />
der Europäischen Union die Gründung einer zentralen „Europäischen Beobachtungsstelle<br />
für Drogen und Drogensucht“ (European Monitoring Centre for<br />
Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) beschlossen, die bald darauf ihre Arbeit<br />
in Lissabon aufnahm. Zu den Kernaufgaben dieser neuen Institution gehörte es,<br />
in allen Mitgliedsländern vergleichbare Daten zur Drogensituation zu sammeln<br />
und Methoden zu entwickeln, um die Vergleichbarkeit zu erhöhen. Ein wichtiger<br />
Schritt hierzu war die Verabschiedung eines „Treatment Demand Indicator Protocol“<br />
(EMCDDA 2000), das eine europäische „Core Item“-Liste enthält. Alle<br />
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind verpflichtet, Daten zur Drogensituation<br />
in ihren Ländern zu sammeln und an die EMCDDA zu übermitteln.<br />
In Deutschland wurde von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen – der<br />
Dachorganisation aller Träger der Suchthilfe – aus der alten EBIS-Itemliste ein<br />
zu den europäischen Core Items kompatibler Kerndatensatz erarbeitet (DHS<br />
2004), der als Grundlage für die sich immer weiter ausdifferenzierenden landes-<br />
, träger-, einrichtungs- und softwarespezifischen Itemlisten dienen sollte.<br />
Schließlich wurde auch die Software EBIS grundlegend überarbeit und modernisiert.<br />
2. Dokumentation heute<br />
Noch nie war der Stand der Dokumentation in der Drogenhilfe so hoch wie heute.<br />
Auf dem Markt konkurrieren mehrere Softwareprogramme wie z.B. EBIS,<br />
Horizont, Moonlight oder Patfak um die Drogenhilfeeinrichtungen. Diese Programme<br />
sind inzwischen zu komplexen Softwarelösungen angewachsen, deren<br />
Potential längst über das jährliche Dokumentieren einer Basisdatenliste hinausragt.<br />
Neben Modulen zur elektronischen Klientenverwaltung, zur Leistungsdokumentation,<br />
zur Auswertung, zur Abrechnung und zum Datenexport bieten<br />
manche dieser Programme inzwischen Komplettlösungen, die den Arbeitsalltag<br />
in einer Drogenberatungsstelle nahezu komplett abzubilden versuchen.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 84
In den meisten ambulanten und stationären Drogenhilfeeinrichtungen wird inzwischen<br />
mit solchen Programmen gearbeitet. Mehrere Bundesländer veröffentlichen<br />
jährliche Auswertungsberichte (vgl. z.B. Kalke et al. 2005, Neumann<br />
et al. 2005). Auf Bundesebene werden diese Daten beim Institut für Therapieforschung<br />
zusammengeführt und wiederum ausgewertet (vgl. Strobl et al.<br />
2005a und 2005b, Sonntag/Welsch 2004). Schließlich legt die EMCDDA regelmäßige<br />
„Berichte zum Stand der Drogenproblematik in der Europäischen Union<br />
und Norwegen“ vor (Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht<br />
2004). In Ergänzung hierzu gibt es stadtspezifische Auswertungen, trägerbezogene<br />
Analysen, Berichte zu einzelnen Angebotsformen und zunehmend<br />
Jahresberichte von Einrichtungen, die mit ausgefeilten statistischen Darstellungen,<br />
Tabellen und Diagrammen gefüllt sind. Nimmt man hierzu noch die zahlreichen<br />
Forschungsberichte, die aus dem Bereich der Suchtforschung jährlich<br />
publiziert werden, so kann es keinen Zweifel geben: Nie zuvor gab es so viele<br />
Informationen über Menschen mit Drogenproblemen.<br />
Bei den jeweils verwendeten Itemlisten hat sich inzwischen ein hierarchisches<br />
Kompatibilitätsmodell herausgebildet, bei dem jeweils die Kompatibilitätsvorgaben<br />
der übergeordneten Instanz berücksichtigt werden, zusätzliche Items und<br />
Ausdifferenzierungen aber möglich sind. Dieses Konzept ist in der folgenden<br />
Abbildung dargestellt.<br />
Träger- oder einrichtungsspezifische Datensätze<br />
Landesspezifische Datensätze<br />
Deutscher Kerndatensatz<br />
Europäische<br />
Core Items<br />
Abbildung 1: Itemlisten in der Drogenhilfe<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 85
Die Komplexität, die dieses System inzwischen erreicht hat, führt allerdings<br />
auch zu einigen Problemen. So sind beispielsweise Änderungen an einer Itemliste<br />
eine komplizierte Angelegenheit, da die Auswirkungen auf übergeordnete<br />
Itemlisten stets bedacht sein wollen. Auf der Ebene einer Einrichtung ist der<br />
Spielraum nur noch sehr begrenzt. Hinzu kommt der Aufwand, der betrieben<br />
werden muss, um die Daten aus den jeweiligen Softwarepaketen und Landesitemlisten<br />
jeweils korrekt zu exportieren und beim Institut für Therapieforschung<br />
wieder zusammenzuführen. Hierzu wurden inzwischen Schnittstellendefinitionen<br />
und Kompatibilitätsbescheinigungen erstellt. Änderungen am Deutschen<br />
Kerndatensatz müssen von einem speziellen Gremium beschlossen werden,<br />
das auf Kritik an der aktuellen Itemliste (vgl. z.B. Verthein 2005) nur schwerfällig<br />
reagiert.<br />
Um den hier skizzierten Stand der Dokumentation zu ermöglichen, mussten in<br />
den vergangenen Jahren viele Ressourcen in die Entwicklung von Itemlisten,<br />
Manualen, Schulungskonzepten, Leistungskatalogen usw. gesteckt werden.<br />
Angesichts der Komplexität der Materie verwundert es nicht, dass dies meist in<br />
Form von Landes- oder sonstigen Modellprojekten geschah. Im Folgenden<br />
werden zwei solcher Modelle vorgestellt und dabei Ausblicke auf das Potential<br />
einer ausgereiften Dokumentation gegeben, gleichzeitig aber auch Schwierigkeiten<br />
und Probleme beleuchtet werden.<br />
3. Beispiel I: COMBASS<br />
In Hessen begann die Implementierung eines einheitlichen Dokumentationssystems<br />
in der ambulanten Suchthilfe im Jahr 2000. Im Rahmen des Projektes<br />
COMBASS (Computergestützte Basisdokumentation der Suchthilfe in Hessen)<br />
wurden ambulante Suchthilfeeinrichtungen durch das Sozialministerium bei der<br />
Anschaffung zeitgemäßer Computernetzwerke unterstützt. Unter Beteiligung<br />
vieler Fachkräfte aus unterschiedlichen Suchthilfeeinrichtungen wurden mehrere<br />
landesweite Itemlisten zur Klienten-, Einrichtungs- und Leistungsdokumentation<br />
erarbeitet, die – wie oben beschrieben – kompatibel zum deutschen Kerndatensatz<br />
sein mussten, gleichzeitig aber Besonderheiten der hessischen<br />
Suchthilfe berücksichtigen sollten. Da in drei unterschiedlichen Feldern der<br />
hessischen Suchthilfe dokumentiert werden sollte, mussten Itemlisten für jeden<br />
dieser Bereiche erstellt werden, die wiederum in einem Kernbereich vergleichbar<br />
sein sollten. Um eine möglichst standardisierte Dokumentation sicherzustel-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 86
len, wurden Manuale zu diesen Items erarbeitet. Hessenweit wurde eine einheitliche<br />
Dokumentationssoftware eingeführt.<br />
Insbesondere die Erarbeitung der Itemlisten und Manuale führte dazu, dass<br />
eine inhaltliche Diskussion in Gang kam, in deren Verlauf sich die beteiligten<br />
Vertreter der Suchthilfe über ihre Leistungen und Methoden, relevante Klienteneigenschaften,<br />
Indikatoren für Erfolg der Maßnahmen und Fragen der<br />
Anamnese verständigen mussten.<br />
Nach einem gründlichen Auswahlprozess, in dessen Verlauf Anforderungsprofile<br />
erstellt wurden, Anforderungen geprüft und verschiedene Gutachten berücksichtigt<br />
wurden, entschied sich die Steuerungsgruppe des COMBASS-Projektes<br />
für die Software „Horizont“ der Firma ohltec AG. Insgesamt wurden bis zum<br />
Jahr 2004 in 108 Suchthilfeeinrichtungen Horizont-Arbeitsplätze eingerichtet.<br />
Landesgeförderte Einrichtungen erhielten zusätzlich einen Zuschuss zur Hardware.<br />
Nachdem die hessischen Itemlisten in die Software eingearbeitet worden<br />
waren, wurden die Mitarbeiter der Suchthilfe in der Dokumentationssoftware<br />
und in der Handhabung der Itemlisten und Manuale geschult. Zusätzlich wurden<br />
eine Hotline und mehrere Anwenderforen eingerichtet. Die Anwender bemängelten<br />
dabei insbesondere immer wieder die teilweise umständliche Bedienung<br />
der Software. Hinzu kam, dass einzelne Module wie z.B. die Auswertungsprozeduren<br />
Fehler aufwiesen. Im Jahr 2001 meldete schließlich der Entwickler der<br />
Software Insolvenz an. In der „Projektbeschreibung COMBASS“ wird zu den<br />
Folgen dieser Insolvenz ausgeführt: „Die firmeninternen Schwierigkeiten wirken<br />
sich auf Programmentwicklung und Kundenbetreuung aus. Die Zufriedenheit<br />
der Anwender mit dem Service der Firma sinkt“ (Schmidt 2004: 36).<br />
Eine erste Probeauswertung der im Jahr 2002 zusammengeführten Daten wies<br />
auf Probleme mit fehlenden Daten hin. Die Steuerungsgruppe reagierte darauf,<br />
indem die Schulungen und Anwenderforen verstärkt wurden. Bald darauf meldete<br />
auch der neue Eigentümer der Software Insolvenz an. Der Service des<br />
Programmherstellers für die Anbieter verschlechterte sich erneut. In der „Projektbeschreibung<br />
COMBASS“ heißt es dazu: „Die Unterstützung des Programmherstellers<br />
für die Anwender wird mangelhaft. Die Motivation der Anwender<br />
wird auf eine harte Probe gestellt“ (Schmidt 2004: 36).<br />
Eine weitere Probeauswertung der zusammengeführten Daten im Jahr 2003<br />
analysierte Schwachstellen und Eingabefehler. Diese Fehler ließen sich in drei<br />
Gruppen unterteilen: Erstens Fehler wegen schlechter Programmergonomie,<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 87
zweitens Fehler wegen schlechter einrichtungsinterner Kommunikation und drittens<br />
Fehler wegen mangelhafter einrichtungsübergreifender Absprachen und<br />
Konventionen (Schmidt 2004: 37). Wiederum reagierte die Steuerungsgruppe<br />
mit spezifischen Schulungs- und Unterstützungsangeboten. Im selben Jahr<br />
wurde die Software Horizont erneut verkauft. Unter dem neuen Besitzer verbesserten<br />
sich Programmpflege und Kundenservice, wodurch wiederum die<br />
Anwenderzufriedenheit stieg. In den Jahren 2004 und 2005 konnten schließlich<br />
landesweite Auswertungen vorgestellt werden (Kalke et al. 2005). Die Datenqualität<br />
hat sich kontinuierlich verbessert, was laut Auswertungsbericht auf die<br />
inzwischen hohe Akzeptanz und das Projektmanagement zurückzuführen ist<br />
(Kalke et al. 2005: 9).<br />
Finanziert wurde das Projekt COMBASS vom Hessischen Sozialministerium,<br />
das die Hessische Landesstelle für Suchtfragen (HLS) mit der Durchführung<br />
des Projektes beauftragte. Insgesamt floss mehr als eine Million Euro in das<br />
Projekt COMBASS (Schmidt 2004: 34). Darin nicht enthalten sind die laufenden<br />
Kosten für Softwarepflegeverträge, Schulungen neuer Mitarbeiter und Hardware-Aktualisierung,<br />
die von den Einrichtungsträgern übernommen werden.<br />
Mit dem Projekt COMBASS wurden sicherlich eine umfassende Modernisierung<br />
und auch ein erneuter Professionalisierungsschritt für die hessische Suchthilfe<br />
eingeleitet. Die Einrichtungen der Suchthilfe in Hessen arbeiten heute mit einer<br />
modernen Hard- und Softwareausstattung, verfügen über ein differenziertes<br />
und manualisiertes IT-gestütztes Dokumentationssystem, eine moderne Form<br />
der Aktenführung und wissen mehr über ihr Klientel und ihre Leistungen als je<br />
zuvor. Es ist allerdings auch nicht zu verkennen, wie anstrengend der Weg zu<br />
diesem Zwischenstand war.<br />
4. Beispiel II: Die Frankfurter Konsumraumdokumentation<br />
Das zweite Beispiel bezieht sich auf einen Teilbereich der niedrigschwelligen<br />
Drogenhilfe in der Stadt Frankfurt am Main. In Frankfurt gibt es seit mehr als 10<br />
Jahren so genannte Konsumräume, in denen der intravenöse Konsum mitgebrachter<br />
Drogen unter risikoärmeren Bedingungen als auf der Straße oder der<br />
offenen Szene möglich ist. Ursprünglich waren diese Räume für Heroinabhängige<br />
eingerichtet worden. In den letzten Jahren haben sich aber die Konsumpräferenzen<br />
der Drogenabhängigen in Frankfurt deutlich verändert. In Frankfurt<br />
wird seit einigen Jahren zunehmend Crack geraucht und auch injiziert. Wegen<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 88
der pharmakologischen Wirkung dieser Droge hat sich dadurch auch die Situation<br />
in den Konsumräumen verändert. Allerdings war man zur Analyse der Konsumgewohnheiten<br />
in den Konsumräumen auf exemplarische Berichte der Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter angewiesen, da hierzu keine validen Daten vorlagen.<br />
Diese Lücke sollte im Jahr 2002 mit einem neuen Dokumentationssystem<br />
geschlossen werden.<br />
An dem niedrigschwelligen Teil der Drogenhilfe – dazu gehören neben den<br />
Konsumräumen auch Kontaktläden, Krisenzentren, Notübernachtungen und<br />
ähnliche Angebote – ist die Entwicklung von Dokumentationssystemen in der<br />
Suchthilfe bislang weitgehend vorbeigegangen. Dies ist zunächst mit den unterschiedlichen<br />
Arbeitsansätzen begründen. Während in ambulanten Beratungsstellen<br />
schon immer Akten geführt wurden, galt in dem niedrigschwelligen Hilfesegment<br />
das fachlich begründete Prinzip der Anonymität. Niedrigschwellige<br />
Einrichtungen wurden ja gerade für die Drogenabhängigen eingerichtet, denen<br />
die Schwellen zu den Beratungs- und Behandlungsangeboten zu hoch schienen.<br />
Entsprechend unterschiedlich ist auch die Klientel hochschwelliger und<br />
niedrigschwelliger Einrichtungen zusammengesetzt.<br />
Dennoch ist der Bedarf nach Dokumentation in der niedrigschwelligen Drogenhilfe<br />
in den letzten Jahren angestiegen. Dies liegt zum einen daran, dass auch<br />
diese Einrichtungen finanziert werden müssen und zunehmend nachweisen<br />
müsse, welche Leistungen für welche Klienten von diesem Geld erbracht werden.<br />
Aber auch zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung ist Dokumentation<br />
und Evaluation geboten.<br />
Bei der Entwicklung eines Dokumentationssystems für die Konsumräume konnte<br />
das hessenweit eingeführte COMBASS-System nicht übernommen werden.<br />
Dieses System war für die Arbeitsweise eines Konsumraums viel zu zeitintensiv.<br />
Schließlich wurde keine Dokumentation gemäß der Itemliste des deutschen<br />
Kerndatensatzes angestrebt, sondern eine an die Bedingungen der<br />
Niedriggschwelligkeit angepasste, stark verkürzte Itemliste sollte erhoben werden.<br />
Das im Jahr 2002 schließlich eingeführte System beruht auf einem mehrseitigen<br />
Erstbogen, den alle Benutzer eines Konsumraumes beim erstmaligen<br />
Besuch einer solchen Einrichtung in Frankfurt ausfüllen müssen. Hinzu kommt<br />
ein sehr viel kürzerer Folgebogen, der bei jedem weiteren Besuch ausgefüllt<br />
werden muss. Erst- und Folgebogen sind über einen Code verbunden, der die<br />
Anonymität der Klienten schützt, gleichzeitig aber die Zuordnung mehrerer Da-<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 89
tensätze zu einer Person erlaubt. Damit ist es möglich, die Datensätze aus allen<br />
vier Konsumräumen gemeinsam auszuwerten und einerseits Daten zu Konsumvorgängen,<br />
andererseits aber auch Daten zu Personen auszuwerten und<br />
diese zueinander in Beziehung zu setzten. Somit kann analysiert werden, wie<br />
viele Drogenabhängige wie oft welche Konsumräume aufsuchen und welche<br />
Drogen sie dort konsumieren.<br />
Die Mitarbeiter in den Konsumräumen erlebten die Implementierung dieses Dokumentationssystems<br />
wiederum vorrangig als zusätzliche Arbeitsbelastung und<br />
Eingriff in die Anonymität ihrer Klientel. Wie in den zuvor beschriebenen Beispielen<br />
schlugen sich auch in diesem Fall solche Akzeptanzprobleme zunächst<br />
in reduzierter Datenqualität nieder, die sich erst allmählich verbesserte. Inzwischen<br />
liegen auch hierzu detaillierte Auswertungsergebnisse vor (Simmedinger/Vogt<br />
2005, Schmid/Vogt 2005).<br />
Das Dokumentationssystem in den Frankfurter Konsumräumen wurde initiiert<br />
und finanziert vom Gesundheitsdezernat der Stadt Frankfurt am Main. Um in<br />
der Erprobungsphase flexibel vorgehen zu können, wurden beide Erhebungsinstrumente<br />
zunächst in Papierform implementiert. Eine Übertragung in ein ITgestütztes<br />
Dokumentationssystem ist beabsichtigt. Hierzu kann allerdings auf<br />
keines der derzeit am Markt vertretenen Systeme zurückgegriffen werden, da<br />
diese hierzu alle zu groß dimensioniert und kompatibel mit dem deutschen<br />
Kerndatensatz sind. Ideal für die Arbeitssituation in niedrigschwelligen Einrichtungen<br />
wie Konsumräumen wären spezielle Eingabegeräte, die über vereinfachte<br />
Erfassungsmöglichkeiten (Touch-Screen, Scanner) verfügen. Die Entwicklung<br />
solcher spezialisierter Eingabegeräte ist allerdings extrem aufwendig,<br />
so dass auf absehbare Zeit wohl auf Standard-PCs zurückgegriffen werden<br />
muss.<br />
5. Schlussfolgerungen<br />
In diesem Beitrag wurde anhand mehrer Beispiele die Entwicklung von Dokumentationssystemen<br />
in der Drogenhilfe in Deutschland beschrieben. Inzwischen<br />
wird in der Suchthilfe soviel und wohl auch so detailliert, so valide und so<br />
reliabel wie nie zuvor dokumentiert. Der Standard der Dokumentation ist auch<br />
im Vergleich zu anderen psychosozialen Hilfesystemen beeindruckend. Die Akzeptanz<br />
der Dokumentationssysteme durch die Fachkräfte hat sich kontinuierlich<br />
verbessert; Indizien für Akzeptanzprobleme seitens der Klientel gab es nur<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 90
wenige. Insgesamt hat die Weiterentwicklung der Dokumentation für die Drogenhilfe<br />
mehrere Modernisierungs- und Professionalisierungsschübe bedeutet.<br />
Es kann aber auch nicht übersehen werden, dass dieser Prozess mit viel Widerstand,<br />
Enttäuschung und Frustration einherging. Immerhin hat sich die Drogenhilfe<br />
inzwischen Foren geschaffen, auf denen sie im Dialog zwischen Anwendern,<br />
Software-Entwicklern, Politik und Wissenschaft die Weiterentwicklung<br />
der Dokumentation diskutieren kann. Dazu zählt z.B. die jährliche Fachtagung<br />
zur EDV-gestützten Dokumentation in der Suchthilfe, die 2006 bereits zum<br />
sechsten Mal durchgeführt wird (Informationen unter http://www.issfrankfurt.de/tag__edv_doku.htm).<br />
Abschließend sollen drei offene Punkte angesprochen werden: Erstens die Anforderungen<br />
an die Software, zweitens das Verhältnis zwischen Standarddokumentation<br />
und wissenschaftlichen Studien sowie drittens die Frage der Planung<br />
und Steuerung.<br />
1. Die Entwicklung von Dokumentationssoftware in der Drogenhilfe nahm<br />
wie gezeigt ihren Ausgangspunkt von zuvor erarbeiteten Itemlisten.<br />
Letztlich verwundert es nicht, dass die Fachkräfte in den Einrichtungen<br />
das Ausfüllen der entsprechenden Masken meist als zusätzliche Arbeit<br />
empfunden haben. Moderne Software, die sich am „Workflow“, also an<br />
den tatsächlichen Arbeitsabläufen in den Einrichtungen orientiert und<br />
diese unterstützt (Kreidenweis 2004: 65), fehlt hingegen noch weitgehend.<br />
Solche Software zum „IT-unterstützten Counselling“ oder zum „ITgestützten<br />
Case Management“ müsste Assistenten für die Aufnahme, für<br />
das Assessment, für die Hilfeplanung, für die Vermittlung etc. bereithalten,<br />
die den jeweiligen Arbeitsschritten angepasst sind und dazu passende<br />
Module zur Verfügung stellen. Dazu wäre es allerdings erforderlich,<br />
dass die Einrichtungen ihre Schlüsselprozesse kennen und gemeinsam<br />
mit Entwicklern an der Übertragung in EDV-Systemen arbeiten.<br />
Schnittstellen zum Qualitätsmanagement, ein gerne im Zusammenhang<br />
mit Dokumentation erwähnter Begriff, fehlen bislang weitgehend. Da es<br />
immer noch Probleme mit der Ergonomie, mit Auswertungsmodulen, Exportfunktionen<br />
und der Kompatibilität gibt, wäre möglicherweise eine Zertifizierung<br />
geeigneter Software eine sinnvolle Idee.<br />
2. Die bisherigen Dokumentationssysteme in der Drogenhilfe wurden vor<br />
dem Hintergrund unterschiedlicher Erwartungen entwickelt. So geht es<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 91
zum einen darum, den Fachkräften ein praktikables Instrument zur elektronischen<br />
Aktenführung zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig sollten<br />
damit Daten für regionale, bundesweite und europäische Monitoringsysteme<br />
gesammelt werden. Drittens sollten diese Daten für komplexe<br />
Fragestellungen wissenschaftlich ausgewertet werden. Inzwischen muss<br />
darüber diskutiert werden, ob ein solches multifunktionales System sinnvoll<br />
ist. Wissenschaftliche Studien stellen hinsichtlich der Datenqualität<br />
andere Anforderungen als einfache, aber robuste Monitoringsysteme. So<br />
sind z.B. fehlende Daten bei der Auszählung einfacher Indikatoren zu<br />
verschmerzen, während sie für multivariate statistische Analyseverfahren<br />
erhebliche Probleme bedeuten.<br />
3. Eine weitere Begründung für die Implementierung von Dokumentationssystemen<br />
in der Drogenhilfe war in der Vergangenheit stets der Verweis<br />
auf die für rationale Steuerung und Planungsprozesse auf kommunaler,<br />
Landes- und Bundesebene benötigte Datengrundlage. In den letzten<br />
Jahren entstand indes der Eindruck, dass die Steuerungs- und Planungsansprüche<br />
der Politik auf allen diesen Ebenen deutlich zurückgenommen<br />
wurden. Wenn dies stimmt, dann sind daraus wiederum Konsequenzen<br />
für die Dokumentation zu ziehen. Mitarbeiter der Drogenhilfe,<br />
die Daten als Steuerungs- und Planungsgrundlage für Gremien erheben,<br />
die kaum noch Interesse an Steuerung und Planung haben, würden darauf<br />
möglicherweise wieder mit abnehmender Akzeptanz für die Dokumentation<br />
insgesamt reagieren. Bei der Entwicklung von Dokumentationssystemen<br />
für die Drogenhilfe stand lange Zeit das Sammeln von Daten<br />
für aggregierte Auswertungen im Vordergrund. Vielleicht wäre es an<br />
der Zeit, die Gewichtung zwischen den einzelnen Funktionen – Unterstützung<br />
der Fachkräfte beim Beratungsprozess sowie Datenerhebung<br />
für wissenschaftliche Auswertungen, Planung und Steuerung – neu auszutarieren.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 92
Literatur<br />
Bossong, H. (1995): Drogenhilfe als Dienstleistung. In: Hamburgische Landesstelle<br />
gegen die Suchtgefahren (Hg.): Qualitätssicherung in der ambulanten<br />
Suchtkrankenhilfe. Geesthacht (Neuland), 11-29.<br />
Bühringer, G. (1981): Planung, Steuerung und Bewertung von Therapieeinrichtungen<br />
für junge Drogen- und Alkoholabhängige. Ergebnisse einer Modellförderung<br />
des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit. München:<br />
Gerhard Röttger Verlag.<br />
Bühringer, G. (1999): Tops und Flops der letzten Jahre. In: IFT Institut für Therapieforschung<br />
(Hg.): 25 Jahre IFT. 1973 – 1998. Teil 1: Entwicklungen, Erfahrungen,<br />
Einschätzungen. München (IFT), 93-98.<br />
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (2004): Deutscher Kerndatensatz zur<br />
Dokumentation im Bereich der Suchtkrankenhilfe. Definitionen und Erläuterungen<br />
zum Gebrauch (Stand: 03.12.2004). Hamm (im Internet unter<br />
http://www.dhs-intern.de/pdf/DHS_Manual_Kerndatensatz_Sucht.doc)<br />
EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)<br />
(2000) (ed.) co-ordinated by Simon, R. & Pfeiffer, T.: Treatment demand indicator.<br />
Standard protocol 2.0. (EMCDDA Scientific Report). Lissabon: EMCD-<br />
DA.<br />
Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (2004):<br />
Stand der Drogenproblematik in der Europäischen Union und in Norwegen. Lissabon<br />
(EMCDDA, im Internet unter http://www.emcdda.eu)<br />
Kalke, J. et al. (2005): Landesauswertung der Computergestützten Basisdatendokumentation<br />
der ambulanten Suchthilfe in Hessen (COMBASS). Grunddaten<br />
2004. Frankfurt am Main (HLS).<br />
Kreidenweis, H. (2004): Sozialinformatik. Baden-Baden (Nomos).<br />
Neumann, E., Martens, M.-S. & Buth, S. (2005): Ambulante Suchthilfe in<br />
Hamburg. Statusbericht der Hamburger Basisdatendokumentation. Hamburg<br />
(im Internet unter http://www.bado.de).<br />
Schmid, M. & Vogt, I. (2005): Die Nutzung von Konsumräumen in Frankfurt/Main<br />
unter besonderer Berücksichtigung des Konsums von Crack. In:<br />
SUCHT 51 (4), 233-239.<br />
Schmid, M. (2003): Drogenhilfe in Deutschland. Entstehung und Entwicklung<br />
1970-2000. Frankfurt am Main (Campus).<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 93
Schmidt, W. (2004): Projektbeschreibung COMBASS. In: Kloss, M. et al.: Landesauswertung<br />
der Computergestützten Basisdatendokumentation der ambulanten<br />
Suchthilfe in Hessen (COMBASS). Grunddaten 2003. Frankfurt am Main<br />
(HLS), 34-37.<br />
Simmedinger, R. & Vogt, I. (2005): Auswertung der Konsumraumdokumentation<br />
2004. Endbericht. Frankfurt am Main (ISFF).<br />
Simon, R. (1999): Klinische Epidemiologie: EBIS, EBIS und noch einmal EBIS?<br />
In: IFT Institut für Therapieforschung: 25 Jahre IFT. 1973 – 1998. Teil 1: Entwicklungen,<br />
Erfahrungen, Einschätzungen. München (IFT), 35-44.<br />
Sonntag, D. & Welsch, K. (2004): Deutsche Suchthilfestatistik 2003 für ambulante<br />
Einrichtungen. Sucht, 50, Sonderheft 1, 6-31<br />
Strobl, M. et al. (2005a): Suchthilfestatistik 2004 für Deutschland. Tabellenband<br />
für ambulante Einrichtungen. München: IFT (im Internet unter<br />
http://www.suchthilfestatistik.de)<br />
Strobl, M. et al. (2005b): Suchthilfestatistik 2004 für Deutschland. Tabellenband<br />
für stationäre Einrichtungen. München: IFT (im Internet unter<br />
http://www.suchthilfestatistik.de)<br />
Strobl, M. (1999): Die Entwicklung von klinischen Dokumentationssystemen –<br />
ein Drahstseilakt zwischen epidemiologischer Basisdokumentation und multifunktionaler<br />
Klientenverwaltungssoftware. In: IFT Institut für Therapieforschung:<br />
25 Jahre IFT. 1973 – 1998. Teil 1: Entwicklungen, Erfahrungen, Einschätzungen.<br />
München (IFT), 86-92.<br />
Verthein, U. (2005): Dramatischer Anstieg der Opiatabhängigen in 2003! In:<br />
Suchttherapie 6<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 94
Entwicklung eines EDV-gestützten Dokumentationssystems für<br />
das Case Management mit benachteiligten Jugendlichen im<br />
Modellprogramm „Kompetenzagenturen“ 1<br />
Nora Gaupp<br />
1 Sie finden hier lediglich den ersten Teil der Folien des Vortrages vom 24.06.2005 wieder.<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 95
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 96
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 97
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 98
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 99
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 100
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 101
HERAUSGEBER<br />
Helmut Kreidenweis, Diplom-Pädagoge (Univ.), Diplom-Sozialpädagoge (FH),<br />
Professor für Sozialinformatik an der Fakultät für Soziale Arbeit (FHStg.) der<br />
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt; Inhaber der IT-Beratung KI Consult,<br />
Augsburg<br />
helmut.kreidenweis@ku-eichstaett.de<br />
Thomas Ley, Diplom-Sozialpädagoge (FH), Stipendiat im DFG-Graduiertenkolleg<br />
„Jugendhilfe im Wandel“ an der Universität Bielefeld<br />
thomas.ley@uni-bielefeld.de<br />
AUTOREN<br />
Silke Axhausen, Dr. phil, M.A., Professorin für Theorien und methodisches<br />
Handeln in der Sozialen Arbeit am Fachbereich Soziale Arbeit der Fachhochschule<br />
Koblenz<br />
axhausen@fh-koblenz.de<br />
Nora Gaupp, Dr. phil, Diplom-Psychologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am<br />
Deutschen Jugendinstitut (DJI) München im Forschungsschwerpunkt "Übergänge<br />
in Arbeit"<br />
gaupp@dji.de<br />
Hans-Joachim Gehrmann, Dr. phil, Diplom-Volkswirt, Professor für Soziologie<br />
und Sozialpolitik am Fachbereich Sozialpädagogik der Fachhochschule Darmstadt<br />
gehrmann@fh-darmstadt.de<br />
Hans-Jürgen Göppner, Dr. phil., Dipl. Psychologe, Professor für Psychologie<br />
und empirische Methoden an der Fakultät für Soziale Arbeit (FHStg.) der Katholischen<br />
Universität Eichstätt-Ingolstadt<br />
hans.goeppner@ku-eichstaett.de<br />
Harald Mehlich, Dr. phil, Diplom-Soziologe, Professor für Sozialinformatik am<br />
Fachbereich Soziale Arbeit (FHStg.) der Universität Bamberg<br />
harald.mehlich@sowes.uni-bamberg.de<br />
Ursula Mosebach, Dr. phil, Dipl. Pädagogin (Univ.), Dipl. Sozialpädagogin<br />
(FH), Professorin für Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit an der Kath.<br />
Stiftungsfachhochschule München, Abt. Benediktbeuern<br />
mosebach.bb@ksfh.de<br />
Christiane Rudlof, Diplom-Informatikerin, Professorin für Sozialinformatik / U-<br />
sability Engineering an der Fachhochschule Oldenburg, Ostfriesland, Wilhelmshaven,<br />
Abt. Emden<br />
rudlof@fho-emden.de<br />
Martin Schmid, Dr. phil., Diplom-Soziologe, Professor für Soziologie Am Fachbereich<br />
Soziale Arbeit an der Katholischen Fachhochschule Mainz<br />
schmid@kfh-mainz.de<br />
Tagungsband Sozialinformatik in Lehre und Forschung 102