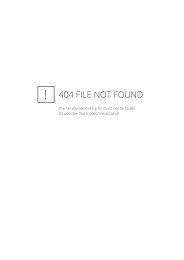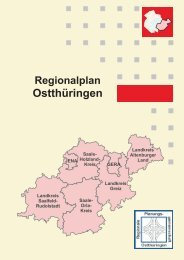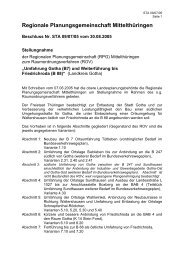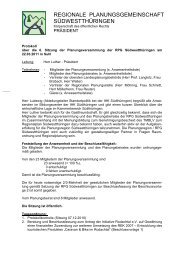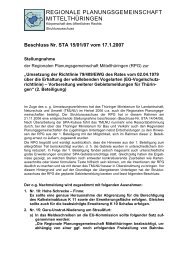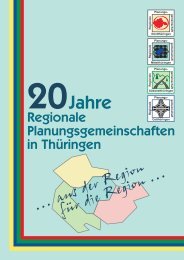Umweltbericht (7,01 MB) - Regionale Planungsgemeinschaften in ...
Umweltbericht (7,01 MB) - Regionale Planungsgemeinschaften in ...
Umweltbericht (7,01 MB) - Regionale Planungsgemeinschaften in ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
20<br />
(Schiefergebirge) stehen vielerorts unter extensiver Grünlandnutzung. Diese Biotopstruktur bietet geeignete Lebensbed<strong>in</strong>gungen<br />
für viele wertvolle Arten, wie z.B. Schwarzstorch, Sperl<strong>in</strong>gskauz, Kreuzotter, Salamander, verschiedene Orchideen,<br />
Arnika u.ä.<br />
Im Gegensatz zu den zentralen Thür<strong>in</strong>ger Gebirgen weist die Thür<strong>in</strong>gische Rhön e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Bewaldung auf (Basalthochfläche:<br />
30 bis 40 %), wobei ca. e<strong>in</strong> Drittel Fichtenforste und zwei Drittel naturnahe montane Buchenwälder s<strong>in</strong>d. Die<br />
anderen Flächen werden überwiegend als Grünland (z.T. Bergwiesen und -weiden) genutzt. Vere<strong>in</strong>zelt treten lokal auch<br />
kle<strong>in</strong>ere Übergangsmoore auf. Die an den Flanken der Hohen Rhön abfließenden Bäche s<strong>in</strong>d sehr blockreich und <strong>in</strong>sgesamt<br />
naturnah ausgebildet. Die besonderen Standortbed<strong>in</strong>gungen der Rhön bieten u.a. das letzte autochthone Mittelgebirgs-Rückzugsgebiet<br />
des Birkhuhnes <strong>in</strong> Deutschland und beheimaten auch endemische Arten (z.B. Rhön-Quellschnecke).<br />
Die Rhön besitzt ebenfalls den Status e<strong>in</strong>es anerkannten Bio-sphärenreservates.<br />
Der Anteil bewaldeter Flächen der Buntsandste<strong>in</strong>hügelländer ist sehr unterschiedlich. In den nord-westlichen Gebieten<br />
(Gerstungen – Bad Salzungen – Breitungen) an den flachen Werratalhängen und <strong>in</strong> den Mulden bzw. Becken dom<strong>in</strong>iert<br />
die landwirtschaftliche Nutzung (Ackerbau). Erst Richtung Südosten gew<strong>in</strong>nen die Wälder an Bedeutung und dom<strong>in</strong>ieren<br />
bei Schleus<strong>in</strong>gen – Hildburghausen wieder den Landschaftsraum. Die vorhandenen Wälder bestehen zum großen Teil<br />
aus Kiefern- und Fichtenbeständen, zum Teil mischen sich Buche und auch Eiche <strong>in</strong> die großen Waldgebiete.<br />
Zu den wertvollen Lebensräumen zählen vor allem die Feuchtgebiete <strong>in</strong> ebenen und muldigen Hochflächenlagen oder<br />
Talgründen, im Nordwesten der Planungsregion z.T. mit auslaugungsbed<strong>in</strong>gten natürlichen Stillgewässern, ansonsten<br />
mit Teichen oder Teichketten und kle<strong>in</strong>flächigen Moorbildungen. Bedeutsam s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong> die lokalen Vorkommen von<br />
Heiden und Sandmagerrasen sowie extensiv genutzte Ackerterrassen und sekundäre B<strong>in</strong>nensalzstellen im Bereich der<br />
Kalihalden (Vacha – Philippsthal, Unterbreizbach). Das besondere Spektrum an Arten bzw. Lebensgeme<strong>in</strong>schaften<br />
reicht <strong>in</strong> den Buntsandste<strong>in</strong>-Hügelländern von dem fleischfressenden Rundblättrigen Sonnentau und der Geme<strong>in</strong>en Geburtshelferkröte<br />
über das Bachneunauge, den größten Zwergstrauchheidenbeständen Thür<strong>in</strong>gens im Bereich des Pleß<br />
bis zu vere<strong>in</strong>zelt auftretenden bodensaueren Eichenmischwäldern.<br />
Kennzeichnend für die Muschelkalkplatten und -bergländer (e<strong>in</strong>schließlich des Bad Liebenste<strong>in</strong>er Zechste<strong>in</strong>gürtels) ist<br />
der hohe Laub- und Mischwaldanteil (überwiegend Buchenwälder und Kieferforste) <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit Grünland (z.B. als<br />
Triften bzw. Huteflächen genutzt) an den steileren Hängen bzw. engen Tälern, durchsetzt von Streuobstwiesen, Wacholderheiden,<br />
Feldgehölzen und Hecken. Die breiteren Täler, flacheren Hänge und Hochflächen werden z.T. auch ackerbaulich<br />
genutzt. Charakteristisch für die Planungsregion s<strong>in</strong>d die oft naturnahen und orchideenreichen Kalk-Buchenwälder<br />
(z.B. um Me<strong>in</strong><strong>in</strong>gen). E<strong>in</strong> Lebensraum mit nationaler Bedeutung ist der Ha<strong>in</strong>ich als größter zusammenhängender<br />
Kalk-Buchenwald <strong>in</strong> Deutschland. Von besonderer Bedeutung im Muschelkalk s<strong>in</strong>d außerdem die trockenen Gras- und<br />
Felsfluren (Kalktrocken-/-halbtrockenrasen), die durch langjährige extensive Weidewirtschaft entstanden s<strong>in</strong>d und e<strong>in</strong>er<br />
Vielzahl seltener Arten Lebensraum bieten. Im Kontakt mit diesen Biotopen stehen oft die an sonnenexponierten Steilhängen<br />
vorkommenden Trockenwälder. Verkarstungen, Quellaustritte (Karstquellen) und Kalkquellmoore bilden zusätzliche<br />
Lebensraumstrukturen. Die neben den großen zusammenhängenden Waldgebieten oft kle<strong>in</strong>räumig strukturierte, kulturbestimmte<br />
Landschaft bildet mit dem eng verzahnten Mosaik unterschiedlichster Biotoptypen die Grundlage für e<strong>in</strong>e<br />
hohe Artenvielfalt. Außer e<strong>in</strong>er Vielzahl an Orchideen (z.B. Frauenschuh, Knabenkräuter, Ragwurze u.a.) s<strong>in</strong>d z.B. noch<br />
Vorkommen der Eibe und mehrer Arten der Mehlbeere erhalten geblieben. Die Fauna reicht von waldgebundenen Arten<br />
wie Spechten, Fledermäusen oder der seltenen Wildkatze (Ha<strong>in</strong>ich) bis zu Arten der offenen oder halboffenen, trockenen<br />
Landschaft, wie z.B. Kreuzotter, Glattnatter oder Zauneidechse.<br />
Das Ackerhügelland (Grabfeld und westlicher Ausläufer des Innerthür<strong>in</strong>ger Ackerhügellandes) weist im Wesentlichen e<strong>in</strong>e<br />
großflächige <strong>in</strong>tensive landwirtschaftliche Nutzung auf (ca. 70 %). Der relative Strukturreichtum (gegenüber dem zentralen<br />
Thür<strong>in</strong>ger Becken) resultiert aus e<strong>in</strong>em höheren Anteil an Wäldern (Buchenwälder, wärmebegünstigte Eichen-/Eichen-Ha<strong>in</strong>buchenwälder,<br />
Kiefern- und Fichtenforsten) besonders auf den Keuperhügeln (teilweise mit Basaltkuppen im<br />
Grabfeld), artenreichen Trocken- und Halbtrockenrasen (z.B. Schlechtsarter Schweiz) sowie den kle<strong>in</strong>eren Talauen und<br />
feuchten Niederungen mit Wiesen und Weiden. Vere<strong>in</strong>zelt s<strong>in</strong>d auch naturnahe Bäche mit angrenzenden Bachauenwäldern<br />
erhalten geblieben. Diese kont<strong>in</strong>ental getönten Gebiete s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere für e<strong>in</strong>e artenreiche Ackerwild- bzw.<br />
Steppenkrautflora von Bedeutung (z.B. Flammen-Adonisröschen). Die noch naturnahen <strong>in</strong> den Ma<strong>in</strong> entwässernden Bäche<br />
des Grabfeldes beherbergen die Bachmuschel sowie die e<strong>in</strong>zigen Thür<strong>in</strong>ger Vorkommen des Ste<strong>in</strong>krebses.<br />
Naturnahe Auenlandschaften mit ausgeprägter Auendynamik s<strong>in</strong>d nur noch <strong>in</strong> Resten vorhanden. Der Flusslauf der Werra<br />
selbst ist noch als naturnah zu bezeichnen (Mäandrierung). Die Werraaue wird überwiegend besonders <strong>in</strong> den tiefer<br />
liegenden Talbereichen als Grünland sonst auch als Ackerland genutzt. Die Struktur anreichernd s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der eher ausgeräumten<br />
Aue die Gehölzbestockungen der Fließgewässer, Altwässer sowie ehemalige und jetzt aufgelassene Kiesgruben.<br />
In Resten existieren auch noch Röhrichte, Hochstaudenfluren und artenreiche Feuchtwiesen. Von Bedeutung s<strong>in</strong>d<br />
ferner die mehrfach auftretenden B<strong>in</strong>nensalzstellen, z.T. natürlich, meistens aber anthropogenen Ursprunges. Auf ihnen<br />
bildet sich e<strong>in</strong>e lokale Halophytenflora (z.B. Strand-Milchkraut). Die ausgedehnten Grünländer s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere bei naturnaher<br />
Ausbildung und <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit den unterschiedlich strukturierten Gewässertypen die Voraussetzungen für<br />
die besondere avifaunistische und amphibische Lebensraumeignung und die überregionale Bedeutung der Werraaue,<br />
was sich u.a. <strong>in</strong> wichtigen Vorkommen von Weißstorch, Blaukehlchen, Wachtelkönig, Bekass<strong>in</strong>e, Gelbbauchunke und<br />
Kreuzkröte ausdrückt. Im Gegensatz dazu besitzt die Ste<strong>in</strong>achaue e<strong>in</strong>en deutlich höheren Anteil an ackerbaulich genutzter<br />
Fläche, ist aber im unmittelbaren Flussbett und im Bereich der Zuflüsse (z.B. Föritz) durch e<strong>in</strong> eng abwechselndes<br />
Biotopmosaik aus Hochstaudenfluren, Auwaldrestflächen, Feuchtwiesen, Teiche, Kiesgruben u.ä. kle<strong>in</strong>teiliger struktu-<br />
<strong>Umweltbericht</strong> zum Regionalplan Südwestthür<strong>in</strong>gen