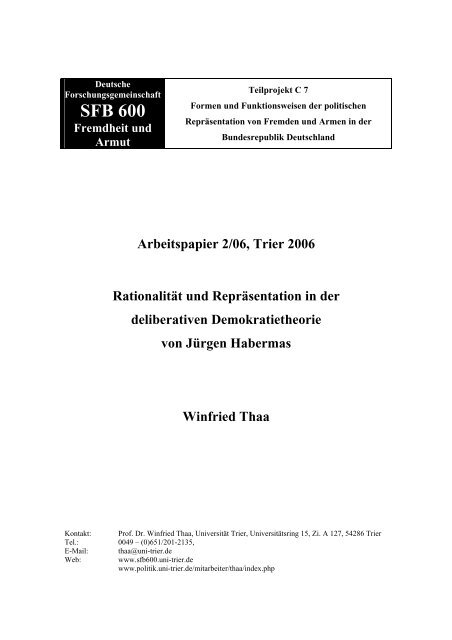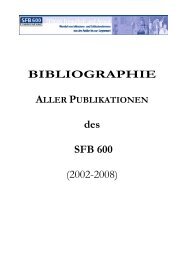SFB 600 - Fremdheit und Armut - Universität Trier
SFB 600 - Fremdheit und Armut - Universität Trier
SFB 600 - Fremdheit und Armut - Universität Trier
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Deutsche<br />
Forschungsgemeinschaft<br />
<strong>SFB</strong> <strong>600</strong><br />
<strong>Fremdheit</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Armut</strong><br />
Teilprojekt C 7<br />
Formen <strong>und</strong> Funktionsweisen der politischen<br />
Repräsentation von Fremden <strong>und</strong> Armen in der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland<br />
Arbeitspapier 2/06, <strong>Trier</strong> 2006<br />
Rationalität <strong>und</strong> Repräsentation in der<br />
deliberativen Demokratietheorie<br />
von Jürgen Habermas<br />
Winfried Thaa<br />
Kontakt: Prof. Dr. Winfried Thaa, Universität <strong>Trier</strong>, Universitätsring 15, Zi. A 127, 54286 <strong>Trier</strong><br />
Tel.: 0049 – (0)651/201-2135,<br />
E-Mail: thaa@uni-trier.de<br />
Web: www.sfb<strong>600</strong>.uni-trier.de<br />
www.politik.uni-trier.de/mitarbeiter/thaa/index.php
2<br />
Rationalität <strong>und</strong> Repräsentation in der deliberativen Demokratietheorie<br />
von Jürgen Habermas<br />
von Winfried Thaa<br />
1. Selbstverständnis <strong>und</strong> normativer Anspruch der deliberativen<br />
Demokratietheorien<br />
Der Begriff der deliberativen Demokratie ist zwar neu, Deliberation oder öffentliche<br />
Beratung bildete jedoch immer schon ein wichtiges Moment der Demokratie.<br />
Dies gilt bereits für die Versammlungsdemokratie der griechischen Polis, in<br />
der nach Aristoteles der Bürgerstatus durch den Zutritt zur Teilnahme an der<br />
beratenden Staatsgewalt definiert war (Aristoteles 1275b5-20). Es gilt in anderer<br />
Weise aber auch für die Demokratien der Neuzeit, deren Theoretiker das Repräsentationsprinzip,<br />
ihre bedeutendste Innovation gegenüber der Antike, nicht zuletzt<br />
mit der Läuterung <strong>und</strong> Verallgemeinerung der unreflektierten Meinungen<br />
<strong>und</strong> Interessen des Volkes in den Beratungen freier, nicht an Weisungen geb<strong>und</strong>ener<br />
Abgeordneter rechtfertigen. 1 Dennoch bildete sich ein eigenes deliberatives<br />
Verständnis von Demokratie, das seine Vertreter sowohl gegenüber liberalen <strong>und</strong><br />
republikanischen als auch gegenüber elitären <strong>und</strong> direkt-partizipatorischen Demokratiekonzeptionen<br />
abgrenzen, erst vor weniger als zwei Jahrzehnten heraus.<br />
Gemeinsam verstehen die verschiedenen deliberativen Demokratietheorien<br />
unter Deliberation zunächst einmal die öffentliche, möglichst alle Betroffenen<br />
einschließende Beratung über Streitfragen <strong>und</strong> gemeinsame Probleme. 2 In Abgrenzung<br />
zu anderen Demokratietheorien wird der Kern der demokratischen Legitimation<br />
von Entscheidungen nicht in der Aggregation von Interessen oder dem<br />
Willen eines Kollektivsubjektes, sondern in ihrer Rückführung auf eine alle inkludierende,<br />
argumentativ geführte Beratung gesehen. Bernard Manin formuliert<br />
kurz <strong>und</strong> knapp:<br />
1<br />
2<br />
Vgl. etwa Federalist No.10 <strong>und</strong> No. 71, in: Hamilton/Madison/Jay 2000.<br />
Eine einfache Definition findet sich bei Cohen 1989: „By a deliberative democracy I shall<br />
mean, roughly, an association whose affairs are governed by the public deliberation of its<br />
members.” (Cohen 1989: 17).
3<br />
„A legitimate decision does not represent the will of all, but is one<br />
that results from the deliberation of all“ (Manin 1987: 352). 3<br />
Ungeachtet der genaueren Bestimmung des deliberativen Prozesses gilt er zudem<br />
als Alternative zur Übertragung des Marktmodells <strong>und</strong> seiner ökonomischen<br />
Rationalität auf den Bereich demokratischer Politik. An die Stelle der Konkurrenz<br />
unter strategisch handelnden Akteuren soll eine Verständigungspraxis unter<br />
Gleichen treten. Deliberation verlangt von den Teilnehmern nicht nur die argumentative<br />
Begründung der eigenen Position, sondern auch die Berücksichtigung<br />
anderer, ihr entgegenstehender Positionen. Damit enthält sie zumindest die Möglichkeit<br />
einer zwanglosen Verständigung, wie auch immer diese genauer bestimmt<br />
sein mag. Als Konsens oder als ein begründetes Urteil der Mehrheit unterscheidet<br />
sich das Ergebnis der Deliberation gr<strong>und</strong>sätzlich von einem Kompromiss,<br />
der ja nicht auf der Zustimmung zu argumentativen Begründungen basiert,<br />
sondern lediglich einen für die Beteiligten akzeptablen Ausgleich zwischen<br />
gegensätzlich bleibenden Interessen oder Meinungen darstellt.<br />
Wie wir im einzelnen noch sehen werden, sind deliberative Theorien in mehrfacher<br />
Hinsicht normativ. Insbesondere aber enthalten sie zwei Versprechen, mit<br />
denen sie an die Tradition der Aufklärung anschließen:<br />
Zum einen beerben sie den republikanischen Anspruch auf Selbstregierung<br />
unter den spezifisch neuzeitlichen Bedingungen der Säkularisation <strong>und</strong> der politischen<br />
Gleichheit. Im deliberativen Verständnis ist Politik ein Bereich der bewussten<br />
Einwirkung der Gesellschaft auf sich selbst, in dem sich durch die Praxis<br />
öffentlicher Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung die kollektive Autonomie der Bürger<br />
verwirklicht. Unumstritten ist dabei, dass kollektives politisches Handeln ein<br />
Ausdruck von Selbstbestimmung sein kann, umstritten ist allerdings, wie das<br />
Spannungsverhältnis zwischen individueller <strong>und</strong> kollektiver Autonomie gelöst<br />
oder zumindest akzeptabel organisiert werden kann. Dessen ungeachtet verschieben<br />
sich mit der Verortung kollektiver Autonomie in der Praxis öffentlicher Be-<br />
3<br />
Ähnlich James Bohman: „Deliberative democracy, broadly defined, is thus any one of a<br />
family of views according to which the public deliberation of free and equal citizens is the<br />
core of legitimate political decision making and self-government“ (Bohman 1998: 401).<br />
Spezifischer <strong>und</strong> den Vernunftbegriff einschließend definiert Seyla Benhabib Demokratie<br />
„als eine Organisationsform kollektiver <strong>und</strong> öffentlicher Machtausübung in den wichtigsten<br />
Institutionen einer Gesellschaft..., <strong>und</strong> zwar auf der Gr<strong>und</strong>lage des Prinzips, dass Entscheidungen,<br />
die das Wohlergehen einer Gesellschaft betreffen, als das Ergebnis einer freien <strong>und</strong><br />
vernünftigen Abwägung unter Individuen gesehen werden können, die als moralisch <strong>und</strong><br />
politisch Gleiche betrachtet werden“ (Benhabib 1995: 4).
4<br />
ratung die Verwirklichungsbedingungen politischer Gleichheit von der Teilnahme<br />
an Entscheidungen, insbesondere also von Abstimmungen <strong>und</strong> Wahlen nach<br />
dem Prinzip „one man/person - one vote“, auf die Prinzipien <strong>und</strong> Verfahren der<br />
Deliberation, die eine Inklusion aller von einer Entscheidung potentiell Betroffenen<br />
ermöglichen sollen.<br />
Zum zweiten erheben deliberative Demokratietheorien den Anspruch, deliberative<br />
Verfahren produzierten vernünftigere Ergebnisse als eine von marktanalogen<br />
Mechanismen hervorgebrachte Resultante individueller Entscheidungen oder<br />
die politische Dezision der Inhaber von Herrschaftspositionen. Die Inklusion aller<br />
von einer Entscheidung Betroffenen bzw. der von ihnen vertretenen Standpunkte<br />
<strong>und</strong> das Argumentieren als einzig angemessenes Mittel der Auseinandersetzung<br />
sollen die ursprünglich eingebrachten Präferenzen transformieren <strong>und</strong><br />
auf ein höheres Niveau der Verallgemeinerbarkeit heben. Dieser Vorgang lässt<br />
sich auch als „moralisierender Effekt“ der Beratungen verstehen. 4 Selbst wenn<br />
am Ende eines deliberativen Prozesses kein Konsens steht, soll die Mehrheitsentscheidung,<br />
die danach getroffen wird, eher einem begründeten Urteil ähneln als<br />
der Aggregation von Interessen oder einem ausgehandelten Kompromiss.<br />
Als Ergebnis eines deliberativen Prozesses kommt politischen Entscheidungen<br />
demnach demokratische Legitimität <strong>und</strong> Rationalität zugleich zu. Allerdings<br />
unterscheiden sich die deliberativen Demokratietheorien beträchtlich hinsichtlich<br />
des erkenntnistheoretischen <strong>und</strong> moralischen Status, den sie einer derartigen öffentlichen<br />
Beratung zuschreiben. Auf der einen Seite steht etwa Benjamin Barber,<br />
der zwischen kognitiven <strong>und</strong> politischen Urteilen strikt unterscheiden will.<br />
In seinem Modell einer „starken Demokratie“ weist er der Deliberation als gemeinsamem<br />
Sprechen <strong>und</strong> Zuhören zwar die zentrale Funktion zu, ursprünglich<br />
private Präferenzen zu transformieren <strong>und</strong> so erst die Gr<strong>und</strong>lage für ein gemeinsames<br />
politisches Handeln zu schaffen. Er will diese Funktion jedoch dezidiert<br />
nicht erkenntnistheoretisch oder moraltheoretisch verstehen, um die demokratische<br />
Politik nicht einem vorausgehenden „Fo<strong>und</strong>ationalism“ zu unterstellen. 5<br />
Auf der anderen Seite Ende des Spektrums steht in dieser Frage die diskurstheoretische<br />
Begründung deliberativer Demokratie durch Jürgen Habermas. Aus dieser<br />
Perspektive soll die deliberative Neubestimmung der Demokratie ihre Bin-<br />
4<br />
5<br />
Die Erwartung auf eine Rationalisierung individueller Präferenzen im Sinne höherer Verallgemeinerungsfähigkeit<br />
im „Forum“ der Deliberation betont etwa Bernard Manin (1987:<br />
358f.). Von einem ‚moralisierenden Effekt’ öffentlicher Diskussionen spricht David Miller<br />
(Miller 1992: 61f.).<br />
Vgl. dazu Barber 1994 <strong>und</strong> spezifischer 1993. Knapp bringt Barber dies auf die Formel:<br />
„Democratic politics is what men do when metaphysics fail“ (ebd.: 35).
5<br />
dung an eine kollektiv handlungsfähige Bürgerschaft überwinden <strong>und</strong> die Vorstellung<br />
eines sich selbst bestimmenden gesamtgesellschaftlichen Subjekts durch<br />
das Ideal einer prinzipiell unabschließbaren Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung in<br />
einer dezentrierten Gesellschaft ersetzen. 6 Die Volkssouveränität verflüssigt sich<br />
<strong>und</strong> „zieht sich in die gleichsam subjektlosen Kommunikationskreisläufe von<br />
Foren <strong>und</strong> Körperschaften zurück“ (Habermas 1992: 170). Durch die diskurstheoretische<br />
Begründung der Prinzipien <strong>und</strong> Verfahren der Deliberation gewinnen<br />
ihre Ergebnisse im Gegensatz zur ersten Position einen epistemischen Anspruch<br />
analog zu dem auf propositionale Wahrheit <strong>und</strong> normative Richtigkeit.<br />
Im Folgenden werde ich mich mit der diskurstheoretischen Begründung deliberativer<br />
Demokratie durch Jürgen Habermas beschäftigen, <strong>und</strong> zwar nicht nur,<br />
weil sie die internationalen Debatten über eine deliberative Umdeutung der Demokratie<br />
dominiert. Inhaltlich begründet sich diese Konzentration auf Habermas<br />
damit, dass gerade sein kognitivistisches Verständnis von Deliberation, also die<br />
Orientierung politischer Willensbildung am Ideal intersubjektiver wissenschaftlicher<br />
Erkenntnisprozesse, höchste Inklusionsansprüche erhebt. Zugleich löst sie<br />
die Kriterien für die Inklusivität <strong>und</strong> die demokratische Qualität von Beratungen<br />
weitgehend von den konkreten Beziehungen <strong>und</strong> Handlungsstrukturen zwischen<br />
Repräsentanten <strong>und</strong> Repräsentierten <strong>und</strong> verlagert sie auf die Qualität der Beratungen.<br />
Genau in dieser Verlagerung aber liegt ein neuer Exklusionsmechanismus<br />
deliberativer Demokratietheorien.<br />
Um dies zu zeigen werde ich zunächst in groben Zügen auf ihre diskurstheoretische<br />
Begründung eingehen (2.), das Verhältnis von Inklusion <strong>und</strong> Repräsentation<br />
diskutieren (3.) sowie den Wahrheits- <strong>und</strong> Rationalitätsanspruch praktischer<br />
Diskurse darstellen (4.). Im Anschluss daran thematisiere ich dann die Ausdifferenzierung,<br />
<strong>und</strong>, wenn man so will, „Politisierung“ der Diskurstheorie in Habermas’<br />
Theorie des demokratischen Rechtsstaates (5.). Im Mittelpunkt steht dabei<br />
die Frage, ob sein Abrücken von einer unmittelbaren Anwendung der Diskursethik<br />
auf demokratische Politik eine adäquate Konzeptualisierung von Pluralität<br />
<strong>und</strong> Handlungskontingenz ermöglicht. Die negative Antwort auf diese Frage (6.<br />
<strong>und</strong> 7.) wird dann mit Habermas’ Festhalten an einem reflexionsmoralischen Autonomieprinzip<br />
<strong>und</strong> dem damit einhergehenden Verständnis von Repräsentation<br />
als Einheitsrepräsentation erklärt (8.). Schließlich werde ich zeigen, dass der<br />
Versuch, die seit der amerikanischen Verfassungsdiskussion im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
im Mittelpunkt des Selbstverständnisses westlicher Demokratien stehende Pluralisierung<br />
der Volkssouveränität durch ihre Prozeduralisierung im vernünftigen<br />
6<br />
Vgl. dazu etwa Habermas 1992: 361f <strong>und</strong> 1996: 287f.
6<br />
Diskurs zu ersetzen, politische Handlungsmöglichkeiten beschränkt, kontingente<br />
Entscheidungen durch vermeintlich sachliche Problemlösungen ersetzt sowie<br />
Mitgliedschaften <strong>und</strong> die daraus resultierenden Solidaritätsansprüche schwächt<br />
(9.-11.). Zusammenfassend beziehe ich diese Bef<strong>und</strong>e dann auf die Möglichkeiten<br />
der Repräsentation schwacher Interessen (12.).<br />
2. Gr<strong>und</strong>züge eines diskurstheoretischen Verständnisses der Demokratie<br />
Die gr<strong>und</strong>legende Annahme der Diskursethik besagt, dass wir über die Richtigkeit<br />
moralischer Handlungsnormen wie über die Wahrheit propositionaler Aussagen<br />
durch den „zwanglosen Zwang des besseren Argumentes“ (Habermas<br />
1984: 161) ein rational motiviertes Einverständnis erzielen können. 7 Mit dem<br />
Universalisierungsgr<strong>und</strong>satz stehe „eine Argumentationsregel zur Verfügung ...,<br />
die die rationale Entscheidung moralisch-praktischer Fragen ermöglicht“ (Habermas<br />
1992: 193). Diese Annahme folgt aus einer von der pragmatischen<br />
Sprachphilosophie ausgehenden Umformulierung der Begriffe von Wahrheit <strong>und</strong><br />
Rationalität durch Apel <strong>und</strong> Habermas, dem sog. „pragmatic turn in der Kritischen<br />
Theorie“ (Benhabib 1995a: 421). Demzufolge sind sowohl propositionale<br />
Wahrheit als auch normative Richtigkeit nur mehr intersubjektiv, das heißt durch<br />
das argumentative Überprüfen von Geltungsansprüchen, festzustellen. Dazu dient<br />
der Diskurs, der vereinfacht <strong>und</strong> in einer ersten Annäherung als eine durch Argumentation<br />
gekennzeichnete Form der Kommunikation definiert ist, an der<br />
prinzipiell alle Betroffenen teilnehmen <strong>und</strong> problematische Geltungsansprüche<br />
überprüfen können.<br />
Mit seiner diskurstheoretischen Begründung deliberativer Demokratie überträgt<br />
Habermas diese Konsenstheorie der propositionalen Wahrheit <strong>und</strong> der normativen<br />
Richtigkeit, also das Ideal der Argumentationspraxis einer Gelehrtenrepublik,<br />
auf den politischen Prozess. 8 Die Diskursethik wird zu einer Theorie der<br />
politischen Legitimität. Auch wenn Habermas seit den neunziger Jahren zugesteht,<br />
dass die unvermittelte Anwendung der Diskursethik auf den demokratischen<br />
Prozess zu Ungereimtheiten führt (Habermas 1992: 196), misst er ihn doch<br />
weiterhin an der argumentativen Auseinandersetzung über Geltungsansprüche.<br />
Legitimierend ist der demokratische Prozess demnach nicht im Sinne der Selbst-<br />
7<br />
8<br />
Vgl. etwa auch Habermas 1981: 71.<br />
So etwa explizit in Habermas 1992: 30ff., wo Habermas den Anspruch erhebt, das von Charles<br />
Peirce stammende Modell der Argumentationspraxis einer Gelehrtenrepublik ließe sich<br />
über die kooperative Wahrheitssuche von Wissenschaftlern hinaus auch auf die kommunikative<br />
Alltagspraxis beziehen.
7<br />
regierung eines Demos durch Anwendung des Mehrheitsprinzips, sondern als<br />
öffentlicher Vernunftgebrauch. Um demokratische Entscheidungen als Verkörperung<br />
von Vernunft sehen zu können, muss Habermas mit der Vernunftkritik der<br />
früheren Kritischen Theorie brechen. In Abgrenzung zum instrumentell verengten<br />
Rationalitätsbegriff, den Horkheimer <strong>und</strong> Adorno mit Weber teilen, unterstellt<br />
er der Moderne die evolutionäre Entfaltung einer kommunikativen, auf der<br />
freiwilligen Zustimmung zu Geltungsansprüchen basierenden Vernunft. 9 Dies<br />
ermöglicht es ihm, die demokratisch-rechtsstaatlichen Institutionen westlicher<br />
Gesellschaften als Ergebnis einer solchen Evolution zu verstehen <strong>und</strong> ihren Vernunftgehalt<br />
theoretisch zu rekonstruieren. Spezifischer geht es in seinem Verständnis<br />
deliberativer Demokratie darum, die Idee der Volkssouveränität rationalistisch<br />
umzudeuten, so dass an die Stelle eines letztlich willkürlich entscheidenden<br />
gesamtgesellschaftlichen Subjektes „subjektlose Kommunikationsformen“<br />
treten, „die den Fluß der diskursiven Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung so regulieren,<br />
dass ihre falliblen Ergebnisse die Vermutung der Vernünftigkeit für sich haben“<br />
(Habermas 1996: 291).<br />
Habermas begründet diese Neuformulierung des Souveränitätsbegriffes durch<br />
einen intersubjektivistischen Vernunftbegriff, mit dem er bewusstseinsphilosophische<br />
Denkfiguren verabschieden will. Unter den Prämissen der Bewusstseinsphilosophie<br />
ließen sich nämlich Vernunft <strong>und</strong> Wille nur in einem Einzelsubjekt<br />
zusammenführen. Dies habe zur Folge, die Selbstbestimmungspraxis der Bürger<br />
entweder einem übermächtigen gesamtgesellschaftlichen Großsubjekt, dem Volk<br />
oder der Nation zuzuschreiben, oder aber sie in die blinde Resultante der Entscheidungen<br />
konkurrierender Einzelsubjekte aufzulösen. 10 Demgegenüber soll<br />
die „höherstufige Intersubjektivität von Verständigungsprozessen“ in Körperschaften<br />
<strong>und</strong> öffentlichen Foren eine kommunikativ erzeugte Macht hervorbringen,<br />
die durch Gesetzgebung in administrative Macht umgeformt wird. 11 Die<br />
Volkssouveränität verdichte sich „nicht mehr in einem Kollektiv, nicht mehr in<br />
der physisch greifbaren Präsenz der vereinigten Bürger oder ihrer versammelten<br />
Repräsentanten“, sondern sie komme in der „Zirkulation vernünftig strukturierter<br />
Beratungen <strong>und</strong> Entscheidungen“ zur Geltung (Habermas 1992: 170). Habermas<br />
spricht darauf bezogen auch von einem prozeduralistischen, in Abgrenzung zu<br />
einem substantialistischen Verständnis von Volksouveränität. Das zweite beziehe<br />
Freiheit wesentlich auf die „äußere Unabhängigkeit der Existenz eines Volkes“,<br />
9<br />
10<br />
11<br />
Vgl. dazu Habermas 1981, insbes. Band 1.<br />
Vgl. dazu Habermas 1992: 133f <strong>und</strong> 362.<br />
Vgl. dazu Habermas 1992: 362 f.
8<br />
das erste „auf die allen gleichmäßig gewährleistete private <strong>und</strong> öffentliche Autonomie<br />
innerhalb einer Assoziation freier <strong>und</strong> gleicher Rechtsgenossen“ (Habermas<br />
1996: 166f.). Eine prozeduralistisch verstandene Volkssouveränität bringe<br />
sich „in der Macht öffentlicher Diskurse zur Geltung“, sie werde „kommunikativ<br />
verflüssigt“ (Habermas 1992: 228) <strong>und</strong> „verschwindet in den subjektlosen Kommunikationsformen<br />
der diskursiven Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung“ (ebd.: 365).<br />
Ihren institutionellen Ausdruck findet diese kommunikativ verflüssigte<br />
Volkssouveränität nach Habermas in einer zweigleisigen deliberativen Politik,<br />
die einerseits entscheidungsorientierte demokratische Verfahren, insbesondere<br />
die parlamentarischen Beratungen, andererseits die informelle <strong>und</strong> spontane<br />
Meinungsbildung in einer breiten, vielfältig verzweigten autonomen Öffentlichkeit<br />
umfasst. Unter letzterer stellt sich Habermas ein offenes, inklusives Netzwerk<br />
von Teilöffentlichkeiten vor, die, gerade weil sie nicht durch Verfahren reguliert<br />
sind <strong>und</strong> unter keinem Entscheidungszwang stehen, „ein Medium uneingeschränkter<br />
Kommunikation“ bilden sollen, „in dem neue Problemlagen sensitiver<br />
wahrgenommen, Selbstverständigungsdiskurse breiter <strong>und</strong> expressiver geführt,<br />
kollektive Identitäten <strong>und</strong> Bedürfnisinterpretationen ungezwungener artikuliert<br />
werden können als in den verfahrensregulierten Öffentlichkeiten“ (Habermas<br />
1992: 374). In der Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung der autonomen Öffentlichkeit<br />
entsteht die oben bereits erwähnte kommunikative Macht, 12 die dann in<br />
„Beschlüssen demokratisch verfahrender <strong>und</strong> politisch verantwortlicher Gesetzgebungskörperschaften<br />
Gestalt annehmen“ soll (Habermas 1992: 228). Auf diese<br />
Weise kann Habermas die demokratische Gesetzgebung als Ausdruck einer<br />
kommunikativ verflüssigten Volkssouveränität begreifen. Anders noch als in seinem<br />
theoretischen Hauptwerk, der „Theorie des kommunikativen Handelns“,<br />
eröffnet er sich in diesem Modell die Möglichkeit, die institutionalisierte Politik<br />
nicht nur als verselbständigtes mediengesteuertes Teilsystem im Sinne Luhmanns<br />
zu sehen. Die Gegenüberstellung von System <strong>und</strong> Lebenswelt, die in der These<br />
einer „Kolonialisierung“ der Lebenswelt durch das politische Teilsystem zum<br />
Ausdruck kam, wird überw<strong>und</strong>en zugunsten einer Sichtweise, welche die Rechtsetzung<br />
durch den parlamentarischen Gesetzgeber bildhaft als Schleuse beschreibt,<br />
über die Kommunikationsflüsse der Öffentlichkeit in das politische System<br />
eindringen <strong>und</strong> die gesamtgesellschaftlich bindenden Entscheidungen steu-<br />
12<br />
Habermas übernimmt hier den Machtbegriff von Hannah Arendt, interpretiert ihn jedoch im<br />
Sinne seiner kognitiven Diskurstheorie so um, dass kommunikative Macht <strong>und</strong> die begründete<br />
Vermutung rationaler Resultate zusammenfallen (vgl. Habermas 1992: 182ff.).
9<br />
ern. 13 Das Recht ist demnach nicht mehr nur systemisches Steuerungsmedium<br />
der funktionalen Handlungskoordination, sondern zugleich das Medium der Einwirkung<br />
lebensweltlicher Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung auf die gesellschaftlichen<br />
Teilsysteme. 14 Allerdings soll der normale Betrieb im Kernbereich des politischen<br />
Systems nach eingespielten Routinen ablaufen <strong>und</strong> der Druck der öffentlichen<br />
Meinungen nur in krisenhaften oder besonders konfliktreichen Ausnahmesituationen<br />
ausreichen, um über Parlamente <strong>und</strong> Gerichte einen bestimmenden<br />
Einfluss zu nehmen.<br />
Trotz dieser Einschränkungen glaubt Habermas mit seiner diskurstheoretischen<br />
Rekonstruktion demokratischer Entscheidungen als vernünftige, auf zustimmungsfähigen<br />
Gründen basierende Willensbildung über Rechtsnormen das<br />
Spannungsverhältnis zwischen subjektiv-privaten Freiheiten <strong>und</strong> Volkssouveränität,<br />
zwischen privater <strong>und</strong> politischer Autonomie prinzipiell lösen zu können,<br />
indem er rechtliche Handlungsnormen auf einen abstrakten kommunikationstheoretischen<br />
Autonomiebegriff zurückführt. Die Zusammenführung von Vernunft<br />
<strong>und</strong> Willen im Begriff der Autonomie lässt sich nach dieser Verabschiedung der<br />
Bewusstseinsphilosophie nicht mehr nur einem einzelnen Subjekt – sei es das<br />
Großsubjekt einer Nation oder das intelligible Ich Kants – zuschreiben, sondern<br />
ist nun als Ergebnis der diskursiven Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung zu erwarten,<br />
sofern diese Überzeugungen hervorbringt, „in denen alle einzelnen zwanglos ü-<br />
bereinstimmen können“ (Habermas 1992: 134). Der Gedanke der Selbstgesetzgebung,<br />
wonach die Adressaten <strong>und</strong> Urheber des Rechts identisch sind, wird von<br />
der Vorstellung eines Selbst gelöst <strong>und</strong> als „diskursive Ausübung der politischen<br />
Autonomie“ (ebd.: 155) uminterpretiert. So gesehen will Habermas das Projekt<br />
Rousseaus vollenden <strong>und</strong> durch eine Zusammenführung von Vernunft <strong>und</strong> Willen<br />
auf kommunikationstheoretischer Gr<strong>und</strong>lage den Gegensatz zwischen individueller<br />
Autonomie <strong>und</strong> Gesetzesgehorsam aus der Welt schaffen. Wenn das Gesetz<br />
einen Konsens ausdrückt, dem alle zwanglos zustimmen können, dann gehorcht<br />
der gesetzestreue Bürger, wie es Rousseau dem Verhältnis des Einzelnen<br />
zum volonté générale zuschreibt, letztlich sich selbst, er bleibt so frei wie zuvor.<br />
15<br />
13<br />
14<br />
15<br />
Habermas übernimmt dieses Schleusenmodell von Bernhard Peters (vgl. Habermas 1992:<br />
429ff.).<br />
Zu dieser Änderung im Rechtsverständnis von Habermas vgl. auch Howard 2002, Kap. 4.<br />
Bei Rousseau heißt es „Es muß eine Gesellschaftsform gef<strong>und</strong>en werden, die mit der gesamten<br />
gemeinsamen Kraft aller Mitglieder die Person <strong>und</strong> die Habe eines jeden einzelnen<br />
Mitglieds verteidigt <strong>und</strong> beschützt; in der jeder einzelne, mit allen verbündet, nur sich selbst<br />
gehorcht <strong>und</strong> so frei bleibt wie zuvor“ (1977: 73).
10<br />
Die private Autonomie der Bürger braucht dann auch nicht mehr als Naturrecht<br />
oder Moral ihrer politischen Autonomie übergeordnet zu werden, vielmehr<br />
sollen sich private <strong>und</strong> öffentliche Autonomie als „gleich ursprünglich“ erweisen<br />
(ebd.: 135). Habermas fasst diese „Gleichursprünglichkeit“ wie folgt zusammen:<br />
„Der gesuchte interne Zusammenhang zwischen ‚Menschenrechten’ <strong>und</strong><br />
Volkssouveränität besteht mithin darin, dass das Erfordernis der rechtlichen<br />
Institutionalisierung der Selbstgesetzgebung nur mit Hilfe eines Kodes erfüllt<br />
werden kann, der zugleich die Gewährleistung einklagbarer subjektiver<br />
Handlungsfreiheiten impliziert. Umgekehrt kann wiederum die Gleichverteilung<br />
dieser subjektiven Rechte (<strong>und</strong> ihres ‚fairen Werts’) nur durch ein<br />
demokratisches Verfahren befriedigt werden, das die Vermutung auf vernünftige<br />
Ergebnisse der politischen Meinungs- <strong>und</strong> Willenbildung begründet.<br />
Auf diese Weise setzen sich private <strong>und</strong> öffentliche Autonomie gegenseitig<br />
voraus, ohne dass die eine vor der anderen ein Primat beanspruchen<br />
dürfte“ (Habermas 1994: 671). 16<br />
Demzufolge setzen einerseits vernünftige Ergebnisse in der Wahrnehmung öffentlicher<br />
Autonomie die Gewährleistung subjektiver Rechte voraus, andererseits<br />
können diese Ergebnisse, da ihre Vernünftigkeit als Verallgemeinerungsfähigkeit<br />
bestimmt ist, private Autonomie gar nicht verletzen. Der Vernunftstatus von Entscheidungen<br />
hat damit Vorrang vor dem Prinzip der Volkssouveränität, oder, wie<br />
Rainer Schmalz-Bruns formuliert, das Prinzip der Volkssouveränität ist unter<br />
Vorbehalt gestellt <strong>und</strong> kann sich in Gestalt realer Beteiligung nur dort zur Geltung<br />
bringen, wo diese „als eigenständige Quelle der Rationalisierung von Entscheidungen<br />
fungieren kann“ (Schmalz-Bruns 1995: 111).<br />
3. Inklusion <strong>und</strong> Repräsentation in der diskurstheoretisch begründeten<br />
Demokratie<br />
Ein solches, diskurstheoretisch begründetes Konzept deliberativer Demokratie<br />
unterscheidet sich nicht zuletzt durch seine weitergehenden Inklusionsansprüche<br />
von einem pluralistischen, durch politischen Wettbewerb <strong>und</strong> Mehrheitsentscheidungen<br />
charakterisierten Demokratieverständnis. Dies gilt insbesondere für die<br />
16<br />
Zu der komplexen Begründung der “Gleichursprünglichkeit” von privater <strong>und</strong> öffentlicher<br />
Autonomie, von Moral <strong>und</strong> Recht vgl. ausführlicher Habermas 1992, insbes. Kap. III. Kritisch<br />
dazu etwa Blanke 1994, der hinsichtlich der verschlungen Argumentation von Habermas<br />
das Fazit zieht: „Selbst der gutwillige <strong>und</strong> hartnäckige Leser wird hier vor eine Aufgabe<br />
gestellt, von der er nicht sicher ist, wer sie nicht meistert, er oder der Autor“ (Blanke<br />
1994: 456).
11<br />
Inklusion von Minderheiten <strong>und</strong> für die Berücksichtigung von Interessen, die<br />
über vergleichsweise geringe ökonomische <strong>und</strong> politische Ressourcen verfügen.<br />
Während die ersten trotz politischer Gleichheit durch das Mehrheitsprinzip in<br />
Abstimmungen majorisiert <strong>und</strong> die zweiten aufgr<strong>und</strong> fehlender Machtressourcen<br />
in Verhandlungen übergangen werden können, verspricht ein diskurstheoretisch<br />
begründetes Modell deliberativer Demokratie hier Abhilfe: Insofern als deliberative<br />
Theorien das Kriterium demokratischer Legitimität vom Abstimmungsverfahren<br />
auf den Beratungsprozess <strong>und</strong> vom Mehrheitsprinzip auf die Einbeziehung<br />
aller von einer Entscheidung potentiell Betroffenen verschieben, setzen sie<br />
die demokratische Qualität eines Entscheidungsverfahrens mit seiner Inklusivität<br />
gleich <strong>und</strong> zielen darauf, die Subsumtion von Individuen oder Gruppen unter ein<br />
kollektives Großsubjekt zu vermeiden.<br />
„Aus der Sicht Kants <strong>und</strong> eines – recht verstandenen - Rousseau hat demokratische<br />
Selbstbestimmung nicht den kollektivistischen <strong>und</strong> zugleich ausschließenden<br />
Sinn der Behauptung nationaler Unabhängigkeit <strong>und</strong> der Verwirklichung<br />
nationaler Eigenart. Sie hat vielmehr den inklusiven Sinn einer<br />
alle Bürger gleichmäßig einbeziehenden Selbstgesetzgebung. Inklusion<br />
heißt, dass sich eine solche politische Ordnung offen hält für die Gleichstellung<br />
der Diskriminierten <strong>und</strong> die Einbeziehung der Marginalisierten, ohne<br />
diese in die Uniformität einer gleichgearteten Volksgemeinschaft einzuschließen“<br />
(Habermas 1996: 166).<br />
Die diskursive „Verflüssigung“ der Volkssouveränität verspricht jedoch nicht nur<br />
die konsequente Inklusion aller Bürger eines Gemeinwesens, sondern löst darüber<br />
hinaus den Gedanken demokratischer Selbstbestimmung von einem klar<br />
definierten Demos <strong>und</strong> seinen staatlichen Institutionen ab. Demokratie kann dann<br />
über territoriale Grenzen hinaus auf den prinzipiell schrankenlosen Kreis der von<br />
einer Entscheidung Betroffenen erweitert werden. Gerade eine kognitivistische<br />
Variante deliberativer Demokratie bietet die theoretische Gr<strong>und</strong>lage, um zwischenstaatliche<br />
Verhandlungssysteme <strong>und</strong> die transnationale Selbstorganisation<br />
gesellschaftlicher Akteure durch die Qualität der öffentlichen Beratungsprozesse<br />
demokratisch zu legitimieren. Auf diesen Aspekt werde ich weiter unten noch<br />
kurz zurückkommen. 17 Zunächst jedoch möchte ich den Inklusionsanspruch genauer<br />
betrachten <strong>und</strong> dabei mehrere, nicht unproblematische Einzelaspekte diskutieren.<br />
17<br />
Ausführlich dazu etwa Rainer Schmalz-Bruns 1997 <strong>und</strong> 1999. Kritisch dazu Greven 1998<br />
sowie Thaa 1999 <strong>und</strong> 2001.
12<br />
Die diskurstheoretische Begründung deliberativer Demokratiemodelle führt<br />
die demokratische Legitimität <strong>und</strong> die Rationalität von Beratungsergebnissen<br />
zurück auf die allgemeine Akzeptabilität der für sie angeführten Gründe. Daraus<br />
folgt zwar nicht, dass jeder Bürger individuell an den Beratungsprozessen teilnehmen<br />
<strong>und</strong> zu den angeführten Gründen Stellung nehmen müsste. Unabdingbare<br />
Legitimitätsbedingung eines deliberativen demokratischen Prozesses ist jedoch<br />
die Inklusion aller relevanten Interessen, Meinungen <strong>und</strong> Deutungsperspektiven.<br />
18 Habermas unterscheidet den Kreis der zu inkludierenden Interessen<br />
<strong>und</strong> Perspektiven <strong>und</strong> damit den Standard der Verallgemeinerungsfähigkeit<br />
der Entscheidungen je nachdem, ob es um verfahrensregulierte Verhandlungen,<br />
pragmatische, ethisch-politische oder moralische Diskurse geht. 19 Generell jedoch<br />
kann der diskurstheoretische Anspruch einer Einheit von demokratischer<br />
Willensbildung <strong>und</strong> öffentlichem Vernunftgebrauch nur durch die möglichst<br />
breite <strong>und</strong> möglichst gleichmäßige Einbeziehung der Interessen <strong>und</strong> Perspektiven<br />
aller vom jeweiligen Diskurstyp Betroffenen eingelöst werden. Dies gilt insbesondere<br />
für gesellschaftlich marginalisierte Gruppen. Wo die Betroffenen aus<br />
technischen oder Praktikabilitätsgründen nicht selbst teilnehmen können, sollen<br />
Diskurse deshalb repräsentativ oder advokatorisch geführt werden. 20<br />
Die Konzentration der Diskurstheorie auf Argumentationen impliziert dabei<br />
jedoch a) eine inhaltliche Neubestimmung des Repräsentationsprinzips, b) eine<br />
Verschiebung der Legitimitätskriterien demokratischer Entscheidungen sowie c)<br />
eine Abwertung der Handlungs- zugunsten der Erkenntnisdimension demokratischer<br />
Willensbildung.<br />
Ad a) Aufgr<strong>und</strong> des Vernunftanspruches an den demokratischen Prozess verändert<br />
sich der Sinn des Repräsentationsprinzips. Bereits für Verhandlungen,<br />
soweit dabei Argumentationen ins Spiel kommen, erst recht aber für ethischpolitische<br />
<strong>und</strong> moralische Diskurse bezieht Habermas das Repräsentationsprinzip<br />
nicht auf die Delegation der Willensmacht der Repräsentierten an die Repräsentanten,<br />
sondern auf die Argumentationspraxis des Diskurses. Die Auswahl der<br />
18<br />
19<br />
20<br />
Vgl. etwa Habermas 1992: 222-226 oder prägnant zusammengefasst bei Williams: „To sustain<br />
the claim to legitimacy... the processes of deliberative democracy must include all relevant<br />
social and political perspectives“ (Williams 2000: 125).<br />
Vgl. etwa Habermas 1992: 196-207. Dazu ausführlicher hier unter Teil 5.<br />
Ethisch-politische Diskurse werden repräsentativ geführt <strong>und</strong> sollen dabei „durchlässig,<br />
sensibel <strong>und</strong> aufnahmefähig“ gegenüber dem gesamtgesellschaftlichen Kommunikationskreislauf<br />
bleiben. Moralische Diskurse, in denen jeder Teilnehmer die Perspektive aller übrigen<br />
einnehmen muss, werden in der Regel advokatorisch geführt (Vgl. Habermas 1992:<br />
224). Zur Differenzierung zwischen moralischen <strong>und</strong> ethisch- politischen Diskursen s. Teil<br />
5.
13<br />
Teilnehmer soll alle relevanten Deutungsperspektiven <strong>und</strong> die daraus zu entwickelnden<br />
Argumente berücksichtigen. 21 Repräsentiert werden demnach im Idealfall<br />
nicht die empirischen Präferenzen der verschiedenen Bürger <strong>und</strong> ihrer Gruppierungen,<br />
sondern alle denkbaren Argumentationen zu einem Problem oder<br />
Konflikt. Wie weit aus dieser Ablösung des Repräsentationsprinzips vom Willen<br />
der Repräsentierten <strong>und</strong> seiner Berücksichtigung im Handeln der Repräsentanten<br />
eine Einschränkung oder gar eine glatte Verkehrung des Inklusionsanspruches<br />
deliberativer Theorien folgt, 22 wird uns weiter unten noch beschäftigen. Habermas<br />
begegnet dem naheliegenden Einwand, ein Stellvertretermodell zu propagieren,<br />
das die Mehrheit der Bürger zu Mündeln der beratenden Experten <strong>und</strong> Advokatoren<br />
macht, mit der Forderung nach einer Einbettung repräsentativ geführter<br />
Diskurse in den „gesellschaftsweiten Kommunikationskreislauf einer im ganzen<br />
nicht organisierbaren Öffentlichkeit“ (Habermas 1992: 224). Dadurch sollen<br />
repräsentative Diskurse „durchlässig, sensibel <strong>und</strong> aufnahmefähig bleiben für die<br />
Anregungen, die Themen <strong>und</strong> Beiträge, Informationen <strong>und</strong> Gründe, die ihnen aus<br />
einer ihrerseits diskursiv strukturierten, also machtverdünnten, basisnahen, pluralistischen<br />
Öffentlichkeit zufließen“ (ebd.). Der Prozess demokratischer Willensbildung<br />
wird zu einem offenen, stark informelle Züge tragenden Erkenntnisprozess.<br />
Damit treten zugleich die zwei klassischen Dimensionen politischer Repräsentation<br />
in den Hintergr<strong>und</strong>, nämlich die Willensbeziehung zwischen den Repräsentierten<br />
<strong>und</strong> ihren Repräsentanten sowie die Symbolbeziehung, in der die<br />
repräsentativen Institutionen die Einheit, die Ordnungsprinzipien <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>sätzlichen<br />
Orientierungen der Gesellschaft sichtbar darstellen <strong>und</strong> wirksam werden<br />
lassen sollen. 23<br />
Ad b) Das demokratische Verfahren in diesem informalisierten deliberativen<br />
Sinn bezieht dann „seine legitimierende Kraft nicht mehr nur, <strong>und</strong> nicht einmal in<br />
erster Linie, aus Partizipation <strong>und</strong> Willensäußerung, sondern aus der allgemeinen<br />
Zugänglichkeit eines deliberativen Prozesses, dessen Beschaffenheit die Erwartung<br />
auf rational akzeptable Ergebnisse begründet“ (Habermas 1998: 166). Wenn<br />
Habermas den Begriff der politischen Willensbildung benutzt, so meint er damit<br />
nicht die Summierung der faktischen Willen der Bürger, sondern die Herausbildung<br />
eines „vernünftigen Willens“, aus der Übereinstimmung in den Gründen,<br />
21<br />
22<br />
23<br />
Vgl. etwa Habermas 1992: 225.<br />
So etwa die Kritik von Heidrun Abromeit, die deliberativen Theorien vorwirft, die politischen<br />
Repräsentanten von den Präferenzen der Bürger ablösen <strong>und</strong> auf die Vertretung „guter“,<br />
d.h. allgemein akzeptabler Gründe festlegen zu wollen (vgl. Abromeit 2002: 139).<br />
Zu diesen beiden Dimensionen politischer Repräsentation vgl. Göhler 1992.
14<br />
die der deliberative Prozess hervorbringen soll. 24 Damit verliert sowohl das Handeln<br />
des einzelnen Bürgers, sei es in direkter Partizipation oder in Wahlakten, als<br />
auch das Abstimmungsverhalten der Repräsentanten an legitimatorischer Bedeutung<br />
gegenüber den prozeduralen Anforderungen an die Kommunikation <strong>und</strong><br />
Willensbildung in einer breiteren, informellen Öffentlichkeit. Habermas spricht<br />
zwar vorsichtig von einer Gewichtsverschiebung auf Kosten „der konkreten Verkörperung<br />
des souveränen Willens in Personen <strong>und</strong> Wahlakten, Körperschaften<br />
<strong>und</strong> Voten“ (Habermas 1998: 166). Klar ist damit dennoch, dass eine derartige<br />
deliberative Rekonstruktion der liberalen Demokratie die klassischen Kriterien<br />
politischer Repräsentation wie Autorisierung, Zurechenbarkeit, Responsivität<br />
<strong>und</strong> Kontrolle abwertet. Aufgewertet wird dagegen der Status von Gründen, bzw.<br />
derjenigen, die in der Lage sind, gute Gründe von weniger guten zu unterscheiden.<br />
Damit besteht zumindest die Gefahr, dass eine solche Informalisierung der<br />
Legitimation politischer Entscheidungen die gr<strong>und</strong>sätzliche Voraussetzung der<br />
Demokratie, nämlich die politische Gleichheit der Bürger untergräbt. Ob in der<br />
direkten Demokratie der griechischen Polis oder der modernen repräsentativen<br />
Demokratie, die politische Gleichheit ist stets ein prekäres, gegen die Realität<br />
vielfältiger gesellschaftlicher Ungleichheit zu verteidigendes Konstrukt. 25 Wo die<br />
freie <strong>und</strong> gleiche Wahl der Bürger zwischen sachlichen <strong>und</strong> personellen Alternativen<br />
gegenüber informellen, als Erkenntnisvorgänge gedachten Beratungen an<br />
Boden verliert, tritt auch das Prinzip formaler politischer Gleichheit zurück gegenüber<br />
den vielfältigen gesellschaftlichen Ungleichheiten der Teilnahme- <strong>und</strong><br />
Einflussmöglichkeiten in bezug auf diese Beratung <strong>und</strong> Meinungsbildung.<br />
Kompetenz, Zeitressourcen, Argumentationsmacht u.ä.m. sind auch in der breiteren,<br />
informellen Öffentlichkeit von Foren <strong>und</strong> zivilgesellschaftlichen Assoziationen<br />
keineswegs gleich verteilt.<br />
Ad c) Schließlich lässt die deliberative Neubestimmung politischer Willensbildung<br />
verschiedene Handlungsaspekte demokratischer Politik gegenüber der<br />
Erkenntnisfunktion der öffentlichen Debatte zurücktreten. Wie Michael Walzer<br />
in einem knappen Aufsatz sehr anschaulich herausgearbeitet hat, kann die kognitive<br />
Verengung deliberativer Demokratietheorien eine breite Palette politischer<br />
Aktivitäten nicht berücksichtigen, die gerade für die politische Betätigung von<br />
Normalbürgern erhebliche Bedeutung haben <strong>und</strong> vielfältige Partizipationsmöglichkeiten<br />
bieten. Seine vierzehn Punkte umfassende Liste reicht von der<br />
24<br />
25<br />
Dazu gr<strong>und</strong>sätzlich etwa Habermas 1973: 148f. <strong>und</strong> Habermas 1983: 78-86.<br />
Kritisch zur Ignoranz gegenüber dieser Unterscheidung von politischer Gleichheit <strong>und</strong> gesellschaftlicher<br />
Ungleichheit in den Theorien einer zivilgesellschaftlichen deliberativen<br />
Demokratie vgl. etwa Thaa 1999: 208f. <strong>und</strong> Greven 2005: 266f.
15<br />
Agitation über Organisation, die Mobilisierung von Anhängern, das Demonstrieren<br />
eigener Stärke bis zu Kampagnenführung <strong>und</strong> Geldsammeln. 26<br />
Die Möglichkeit einer Annäherung der politischen Realität an das Ideal deliberativer<br />
Demokratie wird mit Hinweis auf die anspruchsvollen Voraussetzungen<br />
einer nicht vermachteten Öffentlichkeit, einer den Anforderungen rationaler Verständigung<br />
entgegenkommenden politischen Kultur <strong>und</strong> eines offenen politischen<br />
Systems immer wieder bezweifelt. Wie bereits hier klar geworden sein sollte,<br />
stellt sich jedoch gr<strong>und</strong>sätzlicher die Frage, ob ein am Ideal rationaler Erkenntnis<br />
orientierter Deliberationsprozess überhaupt Inklusion <strong>und</strong> Gleichheit ermöglichen<br />
kann, oder ob er sich nicht bereits vor den Problemen seiner institutionellen<br />
Umsetzung als selektiv <strong>und</strong> exkludierend erweist. Dieser Frage soll im Folgenden<br />
genauer nachgegangen werden.<br />
4. Wahrheitsfähigkeit <strong>und</strong> Rationalität praktischer Diskurse<br />
Im Zentrum der diskurstheoretischen Begründung eines deliberativen Demokratiemodells<br />
steht Habermas’ These der Wahrheitsfähigkeit normativ-praktischer<br />
Fragen <strong>und</strong> ihre Ausarbeitung zu einer Theorie der Legitimität politischer Entscheidungen<br />
über allgemeinverbindliche Handlungsnormen.<br />
Habermas wurde immer wieder entgegengehalten, die Begründung demokratischer<br />
Politik durch eine Konsenstheorie der Wahrheit sei ihrem Gegenstand<br />
unangemessen, da sie den für moderne Gesellschaften unaufhebbaren Interessen<strong>und</strong><br />
Wertepluralismus nicht berücksichtigen könne. Darüber hinaus wurde ihm<br />
vorgeworfen, er transportiere ein differenzfeindliches, quasi Rousseauistisches<br />
Identitätsdenken. 27 Eine wichtige Rolle spielt die vermeintliche Differenzfeindlichkeit<br />
der Diskurstheorie auch in der angelsächsischen Debatte zum Multikulturalismus,<br />
in der Habermas geradezu als Kontrastfolie dient, vor der eigene,<br />
auf Diversität <strong>und</strong> Agonalität setzende Demokratietheorien entwickelt werden. 28<br />
Habermas hat nicht zuletzt in Reaktion auf die vielfach vorgetragene Kritik in<br />
den neunziger Jahren eingeräumt, dass sich die Diskursethik nicht unmittelbar<br />
auf den demokratischen Prozess anwenden lasse <strong>und</strong> dementsprechend für den<br />
Bereich der Politik <strong>und</strong> Rechtsetzung eine Differenzierung zwischen verschiedenen<br />
Diskurstypen vorgeschlagen. Ungeachtet dessen hielt er dabei jedoch gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
an der Wahrheitsfähigkeit praktischer Diskurse <strong>und</strong> der epistemischen<br />
26<br />
27<br />
28<br />
Vgl. Walzer 1999.<br />
Zum letzten Vorwurf etwa Vollrath 1987, 1989 <strong>und</strong> 1995. Ähnlich auch Michael Greven<br />
1991.<br />
Vgl. etwa Young 1987, Villa 1992, Mouffe 1999.
16<br />
Funktion demokratischer Willensbildung fest. 29 Um die Angemessenheit einer<br />
diskurstheoretischen Begründung der Demokratie <strong>und</strong> ihre Auswirkungen auf die<br />
politische Repräsentation von Minderheiten <strong>und</strong> schwachen Interessen beurteilen<br />
zu können, ist es erforderlich, zunächst die gr<strong>und</strong>sätzliche These der Wahrheitsfähigkeit<br />
praktischer Diskurse <strong>und</strong> die aus ihr gewonnenen Rationalitätsstandards<br />
der demokratischen Willensbildung zu rekapitulieren.<br />
In seinen früheren Schriften, einschließlich der „Theorie des kommunikativen<br />
Handelns“ von 1982 vertritt Habermas einen engen Diskursbegriff, der Diskurse<br />
auf Fragen propositionaler Wahrheit <strong>und</strong> normativer Richtigkeit begrenzt. 30 Diskurse<br />
sind demnach eine von unmittelbarem Handlungsdruck entlastete Form der<br />
Kommunikation zur Überprüfung der Verallgemeinerungsfähigkeit von Geltungsansprüchen,<br />
in denen Teilnehmer, Themen <strong>und</strong> Beiträge nicht beschränkt<br />
werden, kein Zwang, außer dem des besseren Argumentes, ausgeübt wird <strong>und</strong><br />
alle Motive, außer dem der kooperativen Wahrheitssuche ausgeschlossen sind. 31<br />
Wenn unter solchen Bedingungen argumentativ ein Konsens erzielt wird, „dann<br />
drückt dieser Konsens einen vernünftigen Willen aus“ (Habermas 1973: 148).<br />
Spezifischer nennt Habermas folgende Diskursregeln, die jeder, der in eine Argumentation<br />
eintritt, als hinreichend erfüllt voraussetzen muss. 32<br />
1. „Jedes sprach- <strong>und</strong> handlungsfähige Subjekt darf an Diskursen teilnehmen.“<br />
2 a) „Jeder darf jede Behauptung problematisieren“<br />
2 b) „Jeder darf jede Behauptung in den Diskurs einführen“<br />
2 c) „Jeder darf seine Einstellungen, Wünsche <strong>und</strong> Bedürfnisse äußern.“<br />
3. „Kein Sprecher darf durch innerhalb oder außerhalb des Diskurses<br />
herrschenden Zwang daran gehindert werden, seine in 1) <strong>und</strong> 2) festgelegten<br />
Rechte wahrzunehmen“ (Habermas 1983: 99).<br />
Noch 1983 betont Habermas, das Diskursverfahren könne für die Entscheidung<br />
von Wertfragen nicht gelten, da diese an den lebensweltlichen Horizont einer<br />
bestimmten Kultur geb<strong>und</strong>en seien. Anders als die Wahrheit propositionaler<br />
Aussagen <strong>und</strong> die Richtigkeit moralischer Handlungsnormen implizierten Wert-<br />
29<br />
30<br />
31<br />
32<br />
Vgl. etwa Habermas 1991, S. 100-119 <strong>und</strong> Habermas 1992, S. 196-207.<br />
Zu diesem engen Diskursbegriff <strong>und</strong> seiner späteren Erweiterung vgl. auch Cooke 1997.<br />
Vgl. Habermas 1973: 148.<br />
„Argumentationsteilnehmer können der Voraussetzung nicht ausweichen, dass die Struktur<br />
ihrer Kommunikation, aufgr<strong>und</strong> formal zu beschreibender Merkmale, jeden von außen auf<br />
den Verständigungsprozeß einwirkenden oder aus ihm selbst hervorgehenden Zwang, außer<br />
dem des besseren Argumentes, ausschließt <strong>und</strong> damit auch alle Motive außer dem der kooperativen<br />
Wahrheitssuche neutralisiert“ (Habermas 1983: 99).
17<br />
fragen deshalb keine universalisierbaren Geltungsansprüche, die dem Verallgemeinerungstest<br />
des Diskurses unterzogen werden könnten. 33 Damit lassen sich<br />
die Werte partikularer Gemeinschaften auch nicht wie die auf Konsens gegründeten<br />
moralischen Normen auf die Autonomie der Individuen zurückführen. 34<br />
Der praktische Diskurs wurde von Habermas also zunächst einmal bestimmt als<br />
ein Verfahren zur Prüfung der Gültigkeit vorgeschlagener oder unter Kritik gekommener<br />
moralischer Normen. Durch das Kriterium der Verallgemeinerungsfähigkeit,<br />
d.h. des möglichen Konsenses aller Betroffenen in einer ideal vorgestellten<br />
Sprechsituation, soll der Diskurs „rechtfertigungsfähige Normen von solchen<br />
Normen unterscheiden, die Gewaltverhältnisse stabilisieren“ (Habermas<br />
1973:153). In dieser Formulierung treten sowohl die ideologiekritische Stoßrichtung<br />
der frühen Diskurstheorie wie auch ihre Begründung im Ideal individueller<br />
Autonomie deutlich hervor. Diskurse gehen von einem gestörten normativen<br />
Einverständnis aus, um dann zwischen universalisierbaren, d.h. durch die<br />
Zustimmung jedes Individuums rational gerechtfertigten <strong>und</strong> nicht universalisierbaren,<br />
d.h. nicht allgemein zustimmungsfähigen <strong>und</strong> deshalb irrationalen<br />
Normen zu unterscheiden. Der Universalisierungsgr<strong>und</strong>satz dieses ethischen<br />
Formalismus impliziert die Trennung zwischen einem nur kulturspezifischen E-<br />
thos oder der Sittlichkeit auf der einen <strong>und</strong> einer verallgemeinerungsfähigen Moral<br />
auf der anderen Seite. Er funktioniert “wie ein Messer, das einen Schnitt legt<br />
zwischen das ‚Gute’ <strong>und</strong> das ‚Gerechte’, zwischen evaluative <strong>und</strong> streng normative<br />
Aussagen“ (Habermas 1983: 113).<br />
Nur durch eine derart strikte Trennung ist nach Habermas eine gegenüber bestimmten<br />
Lebensformen neutrale <strong>und</strong> von der Autonomie der Individuen ausgehende<br />
Begründung moralischer Normen möglich. Moralische Fragen sind unter<br />
dem Gesichtspunkt der Verallgemeinerungsfähigkeit rational entscheidbar, Fragen<br />
des guten Lebens sind evaluative Fragen, die „nur innerhalb des unproblematischen<br />
Horizonts einer geschichtlich konkreten Lebensform“ rational erörtert<br />
werden können (Ebd.: 116). Die Abstraktionsleistung, die diese Unterscheidung<br />
erfordert, hält Habermas für eine Errungenschaft der postkonventionellen Stufe<br />
des moralischen Bewusstseins, auf der dieses in der Lage ist, moralische Urteile<br />
von lokalen Übereinkünften <strong>und</strong> historisch geprägten partikularen Lebensformen<br />
zu unterscheiden. Gerechtigkeitsfragen <strong>und</strong> Fragen des „guten Lebens“, Moralität<br />
<strong>und</strong> Sittlichkeit sollen demnach in der rationalisierten Lebensform moderner<br />
Gesellschaften prinzipiell unterscheidbar sein (Habermas 1983: 118).<br />
33<br />
34<br />
Vgl. dazu Habermas 1981 Bd. 1: 71 <strong>und</strong> 1983: 113f.<br />
Vgl. dazu auch Cooke 1997: 273.
18<br />
Habermas legt diese strenge, zunächst auf die Begründung moralischer Normen<br />
gerichtete diskurstheoretische Messlatte an die Legitimität politischer Willensbildung<br />
an. Zumindest auf den ersten Blick handelt es sich dabei um eine<br />
erstaunliche Verengung des Politischen. Denn die politische Qualität kommt<br />
dann der konflikthaften Willensbildung zwischen gesellschaftlichen Gruppen,<br />
Parteien <strong>und</strong> Individuen nicht durch ihre Pluralität, ihre Gewaltfreiheit oder ihre<br />
Kontingenz zu, sondern in dem Maße, wie sie sich den Verfahrensstandards einer<br />
diskursethischen Entscheidung über universalisierbare moralische Normen annähert.<br />
Noch nach der Erweiterung seines Diskursbegriffes hält Habermas daran<br />
fest, dass sich eine Gemeinschaft von Staatsbürgern als politische Gemeinschaft<br />
nicht durch ihren Willen oder ihre partikulare Identität auszeichnet, sondern<br />
durch „allgemeine Prinzipien der Gerechtigkeit, die gleichermaßen für jede Bürgerschaft<br />
konstitutiv sind“ (Habermas 1992: 372). Durch diese Gleichsetzung<br />
von „politisch“ mit allgemeingültigen prozeduralen Prinzipien formuliert Habermas<br />
einen normativen Politikbegriff, dessen Kern der Vernunftanspruch seiner<br />
Diskursethik bildet. Die politische Qualität der Beratung <strong>und</strong> Beschlussfassung<br />
ergibt sich aus der Orientierung an idealen, unparteilichen Verfahren, die,<br />
wie der moralische Diskurs, Ergebnisse hervorbringen, in denen Vernunft <strong>und</strong><br />
Wille zur Deckung gebracht werden.<br />
In unserem Zusammenhang möchte ich vor allem zwei Motive hervorheben,<br />
die Habermas veranlassen, die politische Willensbildung an eine kognitivistische<br />
Theorie der Begründung moralischer Normen anzubinden. Wie bereits erwähnt<br />
will Habermas erstens in scharfer Abgrenzung zu den älteren Vertretern der Kritischen<br />
Theorie die Geschichte der Moderne nicht länger als einen Verhängniszusammenhang<br />
der Totalisierung instrumenteller Vernunft sehen. In der „Theorie<br />
des kommunikativen Handelns“ kritisiert er die Einseitigkeit des Weberschen<br />
Rationalitätsbegriff, der von Lukács bis Adorno die Gesellschaftskritik des westlichen<br />
Marxismus prägte. Als Alternative entwickelt er aus Sprachphilosophie<br />
<strong>und</strong> amerikanischem Pragmatismus einen intersubjektiven Vernunftbegriff, der<br />
es ihm erlaubt, gesellschaftliche Modernisierung auch als Entfaltung kommunikativer<br />
Rationalität zu verstehen. Es ist jedoch eines, einen formalpragmatischen,<br />
aus der Analyse allgemeiner Eigenschaften verständigungsorientierten Handelns<br />
gewonnenen Vernunftbegriff zu entwickeln, ein anderes, die Institutionen <strong>und</strong><br />
Interaktionszusammenhänge des demokratischen Rechtsstaates als Ausdruck des
19<br />
diagnostizierten Vernunftpotentials der Moderne zu rekonstruieren. 35<br />
Mit dieser Gr<strong>und</strong>intention einer Rettung von Aufklärung <strong>und</strong> Moderne ist im<br />
Denken von Habermas ein zweites, spezifischer politisches Motiv eng verb<strong>und</strong>en.<br />
Habermas will - gegen Max Weber <strong>und</strong> Carl Schmitt – einen nichtdezisionistischen<br />
Politikbegriff entwickeln. Trotz des unaufhebbaren Wertepluralismus<br />
in modernen Gesellschaften hält er deshalb an der Wahrheitsfähigkeit <strong>und</strong><br />
dem Vernunftanspruch verbindlicher praktischer Normen fest. Ihre Geltung soll<br />
nicht auf willkürliche Entscheidung <strong>und</strong> Machtverhältnisse zurückgehen, sondern,<br />
wie vermittelt auch immer, als Ergebnis einer kooperativen Wahrheitssuche<br />
verstanden werden können. 36 Etwas polemisch könnte man sagen: die diskurstheoretisch<br />
begründete deliberative Demokratietheorie kommt zur Selbsterkenntnis<br />
der Vernunft im demokratischen Rechtsstaat.<br />
Das politische Alltagsgeschäft weist nun allerdings auf den ersten Blick wenig<br />
Ähnlichkeit mit einer kooperativen Wahrheitssuche auf. Praktisch-politische<br />
Auseinandersetzungen scheinen nahezu allen Bedingungen zu widersprechen, die<br />
einen Diskurs erst konstituieren. Sie sind nicht handlungsentlastet, sondern stehen<br />
unter Zeit- <strong>und</strong> Entscheidungsdruck. Die Teilnahme ist, solange es Staaten<br />
gibt, begrenzt. Die politische Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung ist nicht auf den<br />
Konsens einer idealen Gemeinschaft bezogen, sondern geht aus von den partikularen<br />
Interessen <strong>und</strong> Perspektiven spezifischer Teilnehmer, die sich in aller Regel<br />
schwer tun, zwischen verschiedenen Stufen der Verallgemeinerungsfähigkeit von<br />
Geltungsansprüchen zu unterscheiden <strong>und</strong> dazu noch notorisch die Grenzen zwischen<br />
strategisch kalkulierter Akzeptanz <strong>und</strong> rationaler Zustimmung verwischen.<br />
37 Als politische Theorie scheint die Diskurstheorie damit heillos realitätsfern<br />
zu sein. Die Demokratie ist zwar, wie Höffe mit Durkheim feststellt, die<br />
„Herrschaftsform der Reflexion“, weil sie beständige Kommunikation impliziert,<br />
sie ist aber nicht eine Staatsform des handlungsentlasteten, wahrheitsfähigen<br />
Diskurses. 38<br />
Habermas begegnet dieser Kritik zunächst durch eine Präzisierung <strong>und</strong> Abschwächung<br />
des Wahrheitsanspruches praktischer Diskurse. Gegen die aristoteli-<br />
35<br />
36<br />
37<br />
38<br />
In einem Gespräch zur „Theorie des kommunikativen Handelns“ nennt Habermas 1985 als<br />
nächsten Schritt die Aufgabe, den Begriff kommunikativer Rationalität anwendbar zu machen<br />
<strong>und</strong> ihn auf institutionalisierte Interaktionszusammenhänge zu beziehen (vgl. Habermas<br />
1985: 173). Seine Theorie des demokratischen Rechtsstaates bildet die konsequente<br />
Umsetzung dieses Vorhabens.<br />
Dazu etwa Habermas 1973: 139 <strong>und</strong> Habermas 1996a: 336.<br />
Für eine Zusammenfassung der kritischen Einwände gegen die Übertragung des Diskursmodells<br />
auf den politischen Alltag vgl. etwa Scheidt 1987: 398f <strong>und</strong> Willems 2003: 31f.<br />
Vgl. Höffe 1993: 44.
20<br />
sche Unterscheidung von „phronesis“, der praktischen Klugheit, <strong>und</strong> „episteme“,<br />
der auf das Allgemeine, Notwendige <strong>und</strong> Überzeitliche gerichteten Erkenntnis,<br />
stellt er den falliblen Erkenntnismodus der modernen Wissenschaften. Aufgr<strong>und</strong><br />
der aristotelischen Differenzierung sei die Entscheidung über Handlungsnormen<br />
keine Sache der Erkenntnis im strikten Sinne, sondern der praktischen Klugheit.<br />
Da es der modernen Wissenschaft aber gar nicht mehr um das Erkennen ewiger<br />
Wahrheiten ginge, sondern um jederzeit kritisierbare Erkenntnisansprüche, sei<br />
diese Unterscheidung anachronistisch geworden <strong>und</strong> im übrigen „nicht klar, wie<br />
man von diesem schwachen, nachmetaphysischen Wissen noch nennenswerte<br />
Abstriche machen könnte, ohne den kognitiven Kern selbst zu gefährden“ (Habermas<br />
1991: 121). So gesehen wird die moderne Wissenschaft durch ihren falliblen<br />
Erkenntnismodus nicht nur demokratiefähig, sondern kann in Gestalt eines<br />
an der Argumentationspraxis von Gelehrten gewonnenen Diskursideals selbst das<br />
Modell für die moderne deliberative Demokratie abgeben. 39<br />
Auch wenn wir die Demokratiefähigkeit eines derart reduzierten Wahrheitsanspruches<br />
akzeptierten, bliebe zwischen dem Legitimitätsprinzip des Diskurses<br />
<strong>und</strong> der politischen Wirklichkeit eine Kluft, die erst durch eine genauere Bestimmung<br />
der politischen Willensbildung <strong>und</strong> ihrer institutioneller Formen geschlossen<br />
werden müsste, um aus einer kognitivistischen Moraltheorie eine politische<br />
Theorie zu machen.<br />
Habermas stellt sich dieser Aufgabe mit seiner in den 90er Jahren entwickelten<br />
Diskurstheorie des Rechts <strong>und</strong> des demokratischen Rechtsstaates. Den Ausgangspunkt<br />
dazu bietet das oben schon erwähnte Eingeständnis, dass „eine unvermittelte<br />
Anwendung der Diskursethik oder eines ungeklärten Diskursbegriffs<br />
auf den demokratischen Prozeß ... zu Ungereimtheiten (führt)“ (Habermas 1992:<br />
196). 40 Habermas bezieht sich dabei auf einen Einwand von Kriele, nach dem die<br />
idealisierenden Voraussetzungen von Argumentation in der politischen Praxis<br />
nicht herstellbar sind. 41 Seine Lösungsstrategie besteht dann darin, zwischen<br />
Diskurs- <strong>und</strong> Moralprinzip so zu differenzieren, dass demokratische Politik auch<br />
39<br />
40<br />
41<br />
Vgl. dazu auch Habermas 1992: 31. Konsequenterweise versucht Dryzek dann auch kritischen<br />
Rationalismus <strong>und</strong> Diskurstheorie zusammenzuführen <strong>und</strong> die diskursive Demokratie<br />
als Verfahren rationaler Problemlösung im Sinne Poppers zu bestimmen (vgl. Dryzek<br />
1990).<br />
Ähnlich formuliert Habermas in den „Erläuterungen zur Diskursethik“: „Gewiß konzentriert<br />
sie (die Diskursethik, W. T.) sich mit einem eng gefasst Begriff der Moral auf Fragen der<br />
Gerechtigkeit. ... In dieser Hinsicht mag der Name der Diskursethik ein Missverständnis nahegelegt<br />
haben. Die Diskurstheorie bezieht sich in je anderer Weise auf moralische, ethische<br />
<strong>und</strong> pragmatische Fragen“ (Habermas 1991: 101).<br />
Vgl. Habermas 1992: 195.
21<br />
dort, wo es nicht um verallgemeinerungsfähige moralische Fragen geht, an das<br />
Diskursprinzip zurückgeb<strong>und</strong>en werden kann. Im Ergebnis wird das Diskursprinzip<br />
dabei so ausgeweitet, dass es nicht mehr als Legitimitätstests für gesellschaftliche<br />
Normen im Rahmen einer negativ bleibenden Kritischen Theorie fungiert,<br />
sondern stattdessen zum Baustoff einer affirmativen Rekonstruktion des demokratischen<br />
Rechtsstaates wird.<br />
5. Die verschiedenen Gestalten des Diskursprinzips in der politischen<br />
Willensbildung<br />
In seiner allgemeinen Formulierung bezieht Habermas das Diskursprinzip auf<br />
Handlungsnormen überhaupt. Es lautet dann:<br />
„D: Gültig sind genau die Handlungsnormen, denen alle möglicherweise<br />
Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen könnten“<br />
(Habermas 1992: 138).<br />
Ein solches, von Habermas „sparsam“ genanntes Diskursprinzip soll der Verzweigung<br />
von Handlungsnormen in moralische <strong>und</strong> juridische Regeln vorausgehen<br />
<strong>und</strong> lediglich den Sinn postkonventioneller Begründungsformen ausdrücken<br />
(vgl. ebd.). Wichtig ist dabei zunächst, dass der Formulierung eines allgemeinen<br />
Diskursprinzips, das sowohl auf moralische als auch auf die im demokratischen<br />
Prozess beschlossenen rechtsförmigen Handlungsnormen anwendbar ist, die bereits<br />
oben thematisierte Annahme entspricht, Moral <strong>und</strong> Recht, private <strong>und</strong> öffentliche<br />
Autonomie seien gleichursprünglich. Das in demokratischen Verfahren<br />
beschlossenen positive Recht soll also nicht wie in der Kantischen Rechtslehre<br />
der Moral untergeordnet werden. 42 In beiden Sorten von Handlungsnormen, den<br />
moralischen <strong>und</strong> den rechtlichen, soll der Autonomiebegriff eine jeweils spezifische<br />
Gestalt annehmen: als Moralprinzip <strong>und</strong> als Demokratieprinzip. Nach Habermas<br />
kann zwar eine Rechtsordnung nur legitim sein, wenn sie moralischen<br />
Gr<strong>und</strong>sätzen nicht widerspricht. Dennoch wäre es falsch, die Moral dem Recht<br />
hierarchisch überzuordnen. Rechtsnormen liegen nicht auf derselben Abstraktionsebene<br />
wie Moralnormen, lassen sich aber auch nicht aus diesen ableiten. Autonome<br />
Moral <strong>und</strong> das auf Begründung angewiesene positive Recht stehen vielmehr<br />
in einem Ergänzungsverhältnis. Ins Recht finden „Ziele <strong>und</strong> Wertorientierungen,<br />
Bedürfnisse <strong>und</strong> Präferenzen Eingang, gegen die sich die Moral sperrt“<br />
42<br />
Vgl. Habermas 1992: 111f.
22<br />
(Habermas 1996a: 352). Wenn Recht nicht in Gerechtigkeit aufgehen kann, weil<br />
Rechtsfragen auch kollektive Ziele <strong>und</strong> Güter berühren sowie Fragen der Lebensform<br />
<strong>und</strong> Identität aufwerfen, entsteht ein über den moralischen Diskurs hinausreichender<br />
Begründungsbedarf.<br />
„Dann muß aber nicht nur geklärt werden, was gut ist für alle, sondern auch:<br />
wer die Beteiligten jeweils sind <strong>und</strong> wie sie leben möchten. Angesichts der<br />
Ziele, die sie im Lichte starker Wertungen wählen, stellt sich ihnen zudem<br />
die Frage, wie sie diese am besten erreichen können. Der Bereich der Gerechtigkeitsfragen<br />
erweitert sich also um Probleme der Selbstverständigung<br />
<strong>und</strong> der rationalen Mittelwahl – <strong>und</strong> natürlich um Probleme des Ausgleichs<br />
zwischen Interessen, die eine Verallgemeinerung nicht zulassen, sondern<br />
Kompromisse nötig machen“ (Habermas 1992: 192).<br />
Über diese Erweiterung hinaus verändert sich jedoch auch das Verhältnis von<br />
Kognition <strong>und</strong> Willensbildung. Da sich in der Rechtsetzung Momente der Verständigung<br />
mit solchen der Zielsetzung <strong>und</strong> Vereinbarung verschränken, „fällt in<br />
Prozessen der Rechtsetzung das volitive Moment der Entscheidung gegenüber<br />
dem kognitiven der Urteils- <strong>und</strong> Meinungsbildung ins Gewicht“ (Habermas<br />
1996a: 352).<br />
Zur Begründung von Handlungsnormen, die in Rechtsform auftreten, ist das<br />
allgemeine Diskursprinzip also zu einem Demokratieprinzip zu spezifizieren, in<br />
dem Handlungsnormen nicht allein aus moralischen, sondern auch aus ethischpolitischen<br />
<strong>und</strong> pragmatischen Gründen entschieden werden können. Mit der<br />
Unanwendbarkeit der Argumentationsregel des Universalisierungsgr<strong>und</strong>satzes<br />
fällt allerdings auch das strenge Rationalitätskriterium des moralischen Diskurses<br />
weg, so dass erst einmal zweifelhaft erscheint, ob Habermas für eine derartige<br />
politische Spezifizierung des Diskursprinzips zum Demokratieprinzip noch den<br />
ursprünglich aus dem moralischen Diskurs stammenden Rationalitätsanspruch<br />
aufrechterhalten kann, <strong>und</strong> wenn ja, welche Konsequenzen dann aus einem solchen<br />
Anspruch für die politische Repräsentation verschiedener Interessen <strong>und</strong><br />
Deutungsperspektiven folgen.<br />
Habermas unterscheidet den Gebrauch praktischer Vernunft zur demokratischen<br />
Bestimmung von Handlungsnormen nach den Aspekten des Zweckmäßigen,<br />
des Guten <strong>und</strong> des Gerechten. Dem entsprechen pragmatische, ethischpolitische<br />
<strong>und</strong> moralische Diskurse, die sich insbesondere in der jeweiligen
23<br />
Konstellation von Vernunft <strong>und</strong> Wille unterscheiden sollen. 43<br />
In pragmatischen Diskursen geht es um praktische Probleme, die Habermas<br />
im Sinne der Weberschen Zweckrationalität bestimmt. Sie ergeben sich aus der<br />
Perspektive eines Handelnden, der für die Realisierung gegebener Zwecke zwischen<br />
verschiedenen Mitteln rational auswählen oder auf der Gr<strong>und</strong>lage feststehender<br />
Werten verschiedene Ziele gegeneinander abwägen muss. Die angestellten<br />
Überlegungen richten sich also auf geeignete Techniken, Strategien oder Programme.<br />
Entsprechend geben in pragmatischen Diskursen „Argumente den Ausschlag,<br />
die empirisches Wissen auf gegebene Präferenzen <strong>und</strong> gesetzte Zwecke<br />
beziehen <strong>und</strong> die Folgen alternativer Entscheidungen nach zugr<strong>und</strong>egelegten<br />
Maximen beurteilen“ (Habermas 1992: 198).<br />
Sofern die zugr<strong>und</strong>eliegenden Werte problematisch werden, können Interessenkonflikte<br />
auch Fragen des kollektiven Selbstverständnisses aufwerfen, die<br />
über den Horizont der Zweckrationalität hinausweisen. Damit betreten wir das<br />
Feld ethisch-politischer Diskurse, in denen es, in der Formulierung von Habermas,<br />
nicht um Fragen der Gerechtigkeit, sondern „um klinische Fragen des guten<br />
Lebens“ geht (Habermas 1991: 103).<br />
„Ethisch-politische Fragen stellen sich aus der Perspektive von Angehörigen,<br />
die sich in lebensweltlichen Fragen darüber klar werden wollen, welche<br />
Lebensform sie teilen, auf welche Ideale hin sie ihr gemeinsames Leben<br />
entwerfen sollten“ (Habermas 1992: 198).<br />
„Klinisch“ nennt Habermas, der eine Schwäche für medizinische Metaphern hat,<br />
diese Fragen <strong>und</strong> die ihnen entsprechenden Diskurse, weil sie sich auf die Rekonstruktion<br />
bewusst gemachter <strong>und</strong> zugleich kritisch angeeigneter Lebensformen<br />
stützen. 44 In ihnen spielen hermeneutische Argumente, die das Selbstverständnis<br />
einer Gemeinschaft auslegen, eine entscheidende Rolle. Diese Argumente<br />
führen zu evaluativen Urteilen über etwas, das aus der Bewertungsperspektive<br />
einer Bezugsgruppe mehr oder weniger gut oder schlecht ist. 45 Die Ergebnisse<br />
von ethisch-politischen Diskursen richten sich an „die Entschlusskraft<br />
43<br />
Vgl. dazu insbesondere Habermas 1991: 100-118 <strong>und</strong> Habermas 1992: 195-207. In einer der<br />
für ihn typischen Selbstkorrekturen kritisiert Habermas den von ihm in „Faktizität <strong>und</strong> Geltung“<br />
unternommenen Versuch, die verschiedenen Arten von Diskursen durch Zuordnung<br />
konkreter Fragen zu exemplifizieren <strong>und</strong> betont, dass es sich hier nur um eine analytische<br />
Trennung handeln kann, da politische Fragen aufgr<strong>und</strong> ihrer Komplexität gleichzeitig unter<br />
pragmatischen, ethischen <strong>und</strong> moralischen Gesichtspunkten behandelt werden müssen (vgl.<br />
dazu Habermas 1994: 667).<br />
44 Vgl. dazu Habermas 1992: 125, 199, 201; 1991: 103.<br />
45<br />
Vgl. dazu Habermas 1991: 168.
24<br />
eines Kollektivs, das sich einer authentischen Lebensweise vergewissern will“<br />
(Habermas 1992: 201). Es sind also Selbstverständigungsdiskurse, die auf Wertorientierungen<br />
einer partikularen Gemeinschaft zurückgreifen, um die Frage<br />
„was wir eigentlich wollen“ (ebd.: 199) zu beantworten. Deshalb sollen sich in<br />
ethischen Diskursen Vernunft <strong>und</strong> Willen gegenseitig bestimmen (ebd.: 202;<br />
1991: 112). Ethisch politische Diskurse werden aus technischen Gründen repräsentativ<br />
geführt, müssen aber „durchlässig, sensibel <strong>und</strong> aufnahmefähig bleiben“<br />
für eine basisnahe, pluralistische Öffentlichkeit (Habermas 1992: 224). Als Beispiele<br />
dieses Diskurstyps nennt Habermas ökologische Fragen, Fragen der Immigrationspolitik,<br />
des Minderheitenschutzes <strong>und</strong> allgemein der politischen Kultur<br />
(Habermas 1992: 204). Eine Abkoppelung vom Verallgemeinerungsgr<strong>und</strong>satz<br />
des Moralprinzip findet in ethisch-politischen Diskursen allerdings nicht statt,<br />
denn ihre Ergebnisse „müssen mit moralischen Gr<strong>und</strong>sätzen wenigstens kompatibel<br />
sein“ (Habermas 1992: 206).<br />
Der moralisch-praktische Diskurs erfordert demgegenüber die Distanzierung<br />
von kollektiven Identitäten sowie kontingent bestehenden normativen Kontexten<br />
<strong>und</strong> das Heraustreten aus jeder partikularen Sittlichkeit. Er bezieht sich auf<br />
Handlungsnormen, die allein unter dem Gesichtspunkt gleichmäßiger Interessenberücksichtigung<br />
gerechtfertigt werden können. In ihm tritt der teleologische<br />
ganz hinter dem normativen Gesichtspunkt zurück. Argumente in moralischen<br />
Diskursen prüfen, ob die in Gerechtigkeitsnormen verkörperten Interessen<br />
„schlechthin verallgemeinerungsfähig“ sind (Habermas 1992: 200). Es gilt hier<br />
der oben bereits erwähnte Universalisierungsgr<strong>und</strong>satz, der von einer Norm erfordert,<br />
„dass die voraussichtlichen Folgen <strong>und</strong> Nebenwirkungen, die sich aus<br />
ihrer allgemeinen Befolgung für die Befriedigung der Interessen eines jeden voraussichtlich<br />
ergeben, von allen Betroffenen zwanglos akzeptiert (<strong>und</strong> den Auswirkungen<br />
der bekannten alternativen Regelungsmöglichkeiten vorgezogen)<br />
werden können“ (Habermas 1991: 134). Teilnehmer eines moralischen Diskurses<br />
müssen also die partikulare Perspektive bestimmter Kollektive erweitern zugunsten<br />
der „umfassenden Perspektive einer entschränkten Kommunikationsgemeinschaft,<br />
deren Mitglieder sich alle in die Situation <strong>und</strong> das Weltverständnis eines<br />
jeden hineinversetzen“ (Habermas 1992: 200). Moralische Argumentationen setzen<br />
eine freie Verständigungspraxis voraus, in der „einzig die rational motivierende<br />
Kraft des besseren Arguments zum Zuge“ kommt (ebd.: 224). Von hier aus<br />
erklärt sich, weshalb moralische Begründungsdiskurse in der Regel advokatorisch<br />
durchgeführt werden. Als Beispiele für Gegenstände eines moralischen<br />
Diskurses nennt Habermas u.a. strafrechtliche Fragen oder Fragen der Sozialpoli-
25<br />
tik, der Steuerpolitik, der Organisation des Schul- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssystems, soweit<br />
sie die Distribution des gesellschaftlichen Reichtums <strong>und</strong> die Lebens <strong>und</strong><br />
Überlebenschancen betreffen (ebd.: 204).<br />
Nun weiß auch Habermas, dass im demokratischen Prozess häufig keiner der<br />
drei Diskurstypen zum Zuge kommen kann. Dies ist immer dann der Fall, wenn<br />
sich „weder ein verallgemeinerbares Interesse oder der eindeutige Vorrang eines<br />
Wertes begründen (lässt)“ (Habermas 1992: 204). 46 Dann nämlich können Handlungskonflikte<br />
nicht durch Argumentation beigelegt werden. Statt ein rational<br />
motiviertes, auf Gründe gestütztes Einverständnis herzustellen, müssen die Beteiligten<br />
nun einen Kompromiss suchen, der für alle, allerdings aus unterschiedlichen<br />
Gründen, akzeptabel ist. Kompromisse bestimmen keine verallgemeinerungsfähigen<br />
Normen, sondern enthalten einen Ausgleich zwischen partikularen<br />
Interessen. 47 Während Habermas in früheren Schriften diesen Unterschied zwischen<br />
Kompromissen <strong>und</strong> rationalem Konsensus betont, will er in „Faktizität <strong>und</strong><br />
Geltung“ - unter Beibehaltung der gr<strong>und</strong>sätzlichen Differenz – den Kompromiss<br />
indirekt an das Diskursprinzip zurückbinden. Das Diskursprinzip soll nämlich in<br />
moralischen Entscheidungen über die Fairness der Verfahren, mit denen ein<br />
Kompromiss ausgehandelt wird, zum Zuge kommen. Ob derart „regulierte“, im<br />
Gegensatz zu „naturwüchsigen“ Verhandlungen 48 überzeugend an das Diskursprinzip<br />
zurückgeb<strong>und</strong>en werden können, hängt also von einer genaueren Bestimmung<br />
der Fairnessbedingung ab. Habermas Ausführungen dazu scheinen<br />
nicht ganz klar. Zunächst betont er, dass in Verhandlungen, anders als im Diskurs,<br />
soziale Machtverhältnisse nicht neutralisiert werden, die Parteien strategisch<br />
handeln <strong>und</strong> ihre Erfolgschancen nicht vom besseren Argument, sondern<br />
von überlegenen Ressourcen abhängen. Demgegenüber soll die Fairness von<br />
Verhandlungen über eine Regulierung durch Verfahren hergestellt werden.<br />
Zum einen zielen diese Verfahren darauf ab, die anders als im Diskurs nicht<br />
neutralisierbare Verhandlungsmacht der beteiligten Parteien zu „disziplinieren“.<br />
Hier geht es um eine gewissermaßen funktionale Bestimmung der Fairness von<br />
Verfahren, die so zu gestalten wären, dass sie „allen Interessenten gleiche Chancen<br />
der Teilnahme an den Verhandlungen sichern <strong>und</strong> während der Verhandlungen<br />
gleiche Chancen gegenseitiger Einflussnahme aufeinander einräumen“ (Habermas<br />
1992: 205f.). Durch diese Gleichheitsforderung scheint die anvisierte<br />
Regulierung auf der Verfahrensebene selbst die gr<strong>und</strong>sätzliche Differenz zwi-<br />
46<br />
47<br />
48<br />
Dann sind nicht nur moralische <strong>und</strong> ethisch politische, sondern auch pragmatische Diskurse<br />
hinfällig, da letztere ja einen Wertkonsens voraussetzen.<br />
Vgl. dazu Habermas 1986: 173 <strong>und</strong> 1992: 204f.<br />
Vgl. dazu Habermas 1992: 204ff.
26<br />
schen Argumentieren <strong>und</strong> Verhandeln einzuebnen. Wie es jedoch möglich sein<br />
sollte, durch Verhandlungsprozeduren „gleiche Chancen der gegenseitigen Einflussnahme“<br />
zu sichern, wenn nicht allein der „zwanglose Zwang“ des besseren<br />
Arguments, sondern die ungeachtet der Verhandlungsformen vorhandenen unterschiedlichen<br />
Machtressourcen der Parteien das Ergebnis entscheiden, bleibt rätselhaft.<br />
Im machtgestützten Aushandeln von Kompromissen sind Verfahren eher<br />
zivilisierende Umgangsformen als Fairness sichernde Normen.<br />
Zum zweiten bindet Habermas die Verfahren der Kompromissbildung auf der<br />
Metaebene ihrer Legitimation direkt an das Diskursprinzip zurück, indem er fordert,<br />
die Verfahrensbedingungen müssten in moralischen Diskursen gerechtfertigt<br />
werden. 49 Das ist leicht gesagt. Der Sprung auf die Metaebene scheint mir im<br />
Zusammenhang von Verhandlungen aber besonders problematisch, da es hier ja<br />
in der Definition von Habermas selbst um Probleme oder Konflikte geht, zu denen<br />
sich die Verallgemeinerbarkeit eines Interesses oder der Vorrang eines Wertes<br />
nicht vernünftig begründen lässt. Die Annahme, eine durch Vernunftgründe<br />
motivierte Verständigung sei allein dadurch möglich, dass die Ebene des substantiellen<br />
Konfliktes verlassen <strong>und</strong> auf einer Metaebene über Verfahrensregeln entschieden<br />
wird, halte ich weder für empirisch wahrscheinlich, noch argumentativ<br />
überzeugend. Viel eher ist doch zu erwarten, dass auch die Metaebene der Verfahrensregelung<br />
nicht vollständig von der unterschiedlichen Verhandlungsmacht<br />
der Parteien frei gehalten werden kann.<br />
6. Das volitive Moment der Rechtsetzung<br />
Durch die skizzierte Differenzierung von Diskurstypen <strong>und</strong> die zusätzliche Einbeziehung<br />
von Verhandlungen kann Habermas seine Theorie der Wirklichkeit<br />
politischer Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung annähern <strong>und</strong> dem oben zitierten<br />
Vorwurf, den Gegenstandsbereich des Politischen zu verfehlen, aufs erste den<br />
Wind aus den Segeln nehmen. Bei genauerer Betrachtung weist seine Differenzierung<br />
zwei analytisch zu trennende Aspekte auf, von denen allenfalls der erste<br />
einigermaßen plausibel scheint, der zweite aber direkt ins Zentrum der Problematik<br />
einer diskurstheoretischen Begründung der Demokratie führt.<br />
Habermas unterscheidet Diskurstypen <strong>und</strong> Verhandlung ausgehend von der<br />
Art der regelungsbedürftigen Materie <strong>und</strong> den ihr jeweils angemessenen Argumenten.<br />
Daraus folgt erstens eine unterschiedliche Größe des Kreises der Betroffenen,<br />
bzw. des erforderlichen Verallgemeinerungsgrades der Ergebnisse. In der<br />
49<br />
Vgl. ebd.
27<br />
Tendenz weitet sich der Kreis der Betroffenen, deren zwanglose Zustimmung<br />
erforderlich ist, von den Verhandlungen über pragmatische <strong>und</strong> ethisch- politische<br />
Diskurse bis zum Universalisierungsgr<strong>und</strong>satz des vollständig dekontextualisierten<br />
moralischen Diskurses immer mehr. Für weite Bereiche der politischen<br />
Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung verlangt das Diskursprinzip demnach nicht eine<br />
Anwendung des Universalisierungsgr<strong>und</strong>satzes, sondern lediglich einen Verallgemeinerungstest<br />
in den vom jeweiligen Diskurstyp <strong>und</strong> seinem Betroffenenkreis<br />
gezogenen Grenzen. Allerdings wird dieser, gewissermaßen politisierende Gewinn<br />
der gesamten Operation sofort wieder relativiert, indem Habermas fordert,<br />
die Ergebnisse ethisch-politischer Diskurse müssten mit moralischen Gr<strong>und</strong>sätzen<br />
kompatibel sein <strong>und</strong> die Verfahren von Verhandlungen durch moralische<br />
Diskurse gerechtfertigt werden. 50 Die Rationalität der verschiedenen politisch<br />
relevanten Diskursarten bleibt damit ebenso wie die von Verhandlungen rückgeb<strong>und</strong>en<br />
an die Rationalität moralischer Diskurse. Erinnern wir uns an das eigentliche<br />
Vorhaben von Habermas, nämlich ausgehend von der Formulierung eines<br />
allgemeinen Diskursprinzips zu zeigen, dass positives Recht <strong>und</strong> Moral gleich<br />
ursprünglich sind <strong>und</strong> „das Demokratieprinzip eigene, vom Moralprinzip unabhängige<br />
Wurzeln hat“ (Habermas 1994: 664), so stellt sich die Frage, ob dieses<br />
Vorhaben nicht bereits hier gescheitert ist <strong>und</strong> es doch dabei bleibt, die Moral<br />
dem rechtsetzenden demokratischen Prozess vorzuordnen. Denn es ist doch weiter<br />
so, „dass der moralische Diskurs den Fluchtpunkt bildet, vor dessen Hintergr<strong>und</strong><br />
sich die rationale Bonität von Handlungsnormen überhaupt <strong>und</strong> damit auch<br />
rechtlicher Normen beurteilen lässt“ (Blanke 1994: 453).<br />
Zweitens soll in Prozessen der Rechtsetzung, da sich hier ja die Entscheidung<br />
über Normen für kollektive Zwecksetzungen öffnet, das „volitive Element der<br />
Entscheidung gegenüber dem kognitiven der Urteils- <strong>und</strong> Meinungsbildung“<br />
stärker ins Gewicht fallen als im moralischen Diskurs (Habermas 1996a: 352).<br />
Dies gelte umso mehr,<br />
a) je kontextabhängiger die nicht-moralischen Gründe sind <strong>und</strong> je größer die<br />
„Kontingenz der Lebensform, der Ziele <strong>und</strong> Interessenlagen, die vorgängig die<br />
Identität des sich selbst bestimmenden Willens festlegen“ (Habermas 1992: 195)<br />
<strong>und</strong><br />
b) je stärker „eine Gesellschaft die Verfolgung kollektiver Ziele im Staat konzentriert“<br />
(ebd.: 189).<br />
Den zweiten Punkt, der das Verhältnis von Staat <strong>und</strong> Gesellschaft bzw. von<br />
Politik <strong>und</strong> Ökonomie berührt, möchte ich hier zurückstellen. Festzuhalten bleibt<br />
50<br />
Vgl. dazu Habermas 1992: 206.
28<br />
aber schon hier, dass nach dieser Bestimmung das Ausmaß politischer Regulierung<br />
abhängt vom Ausmaß einer nicht moralisch begründeten Normierung der<br />
Gesellschaft durch das Recht, bzw. umgekehrt, die moralische Normierung die<br />
Möglichkeiten der politischen Gestaltung einschränkt.<br />
Der für die Frage der Rationalität politischer Willensbildung entscheidende<br />
Punkt a) scheint auf den ersten Blick einen Raum der Dezision zu eröffnen. Eine<br />
vordergründige Lesart der Formulierungen von Habermas könnte jedenfalls das<br />
größere Gewicht des volitiven gegenüber dem kognitiven Element oder, wie es<br />
an anderer Stelle heißt, des Moments der Entscheidung gegenüber dem der Urteils-<br />
<strong>und</strong> Willensbildung 51 , so verstehen. Für eine solche Interpretation ließe<br />
sich zudem die Verwendung des Kontingenzbegriffes in Feld führen. Habermas<br />
wäre damit aber missverstanden. Mit dem Kontingenzbegriff bezeichnet er lediglich<br />
die Unmöglichkeit, kontextspezifische Fragen durch Anwendung des Universalisierungsprinzips<br />
der Moral zu entscheiden, nicht die Optionen eines handelnden<br />
Subjektes. Moralische Gründe haben für Rechtsfragen keine hinreichende<br />
Selektivität <strong>und</strong> müssen sich deshalb mit weiteren, kontextabhängigen Gründen<br />
verbinden. 52 Mit der aus ihrer Kontextabhängigkeit folgenden Relativität<br />
nicht-moralischer Gründe, <strong>und</strong> keineswegs mit Handlungsoptionen, erklärt Habermas<br />
auch das stärkere Gewicht des „volitiven Moments“ in der politischen<br />
Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung. 53 Dies ermöglicht es ihm daran festzuhalten,<br />
dass im gegebenen Kontext die Beteiligten die Gründe rational beurteilen <strong>und</strong> ein<br />
Einverständnis über ihre Geltung herstellen können, Gründe also keineswegs ins<br />
Belieben oder auch nur in die jeweilige Perspektive der beteiligten Gruppen oder<br />
Individuen gestellt sind. Im jeweiligen Kontext bleibt die Selbstbestimmungspraxis<br />
der Bürger durch das Diskursprinzip ein kognitiver Vorgang.<br />
Ungeachtet der Rede von einem „volitiven Moment“ bleibt ein Handlungsspielraum<br />
von Subjekten, die Möglichkeit sich so oder auch anders zu entscheiden,<br />
ausgeschlossen. Es prozessiert auch hier im zwanglosen Zwang des besseren<br />
Arguments die Vernunft, die lediglich mehr oder weniger kontextgeb<strong>und</strong>en, bzw.<br />
umgekehrt, mehr oder weniger universalisierbar ist. Damit verschwindet aus der<br />
Demokratietheorie nicht nur das kollektive Selbst der Selbstregierung, bzw. das<br />
„Volk als ein handlungsfähiges Makrosubjekt“ (Habermas 1996: 161), sondern<br />
jedes handlungsfähige Subjekt überhaupt. Die Ausdifferenzierung des Diskurs-<br />
51<br />
52<br />
53<br />
Vgl. Habermas 1996a: 352.<br />
„Während der moralisch gute Wille in praktischer Vernunft gleichsam aufgeht, behält auch<br />
der vernünftig begründete politische Wille Kontingenz in dem Maße, wie die Gründe selbst<br />
nur relativ auf zufällige Kontexte gelten“ (Habermas 1992: 195).<br />
Vgl. ebd.
29<br />
begriffes <strong>und</strong> die Rede von „Kontingenz“ <strong>und</strong> „volitiven Momenten“ bei Habermas<br />
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ihm auch in pragmatischen <strong>und</strong><br />
ethisch-politischen Diskursen um „subjektlose Kommunikationen“, um eine „höherstufige<br />
Intersubjektivität“ 54 ohne handelnde Subjekte geht. William Rehg, ein<br />
Habermas gewiss wohlgesonnener Autor, fragt bezogen auf die subjektlosen<br />
Verfahren diskursiver Willensbildung, wie denn sicherzustellen sei, dass hier<br />
nicht die Individuen außer Sicht gerieten zugunsten einer „huge procedural machine<br />
cranking presumably correct results independently of human subjects“<br />
(Rehg 1994: 237). Im Gr<strong>und</strong>e wird hier Freiheit eliminiert, wenn wir sie mit A-<br />
rendt in der Möglichkeit von Personen sehen, einen Prozess durch ihr spontanes<br />
Handeln zu unterbrechen <strong>und</strong> damit einen Neuanfang zu setzen.<br />
Habermas hält trotz aller Differenzierung <strong>und</strong> Komplexitätssteigerung, die<br />
seine Theorie kommunikativer Rationalität in „Faktizität <strong>und</strong> Geltung“ erfährt,<br />
an der Wahrheitsfähigkeit nicht nur der moralischen Diskurse, sondern auch der<br />
rechtsetzenden demokratischen Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung fest. Er gesteht in<br />
einer Auseinandersetzung mit McCarthy 55 zwar zu, dass wir anders als bei empirischen<br />
Aussagen über die objektive Welt „in Ansehung der normativen Regelung<br />
von Interaktionen (vielleicht) nicht a priori mit der Geltung des Bivalenzprinzips<br />
rechnen (sollten)“ (Habermas 1996a: 336). Dennoch kommt er zum<br />
Schluss, wir dürften die Prämisse der „einen richtigen Antwort“ nicht fallen lassen<br />
„wenn nicht der demokratische Prozess zugleich mit der ihm innewohnenden<br />
Verfahrensrationalität auch seine legitimierende Kraft verlieren sollte“ (Habermas<br />
1996a: 336). Zwar wird der öffentliche Diskurs in aller Regel durch Mehrheitsentscheidungen<br />
beendet, eine Tatsache, die auch Habermas nicht bestreiten<br />
kann. Sie wird jedoch zu einer lediglich akzidentellen <strong>und</strong> vorläufigen Unterbrechung<br />
des prinzipiell unendlichen Argumentationsprozesses umdefiniert, der ü-<br />
ber die Gültigkeit des Bivalenzprinzips eine interne Beziehung zur Wahrheitssuche<br />
behalten soll. 56<br />
54<br />
55<br />
56<br />
Zu diesen Begriffen vgl. Habermas 1992: 362.<br />
McCarthy bezweifelt die von Habermas unterstellte Parallelität zwischen normativen <strong>und</strong><br />
propositionalen Geltungsansprüchen <strong>und</strong> versucht zu zeigen, dass die Argumente, die wir in<br />
Auseinandersetzungen zu normativen Fragen anführen können, im Gegensatz zu denen im<br />
theoretischen Diskurs stets von spezifischen kulturellen Kontexten abhängen, aus denen sie<br />
erst ihre Überzeugungskraft beziehen. Aufgr<strong>und</strong> dessen weist er die strikte Trennung zwischen<br />
Fragen der Gerechtigkeit <strong>und</strong> des „guten Lebens“ zurück <strong>und</strong> bezweifelt, dass Habermas’<br />
rationaler Konsens ein angemessenes normatives Ideal für demokratische Politik<br />
abgeben kann (Vgl. McCarthy 1994).<br />
Zur Mehrheitsregel als Unterbrechung des Argumentationsprozesses vgl. Habermas 1996a:<br />
326.
30<br />
7. Die unaufhebbare Vielfalt der Gründe<br />
Die obige, im Streit mit McCarthy eingenommene Position hat zweifellos etwas<br />
vom sprichwörtlichen „dass nicht sein kann, was nicht sein darf“. 57 Zudem ist sie<br />
hochgradig kontraintuitiv. Die Legitimität demokratischer Entscheidungen an der<br />
Annahme festzumachen, es sei genau eine richtige Lösung der diskutierten Probleme<br />
möglich, mag aus der Perspektive des Theoretikers, der das Spannungsverhältnis<br />
zwischen individueller Autonomie <strong>und</strong> kollektiver Selbstregierung durch<br />
seinen Begriff kommunikativer Rationalität auflösen will, zwingend erscheinen.<br />
Für die Teilnehmer am demokratischen Prozess gilt jedoch das Gegenteil: Sie<br />
müssen rechtmäßig zustande gekommene Entscheidungen, sei es in inhaltlichen<br />
oder in prozeduralen Fragen, als legitim akzeptieren, auch wenn sie sie für falsch<br />
halten. Habermas Prämisse der „einen richtigen Antwort“ auf die im demokratischen<br />
Prozess zu entscheidenden Fragen erinnert an Rousseaus Aussage, wonach<br />
es nur einen Gemeinwillen geben kann <strong>und</strong> derjenige, der in Mehrheitsentscheidungen<br />
überstimmt werde, sich eben geirrt habe, da es nicht der Gemeinwille<br />
war, was er dafür gehalten hat. 58 Wir werden weiter unten noch sehen, dass diese<br />
Parallelität keineswegs zufällig ist, sondern ihre Ursache in der, bei allen Unterschieden,<br />
von Rousseau wie von Habermas vorgenommenen Rückführung der<br />
57<br />
58<br />
Ausführlich setzt sich Habermas mit der Gültigkeit des Bivalenzprinzips für Fragen der<br />
normativen Richtigkeit in seinem Aufsatz „Richtigkeit vs. Wahrheit“ auseinander. Dabei<br />
geht es ihm genauer darum, den rechtfertigungstranszendenten Weltbezug, mit dem wir<br />
Fragen deskriptiver Wahrheit jenseits des Diskurses entscheiden können, durch die „Orientierung<br />
an einer Erweiterung der Grenzen der sozialen Gemeinschaft <strong>und</strong> ihres Wertekonsenses“<br />
zu ersetzen (Habermas 1998a: 195). Das Bivalenzprinzip, die Orientierung auf eine<br />
einzig richtige Antwort, ist also demnach auch in moralischen Fragen möglich, sofern wir<br />
unterstellen, „dass sich die gültige Moral auf eine einzige, alle Ansprüche <strong>und</strong> Personen<br />
gleichmäßig einbeziehende soziale Welt erstreckt“ (ebd.: 197). Diese soziale Welt, an der<br />
sich die Richtigkeit von Normen zu bewähren hat, sei allerdings nicht gegeben, sondern uns<br />
als Projekt einer „vollständig inklusiven Welt“ „aufgegeben“ (ebd.). Demnach ist der kognitive<br />
Charakter der Moral an das geschichtsphilosophische Projekt der Herstellung einer<br />
„vollständig inklusiven Welt“ geb<strong>und</strong>en, das bekanntlich seinerseits alles andere als konsensfähig<br />
ist. Zwei Aspekte dieser Verteidigung des Bivalenzprinzips scheinen mir bemerkenswert.<br />
Zum einen verlangt Habermas damit von partikularen Gemeinschaften, die Perspektive<br />
ihrer Selbstauflösung zum letzten Bezugspunkt der Entscheidungen über ihre Normen<br />
zu machen. Zum zweiten kann der Standpunkt einer vollständig inklusiven Welt, von<br />
dem aus kontroverse Argumente zu prüfen sind, real von keinem Bewusstsein <strong>und</strong> keiner<br />
Prozedur eingenommen werden. Es ist ziemlich genau der Standpunkt des „lieben Gottes“.<br />
Vgl. dazu Rousseau 1997: 172. Eine auf die “Federalist Papers” zurückgehende Gegenposition<br />
im Verständnis des Politischen formuliert Ruth Grant: „The premise of every truly political<br />
situation, particularly in democratic politics, is that reasonable people can disagree“<br />
(Grant 2002: 582). Dies ist auch die Position von Hannah Arendt. Im Gegensatz zum Bivalenzprinzip<br />
des wahrheitsfähigen Diskurses bei Habermas formuliert sie „Public debate can<br />
only deal with things which we cannot figure out with certainty“ (Arendt 1979: 317).
31<br />
Demokratie auf ein durch Vernunft bestimmtes Autonomieprinzip hat.<br />
Die Verteidigung der Habermaschen Position hängt an der Unterstellung, es<br />
gäbe innerhalb der jeweiligen Diskursart Gründe, die von allen Beteiligten über<br />
den „zwanglosen Zwang des besseren Arguments“ zu akzeptieren wären. Genau<br />
dies lässt sich jedoch plausibel bezweifeln. Krause/Malowitz weisen darauf hin,<br />
dass der Status eines Gr<strong>und</strong>es nicht mit Hilfe einfacher Prädikate wie „ist gleichermaßen<br />
gut für alle“, „ist fair“ etc. erklärt werden kann. Gründe stünden nicht<br />
für sich selbst, „sondern verdanken ihre begründende Funktion vielmehr ihrer<br />
Stelle innerhalb einer umfassenden Argumentation“ (Krause/Malowitz 1999:<br />
293). Wir müssen also die Argumentationsspiele kennen, innerhalb der Gründe<br />
ihre begründende Funktion wahrnehmen, was wiederum impliziert, dass wir<br />
Gründe nicht von Sprachspielen, Lebensformen <strong>und</strong> Identitäten trennen können.<br />
Die Beteiligten eines Diskurses stehen innerhalb einer pluralistischen Gesellschaft<br />
vor dem Problem, in welchem Vokabular bzw. in welchen Argumentationszusammenhängen<br />
sie ein Einverständnis überhaupt anstreben können. 59 Ähnlich<br />
argumentiert Frank Nullmeier, wenn er auf die unendliche Vielzahl potentieller<br />
Gründe verweist, <strong>und</strong> ausführt, dass sie ihren Status <strong>und</strong> ihre Geltungskraft<br />
als Gründe nicht per se, sondern nur kontextgeb<strong>und</strong>en, im Rahmen eines kulturellen<br />
Hintergr<strong>und</strong>wissens oder der Sondersprachen von Experten, erlangen. Von<br />
hier aus bezweifelt er die Annahme, gute Gründe besäßen die Fähigkeit, Zustimmung<br />
zu erzwingen. Können sie dies nicht, lässt sich in einer pluralistischen<br />
Gesellschaft aber auch unter den politisch ohnehin nicht zu realisierenden Bedingungen<br />
eines idealen Diskurses mit uneingeschränkten Zeitressourcen die Vielfalt<br />
widerstreitender Geltungsansprüche nicht überwinden.<br />
„In der Vielfalt der mobilisierbaren Gründe findet sich kein Moment, das<br />
jenseits des logischen noch einen solchen argumentativen Zwang ausübt,<br />
dass eine eindeutige Geltungszuschreibung auch unter sonst idealen Bedingungen<br />
möglich wäre“ (Nullmeier 1995: 105). 60<br />
Mit dem Geltungszwang qua besserem Argument entfällt dann aber auch die<br />
59<br />
60<br />
Dies scheint mir die allgemeinere Formulierung eines häufig gegen Habermas vorgetragenen<br />
Einwandes zu sein, mit dem auf die Unmöglichkeit verwiesen wird, kontexttranszendierende<br />
moralische Diskurse analytisch klar von kulturell geb<strong>und</strong>enen ethischen Diskursen zu<br />
unterscheiden. In diesem Sinn vgl. etwa McCarthy 1994.<br />
Dieser Einwand lässt sich gr<strong>und</strong>sätzlicher in Begriffen der poststrukturalistischen Sprachphilosophie<br />
formulieren (vgl. etwa Mouffe 1997). Da es hier jedoch nicht um den philosophischen<br />
Streit zwischen Habermas einerseits <strong>und</strong> poststrukturalistischen Autoren andererseits<br />
geht, reicht m.E. an dieser Stelle der Hinweis auf die unaufhebbare empirische Vielfalt<br />
widerstreitender Gründe.
32<br />
Möglichkeit zur rationalen, mit dem Autonomieprinzip zu vereinbarenden Legitimation<br />
politischer Entscheidungen durch Diskurse. Die Vorstellung einer rein<br />
kommunikativen, durch rationale Zustimmung erzeugten Macht erweist sich als<br />
illusionär <strong>und</strong> für deliberative Demokratiekonzeptionen taucht die Frage nach der<br />
Macht hinter den Argumenten erneut auf.<br />
8. Die Verfehlung des Politischen im Autonomieprinzip<br />
Der Leser, der sich durch Habermas’ Unterscheidung der verschiedenen Diskursarten<br />
<strong>und</strong> ihres komplexen Rückbezugs auf das Prinzip der rationalen Entscheidbarkeit<br />
von Geltungsansprüchen durcharbeitet, fragt sich früher oder später, warum<br />
er, bzw. auch der Autor, sich das antut. Es liegt auf der Hand, dass die e-<br />
normen Begründungsprobleme, mit denen Habermas sich in einer mittlerweile<br />
kaum mehr überschaubaren Literaturfülle herumschlägt, aus dem diskurstheoretischen<br />
Vernunftanspruch seiner Demokratiekonzeption entstehen. Warum folgt er<br />
dann aber nicht dem Beispiel eines anderen Protagonisten der deliberativen Demokratietheorie,<br />
Bernard Manin, der in Abgrenzung zur Konsensorientierung<br />
von Habermas feststellt, das bessere Argument sei einfach dasjenige, das mehr<br />
Unterstützung generiere, nicht dasjenige, das fähig sei, alle Teilnehmer zu überzeugen?<br />
61 Auch nach Manin soll der deliberative Prozess ein höheres Rationalitätsniveau<br />
sichern als es durch bloße Dezision oder durch die Aggregation von<br />
Präferenzen möglich wäre. Dennoch hält er explizit an einer irreduziblen Differenz<br />
zwischen politischer Deliberation <strong>und</strong> wissenschaftlicher Argumentation<br />
fest. In der politischen Sphäre erlaube es auch ein ideal gedachter Deliberationsprozess<br />
nicht, zu universell akzeptierten Wahrheiten oder zu einer unbestreitbaren<br />
Zurückweisung von Normen <strong>und</strong> Werten zu gelangen. Politische Rechtfertigungen<br />
blieben trotz der prozeduralen Regeln der Deliberation relativ <strong>und</strong> kontextbezogen.<br />
62<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Reduktion des Allgemeinheitsanspruches bezieht das Ergebnis<br />
einer deliberativen Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung bei Manin den Status rationaler<br />
Akzeptabilität letztlich aus der größeren Zahl derjenigen, die in ihm die vergleichsweise<br />
bessere Alternative sehen. Damit bleibt am Ende der Beratungen<br />
der Abstimmungsprozess, <strong>und</strong> das heißt das Entscheidungshandeln der beteiligten<br />
Individuen, der Bezugspunkt demokratischer Legitimation. Für Habermas ist<br />
61<br />
62<br />
„Given the appropriate procedural rules for deliberation, the better argument is simply the<br />
one that generates more support and not the one that is able to convince all participants”<br />
(Manin 1987: 367).<br />
Vgl. Manin 1987: 354f.
33<br />
eine derartige partielle Zurücknahme des kognitiven Anspruches politischer Deliberation<br />
inakzeptabel, weil sie es unmöglich macht, weiter zu unterstellen, dass<br />
prinzipiell alle Beteiligten den Ergebnissen der diskursiven Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung<br />
durch den zwanglosen Zwang des besseren Arguments zustimmen<br />
könnten.<br />
Nehme ich den Ergebnissen der politischen Willensbildung den starken Vernunftanspruch,<br />
so öffne ich den politischen Raum für begründete Differenzen.<br />
Die am demokratischen Prozess Beteiligten können den vorgetragenen Argumenten<br />
dann aus jeweils unterschiedlichen Gründen zustimmen oder ihre Zustimmung<br />
auch verweigern. Wenn so oder auch anders entschieden werden kann, bietet<br />
die auch von Manin der Mehrheit zugesprochene Vernunftvermutung aber<br />
keinen tragfähigen letzten Legitimationsgr<strong>und</strong> des demokratischen Prozesses.<br />
Ohne Orientierung am Bivalenzprinzip ist Einheit im Bereich der Politik nicht<br />
kognitiv, aus der zwanglosen Zustimmung zur einzig vernünftigen Entscheidung<br />
herzustellen. Die deliberativen Verfahren mögen dann durchaus noch geeignet<br />
sein, die Qualität der politischen Willensbildung zu verbessern. Wenn das deliberative<br />
Verfahren der politischen Willensbildung jedoch kein „wahres“ Ergebnis<br />
hervorbringen kann, dann lässt es sich im strengen Sinn nicht als Verwirklichung<br />
öffentlicher Autonomie denken, weil ganz einfach die Gründe fehlen, die jedes<br />
vernunftbegabte Individuum zur „zwanglosen“ Zustimmung zwingen könnten.<br />
Die Bereitschaft, das Ergebnis einer praktisch erforderlichen Abstimmung zu<br />
akzeptieren, kann für die unterlegene Minderheit dann auch nicht aus dem kognitiven<br />
Charakter des deliberativen Verfahrens allein stammen. Wenn für die<br />
Mehrheitsregel die von Habermas immer wieder bemühte „interne Beziehung zur<br />
Wahrheitssuche“ 63 nicht plausibel reklamiert werden kann, stellt sich erneut die<br />
Frage nach einer der Deliberation vorausgehenden Gemeinsamkeit, die eine unterlegende<br />
Minderheit erst motivieren könnte, den Mehrheitsbeschluss zumindest<br />
bis auf weiteres zu akzeptieren. Genau das ist auch die Konsequenz eines Einwandes<br />
von William Rehg, der es allein schon aufgr<strong>und</strong> der zeitlichen Einschränkungen,<br />
denen rechtlich institutionalisierte Beratungen in der politischen<br />
Willensbildung unterliegen, für unmöglich hält, ihre legitimierende Kraft allein<br />
aus der kognitiven Quelle von Diskursen zu beziehen. Sie bedürfe vielmehr der<br />
Ergänzung durch vorgängiges Vertrauen <strong>und</strong> sittlicher Bindung der Beteiligten.<br />
Rehg will damit Solidarität als eine vom Diskurs unabhängige Quelle der Legi-<br />
63<br />
Vgl. etwa Habermas 1992: 220, 613.
34<br />
timität einführen <strong>und</strong> unterstreicht damit die Bedeutung von Zugehörigkeiten. 64<br />
Die aufs engste mit dem Autonomieanspruch verb<strong>und</strong>ene kognitive Bestimmung<br />
der Deliberation in der Theorie von Habermas drängt demnach drei Aspekte<br />
demokratischer Politik in den Hintergr<strong>und</strong>: erstens den Handlungsaspekt (<strong>und</strong><br />
zwar sowohl in bezug auf die Bürger als auch auf ihre parlamentarischen Repräsentanten)<br />
zugunsten einer prozeduralisierten, anonym <strong>und</strong> subjektlos gewordenen<br />
Volkssouveränität; zweitens den Aspekt des Urteilens <strong>und</strong> der Entscheidung<br />
zugunsten des kognitiven Charakters der verschiedenen Deliberationsprozesse,<br />
sowie schließlich drittens, in engstem Zusammenhang damit, den Aspekt der Zugehörigkeit<br />
zu einer partikularen Gemeinschaft durch die prinzipiell universalisierbare,<br />
gleiche Chance zur Teilnahme an problemorientierten Beratungen. Alle<br />
drei Aspekte sollen im Folgenden noch einmal vertieft werden.<br />
9. Differenz- versus Einheitsrepräsentation <strong>und</strong> die Möglichkeiten politischen<br />
Handelns<br />
Ernst Vollrath hat in einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit dem Werk<br />
von Jürgen Habermas immer wieder argumentiert, Habermas übertrage in der<br />
Tradition des deutschen Idealismus das Konzept der reflexionsmoralischen<br />
Selbstbestimmung ins Politische. Die im deutschen Staatsrecht dominierende<br />
Wahrnehmung des Staates unter der Kategorie der Herrschaft (<strong>und</strong> nicht des Regierens)<br />
werde in dieser meta- oder idealpolitischen „Apperzeption des Politischen“<br />
ersetzt durch das aus der Moralphilosophie stammende Konzept der absolut<br />
autonomen Selbstbestimmung. Die Dichotomie zwischen einer realpolitischen,<br />
staats- <strong>und</strong> herrschaftsbezogenen <strong>und</strong> einer ideal- oder metapolitischen<br />
Wahrnehmung des Politischen sei kennzeichnend für den deutschen Kulturraum.<br />
Schon für Kant bilde der Staat, unter dem Einfluss Rousseaus, in der „Idee“ der<br />
Vernunft die „Einheit der personalen Gleichheit als der Freiheit qua absoluter<br />
autonomer Selbstbestimmung aller“ (Vollrath 1995: 181). 65 An diesem Verständnis<br />
von Selbstbestimmung halte Habermas fest, „ohne je die Frage zu stellen,<br />
ob dieses Verständnis von Freiheit <strong>und</strong> Autonomie einen politischen Sinn<br />
haben kann“ (ebd.).<br />
Demgegenüber bezieht sich Vollrath auf die Anerkennung nicht nur einer unaufhebbaren<br />
Differentialität, sondern der Vernünftigkeit dieser Differentialität<br />
64<br />
65<br />
Vgl. dazu Rehg 1994. Habermas weist dies nicht sehr überzeugend zurück, indem er die<br />
solidaritätsstiftende Wirkung von ihrerseits wiederum kognitiv zu bestimmenden Verfahren<br />
einführt (vgl. Habermas 1996a: 349-353).<br />
Ähnlich auch Vollrath 1982, 1989 <strong>und</strong> 1996.
35<br />
durch die „Federalist Papers“. 66 Im Bereich des Politischen könne Selbstbestimmung<br />
nicht reflexiv, sondern nur transitiv verstanden werden. Es bedeute nicht,<br />
sich selbst zu bestimmen, sondern lediglich „Selbst zu bestimmen, durch wen<br />
<strong>und</strong> wie man regiert werden will (Self-Government)“ (Vollrath 1995: 183). Das<br />
politische Gegenkonzept zu der durch rationale Deliberation erstrebten reflexiven<br />
Autonomie ist demnach eine beschränkte Autonomie in der Verteilung wechselseitiger<br />
Heteronomie durch gegenseitige Kontrolle <strong>und</strong> Beschränkungen. 67<br />
Vollraths Rekurs auf einen reflexionsmoralischen Autonomiebegriff im Kern<br />
der diskurstheoretischen Demokratietheorie <strong>und</strong> sein Vergleich mit dem angelsächsischen<br />
Modell der beschränkten Selbstregierung werfen ein erhellendes<br />
Licht auf die bislang erörterten Probleme. Insbesondere lässt sich von hier aus<br />
verdeutlichen, wie durch die kognitive Bestimmung des Deliberationsprozesses<br />
„ein Vernunftmoment ins Spiel (kommt), das den Sinn der Repräsentation verändert“<br />
(Habermas 1992: 223). Wie sich zeigen lässt, verändert es ihn so, dass die<br />
Handlungspotentiale des Repräsentationsprinzips verloren gehen.<br />
Halten wir zunächst aber als Gemeinsamkeit zwischen der deliberativen Demokratietheorie<br />
Habermas` <strong>und</strong> der repräsentativen Demokratie im Sinn der USamerikanischen<br />
Gründungsväter das Ziel fest, eine demokratische Republik zu<br />
denken, ohne ein einheitliches Großsubjekt der Selbstregierung unterstellen zu<br />
müssen. Dabei geht es um ein genuin liberales Anliegen: Die Demokratie soll<br />
nicht mit der Subsumtion der Individuen unter das Kollektivsubjekt des einheitlichen<br />
Volkes oder der homogenen Nation erkauft werden. Während Hamilton <strong>und</strong><br />
Madison dabei einen alten Vorbehalt des politischen Denkens gegen die Demokratie<br />
aufgreifen <strong>und</strong> sich in elitär-konservativer Absicht vor einer drohenden<br />
Herrschaft der besitzlosen Massen schützen wollen, 68 möchte Habermas mit seiner<br />
Auflösung des Kollektivsubjektes der Selbstregierung die Voraussetzungen<br />
für den Nationalismus <strong>und</strong> die totalen Herrschaftsformen des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
beseitigen, zugleich jedoch an einem weitestgehenden Inklusions- <strong>und</strong> Partizipationsanspruch<br />
für den „Demos“ festhalten.<br />
Zu dieser Absicht passt, dass er Repräsentation keineswegs nach dem Stellvertretermodell<br />
deutet. Wie wir bereits gesehen haben, müssen nach Habermas<br />
moralische Diskurse in der Regel advokatorisch, <strong>und</strong> ethisch-politische aus technischen<br />
Gründen repräsentativ geführt werden. Dabei sollen sie jedoch lediglich<br />
den Mittelpunkt einer gesellschaftsweiten Kommunikation bilden <strong>und</strong> für die<br />
66<br />
67<br />
68<br />
Vgl. Vollrath 1989: 228.<br />
Vgl. Vollrath 1995: 184.<br />
Vgl. dazu Buchstein 1997.
36<br />
Teilnahme aller Angehörigen in einer breiteren pluralistischen, basisnahen <strong>und</strong><br />
„machtverdünnten“ Öffentlichkeit durchlässig bleiben. 69 Auf diese Weise glaubt<br />
Habermas, dem Repräsentationsprinzip einen neuen Sinn zu geben <strong>und</strong> die alte<br />
Debatte über die Problematik des Handelns im Namen anderer, das Machtgefälle<br />
zwischen Repräsentanten <strong>und</strong> Repräsentierten <strong>und</strong> insbesondere über das Verhältnis<br />
von Delegation <strong>und</strong> Treuhänderschaft („trustee“) im Repräsentationsprinzip<br />
vermeiden zu können. 70 An die Stelle der asymmetrischen Beziehung zwischen<br />
Repräsentanten <strong>und</strong> Repräsentierten <strong>und</strong> der für ihren Handlungsaspekt<br />
konstitutiven Momente von Beauftragung, Zurechenbarkeit <strong>und</strong> Verantwortung<br />
tritt der Vernunftanspruch der Deliberation. Während die amerikanischen Verfassungsväter<br />
den Gefahren der Einheitsverkörperung im Konzept der demokratischen<br />
Selbstregierung die Pluralisierung der Volkssouveränität in einem System<br />
der „checks and balances“ entgegenstellen, setzt Habermas auf deren Verflüssigung<br />
in der prozeduralisierten Vernunft des Diskurses. Damit scheint er den Gefahren<br />
der Einheitsverkörperung einer substantialistisch verstandenen Volkssouveränität<br />
entkommen <strong>und</strong> gleichzeitig an der umfassenden Inklusion <strong>und</strong> Partizipation<br />
der Bürger festhalten zu können.<br />
Die Problematik dieser Lösung wird jedoch deutlich, wenn wir noch einmal<br />
kurz auf das Repräsentationsprinzip des „Federalist“ zurückkommen. Die amerikanischen<br />
Verfassungsväter begegnen der Vorstellung einer organischen Totalität<br />
im Konzept demokratischer Selbstregierung durch die Anerkennung <strong>und</strong> Institutionalisierung<br />
unaufhebbarer Differenz. Wichtig ist, dass sie dabei nicht nur die<br />
empirische Pluralität der Interessen anerkannten, sondern darüber hinaus die<br />
Vernünftigkeit unaufhebbarer Meinungsverschiedenheiten. Einmütigkeit ist nach<br />
Madison nur von politisch gefährlichen, gemeinsamen Leidenschaften zu erwarten,<br />
der freie Gebrauch der Vernunft aber führe unweigerlich zu verschiedenen<br />
Meinungen. 71 Aus dieser Überlegung folgt eine gr<strong>und</strong>sätzliche Legitimierung des<br />
Konflikts <strong>und</strong> der politischen Opposition. Darüber hinaus bietet sie neben der<br />
Absicht, eine Despotie der Mehrheit zu verhindern eine weitere Begründung der<br />
Institutionalisierung der Gewaltenteilung bzw. des Systems von „checks and ba-<br />
69<br />
70<br />
71<br />
Vgl. dazu Habermas 1992: 223f.<br />
Für einen Überblick zur Diskussion um das Repräsentationsprinzip vgl. Hierath 2001.<br />
So heißt es im „Federalist“: „When men exercise their reason cooly and freely on a variety<br />
of distinct questions, they inevitably fall into different opinions on some of them. When<br />
they are governed by a common passion, their opinions, if they are so be called, will be the<br />
same” (Hamilton/Madison/Jay: No. 50, S. 334).
37<br />
lances“. Repräsentation ist hier also Differenzrepräsentation. 72<br />
Die partizipatorisch orientierte Kritik übersieht die handlungsrelevanten Konsequenzen<br />
einer solchen Bestimmung des Repräsentationsprinzips. Repräsentation<br />
gilt ihr vor allem als problematischer Ersatz für die unmittelbare Beteiligung<br />
der Bürger an politischen Entscheidungen. Da der Wille der Repräsentanten mit<br />
dem der Repräsentierten nicht notwendigerweise übereinstimmt, enthält die politische<br />
Repräsentation ein Element der Fremdbestimmung oder Heteronomie, das<br />
Rousseau vor Augen hat, wenn er polemisch formuliert, das englische Volk sei<br />
nur während der Wahl der Parlamentsmitglieder frei, „sobald sie gewählt sind, ist<br />
es Sklave, es ist nichts“ (Rousseau 1977: 158). Demgegenüber unterstreicht<br />
Vollrath, dass Repräsentation im Verhältnis von Beauftragung <strong>und</strong> Verantwortung<br />
ein zurechenbares, einheitliches Handeln Vieler erst ermögliche. In diesem<br />
Sinn schaffe Repräsentation Handlungssubjekte, konkret etwa Verbände, Parteien<br />
<strong>und</strong> Institutionen. 73 Die handlungsermöglichende Dimension des Repräsentationsprinzips<br />
erschließt sich in Gänze jedoch nur, wenn wir die von Rousseau<br />
eingenommene Perspektive auf das Verhältnis zwischen zwei Großakteuren, dem<br />
Volk <strong>und</strong> dem Parlament, verlassen <strong>und</strong> die repräsentierte Differenz in den Blick<br />
nehmen. Dann wird deutlich, dass Repräsentation nicht nur handlungsfähige Einheiten<br />
hervorbringt, sondern das Politische überhaupt erst als einen Bereich verschiedener<br />
identifizierbarer Handlungsoptionen konstituiert.<br />
Hannah Arendt, die gemeinhin als Kritikerin des Repräsentationsprinzips gilt,<br />
verteidigt in ihrer Interpretation der amerikanischen Revolution die politische<br />
Repräsentation mit dem Argument, „die schier unendliche Mannigfaltigkeit der<br />
Meinungen“ bedürfe der „Reinigung <strong>und</strong> Vertretung“ durch „Meinungsrepräsentanten“.<br />
74 In diesem Sinn findet Repräsentation allerdings auch innerhalb einer<br />
Versammlungsdemokratie statt. Wer das Wort ergreift, spricht auch ohne offizielles<br />
Mandat in aller Regel für bzw. gegen etwas oder jemanden. 75 Erst Repräsentation<br />
macht die Differenz der miteinander in Konflikt liegenden <strong>und</strong> um Unterstützung<br />
werbenden Meinungen <strong>und</strong> Programme sichtbar <strong>und</strong> ermöglicht es<br />
dem Bürger, sich zu positionieren <strong>und</strong> einzumischen. Sie ist deshalb Voraussetzung<br />
eines breiten Spektrums von Aktivitäten, das von der Meinungsbildung ü-<br />
72<br />
73<br />
74<br />
75<br />
Zu diesem Begriff vgl. auch Vollrath 1992. Die Gegenüberstellung zwischen einer einheitsverkörpernden<br />
<strong>und</strong> einer die Unaufhebbarkeit von Konflikten symbolisierenden Repräsentation<br />
stammt von Claude Lefort (vgl. etwa Lefort 1990).<br />
Wie Vollrath formuliert, ist Repräsentation „stellvertretende Handlungsschaft“ (Vollrath<br />
1992: 65).<br />
Vgl. dazu Arendt 1974: 292f.<br />
Dazu ausführlicher Urbinati 2000: 764f.
38<br />
ber die aktive Unterstützung einer Position oder Gruppe bis zur Sanktion von<br />
Mandatsträgern im Wahlakt reicht.<br />
Die Prozeduralisierung der Volkssouveränität im vernünftigen Diskurs ersetzt<br />
die in der Repräsentation politischer Differenz sichtbar werdenden Handlungsoptionen<br />
durch das Ideal eines argumentativ zu erreichenden, einheitlichen <strong>und</strong><br />
vernünftigen Willens. Insofern hat das Konzept der diskursiven Meinungs- <strong>und</strong><br />
Willensbildung durchaus einen Rousseauschen Zug 76 , auch wenn Habermas sich<br />
von der Forderung nach einer dem argumentativen Prozess vorausgehenden Homogenität<br />
des Volkes dezidiert abgrenzt. 77 Die Habermassche Version der deliberativen<br />
Demokratie konstruiert jedoch auch in ihrer Ausdifferenzierung zwischen<br />
verschiedenen Diskursarten den demokratischen Entscheidungsprozess als<br />
einen Idealtypus heteronomiefreier Selbstbestimmung. In diesem Zusammenhang<br />
ist die Unterscheidung zwischen kommunikativer <strong>und</strong> administrativer Macht zu<br />
sehen, mit der Habermas sein zweistufiges Gesellschaftsmodell von Lebenswelt<br />
<strong>und</strong> System auf den Bereich demokratischer Politik überträgt. Indem er ein auf<br />
kollektiv bindende Entscheidungen spezialisiertes Teilsystem der Administration<br />
<strong>und</strong> der Konkurrenz um Machtpositionen im Sinne Luhmanns von der kommunikativen<br />
Erzeugung politischer Macht in der diskursiven Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung<br />
unterscheidet, kann er den agonalen Charakter der Politik ins Systemische<br />
abschieben <strong>und</strong> einen „reinen“ Bereich vernünftiger Selbstbestimmung –<br />
eben Autonomie - konstruieren. In einem intersubjektiven Raum, in dem verschiedene<br />
gleichberechtigte Akteure handeln, lässt sich aber – was Hannah A-<br />
rendt wie kaum sonst jemand erkannte – eine reine Autonomie überhaupt nicht<br />
realisieren. Die „vielfältigen Prozesse des Meinungsaustausches, des Hörens <strong>und</strong><br />
Gehörtwerdens“ führen allenfalls zu einer „begrenzten Übereinstimmung“, nicht<br />
aber zu einem einheitlichen Willen, wie Arendt gegen Rousseaus „volonté générale“<br />
einwendet (Arendt 1974: 96). Da im politischen Raum Verschiedene handeln,<br />
nicht der Mensch oder das Volk, ist die Figur vernünftiger Selbstreflexion<br />
hier völlig verfehlt. Hintergründe, Motive <strong>und</strong> Ziele der Akteure unterscheiden<br />
sich auch nach Herstellung einer begrenzten Übereinstimmung. Mehr noch: auch<br />
wenn es zu einem gemeinsamen Handeln kommt, wird dieses von verschiedenen<br />
Akteuren unterschiedlich erfahren <strong>und</strong> erzeugt deshalb, anders als ein einmal erzielter<br />
kognitiver Konsens, sofort wieder neue Differenzen. Unterschiedliche<br />
Bewertungen derselben Handlungen <strong>und</strong> Ereignisse sind insbesondere konstitutiv<br />
für das, was Habermas den ethisch-politischen Diskurs nennt. In ihm soll es ja<br />
76<br />
77<br />
Zu diesem Vorwurf auch McCarthy 1994: 54.<br />
Vlg. etwa Habermas 1996: 164.
39<br />
um das politisch-historische Selbstverständnis von Gemeinschaften gehen. Allein<br />
schon aufgr<strong>und</strong> des narrativen Elements, das die kritische Aneignung von Überlieferungen<br />
enthält, kann hier die Vielfalt möglicher Interpretationen nicht durch<br />
den zwanglosen Zwang des besseren Arguments aus der Welt geschaffen werden.<br />
Sie wird vielmehr vom Diskurs selbst stets neu reproduziert werden. 78<br />
Während also die Pluralisierung der Volkssouveränität durch das Prinzip der<br />
Differenzrepräsentation das Politische als einen Raum optionalen Handelns öffnet,<br />
zielt die Prozeduralisierung der Volkssouveränität im Diskurs auf das eine<br />
vernünftige Ergebnis, das Pluralität <strong>und</strong> Optionalität überwindet.<br />
Es liegt auf der Hand, dass eine derartige Orientierung in der politischen Auseinandersetzung<br />
Interessen <strong>und</strong> Positionen begünstigt, die einen strengen Allgemeinheitsanspruch<br />
geltend machen können. Wie Frank Nullmeier überzeugend<br />
darstellte, kann dies mit Argumentationen, die sich auf eine funktionale, insbesondere<br />
ökonomische Allgemeinheit berufen, besser gelingen als mit ethischen<br />
Argumentationen, die auf die stets kontrovers interpretierbaren Ordnungsprinzipien<br />
<strong>und</strong> Wertvorstellungen einer Gesellschaft <strong>und</strong> ihrer Geschichte rekurrieren.<br />
79 Partikulare Interessen einer besonderen, funktional nicht entscheidenden<br />
Gruppe dürften deshalb in deliberativen Foren <strong>und</strong> Gremien weniger Durchsetzungschancen<br />
besitzen als in den repräsentativen Institutionen des politischen<br />
Systems. Einerseits weil in letzteren durch die Dimension der symbolischen Repräsentation<br />
im Gegensatz zu problemorientierten Foren oder Gremien ein erheblich<br />
größerer Zwang besteht, bei der Legitimation von Entscheidungen auf gemeinschaftsverbürgende<br />
Ordnungsprinzipien, wie etwa das der Sozialstaatlichkeit,<br />
zurückzugreifen. Andererseits aber auch, weil die durch periodische Wahlen<br />
gesicherte Abhängigkeit der Repräsentanten von den Repräsentierten auch nicht<br />
verallgemeinerungsfähigen Interessen eine Chance eröffnet, berücksichtigt zu<br />
werden.<br />
Die Fassung deliberativer Willensbildung als kognitiver Prozess rechtfertigt<br />
also begründete Zweifel am Versprechen einer höheren Inklusivität gegenüber<br />
sog. schwachen Interessen. Darüber hinaus führt sie zu einer bemerkenswerten<br />
Annäherung der demokratischen Willensbildung an einen systemischen Prozess.<br />
Habermas will zwar durch sein zweistufiges Gesellschaftsmodell einen Bereich<br />
der öffentlichen Selbstbestimmung vor der Eigenlogik verselbständigter gesellschaftlicher<br />
Teilsysteme retten. Dadurch dass er diese Selbstbestimmung aber als<br />
einen in subjektlosen Kommunikationskreisläufen stattfindenden Erkenntnispro-<br />
78<br />
79<br />
Ausführlich zu diesem Punkt Zerilli 2005.<br />
Vgl. dazu Nullmeier 2000.
40<br />
zess konzeptualisiert, landet er schließlich dabei, ihn seinerseits als einen Vorgang<br />
zu beschreiben, der sich von einem selbstregulierten systemischen Prozess<br />
kaum mehr unterscheidet. Dies drückt sich nicht nur in sprachlichen Metaphern<br />
aus, etwa wenn Habermas von der „Rückkoppelung“ der administrativen Macht<br />
an die demokratische Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung spricht (Habermas 1992:<br />
364). Ausdrücklich bestimmt er „deliberative Politik als problemlösendes Verfahren<br />
..., das Wissen benötigt <strong>und</strong> verarbeitet, um die Regelung von Konflikten<br />
<strong>und</strong> die Verfolgung kollektiver Ziele zu programmieren“ (Habermas 1992:386).<br />
In einem solchen rationalisierenden „Programmieren“ soll sich dann die Rolle<br />
der demokratischen Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung erschöpfen. „Handeln“ – <strong>und</strong><br />
auch das nur in Anführungszeichen – kann lediglich das auf bindende Entscheidungen<br />
spezialisierte politische System (ebd.: 364). Von daher überrascht es<br />
auch nicht mehr, wenn Habermas schließlich meint, „im diskursiven Vergesellschaftungsmodus<br />
der Rechtsgemeinschaft <strong>und</strong> der demokratischen Verfahren“<br />
sei „nur die reflexive Aufstufung <strong>und</strong> spezialisierte Anwendung einer allgemeinen<br />
Operationsweise gesellschaftlicher Systeme zu erkennen“ (ebd.: 388).<br />
10. Von der erkenntnistheoretischen Bestimmung der Demokratie zur<br />
demokratischen Qualität der Erkenntnis<br />
Die epistemische Bestimmung der Deliberation verdrängt damit die Momente<br />
des Urteilens <strong>und</strong> Entscheidens aus der demokratischen Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung.<br />
Was man als wahr oder unwahr, richtig oder falsch wissen kann, muss<br />
nicht mehr beurteilt <strong>und</strong> entschieden werden. Eine solche Orientierung des demokratischen<br />
Prozesses am Ideal rationaler Erkenntnis legt es im Umkehrschluss<br />
nahe, rationalen Erkenntnisprozessen selbst schon demokratische Qualität zuzusprechen.<br />
80 Eine derartige, letztlich technokratische Konsequenz der deliberativen<br />
Neubestimmung von Demokratie mag angesichts der von Jürgen Habermas<br />
über Jahrzehnte hinweg immer wieder formulierten Technokratiekritik absurd<br />
80<br />
In diesem Zusammenhang kritisieren Buchstein/Jörke eine Rationalisierung der neueren<br />
Demokratietheorie, die politische Beteiligung nicht mehr als Ziel, sondern als Mittel der Rationalitätssteigerung<br />
kollektiv verbindlicher Entscheidungen betrachte (Vgl. Buchstein/Jörke<br />
2003).
41<br />
erscheinen. 81 Tatsächlich besteht Habermas auch bis heute darauf, die politischrechtliche<br />
Regulierung der gesellschaftlichen Subsysteme an die alltagssprachliche,<br />
lebensweltlich verankerte Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung eines Laienpublikums<br />
zurückzubinden. 82 Welch geringer Modifikationen es bedarf, um ausgehend<br />
von einer epistemischen Bestimmung von Deliberationsprozessen schließlich<br />
bei der demokratischen Legitimation von Expertenkommissionen zu landen,<br />
lässt sich jedoch unschwer an den an Habermas anschließenden Weiterentwicklungen<br />
der deliberativen Demokratietheorie illustrieren. Exemplarisch möchte<br />
ich hier auf Rainer Schmalz-Bruns eingehen. Er ist in diesem Zusammenhang<br />
besonders aufschlussreich, weil er in seiner Weiterentwicklung der deliberativen<br />
Demokratietheorie sowohl das partizipatorische wie auch das epistemische Moment<br />
der Habermasschen Konzeption verstärken möchte. Erreichen will er dies<br />
durch eine Vervielfältigung deliberativer Prozesse <strong>und</strong> ihre Lösung von den<br />
Kerninstitutionen der repräsentativen Demokratie. 83<br />
Schmalz-Bruns kritisiert an Habermas’ Modell einer zweigleisig verlaufenden<br />
deliberativen Politik das Übergewicht der staatlichen Institutionen im Zentrum<br />
des politischen Systems gegenüber den zivilgesellschaftlichen Foren <strong>und</strong> Arenen<br />
der informellen Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung an der Peripherie. Habermas habe<br />
zwar den Dualismus zwischen System <strong>und</strong> Lebenswelt, der noch seine „Theorie<br />
des kommunikativen Handelns“ präge <strong>und</strong> Politik im engeren Sinn nur noch<br />
als mediengesteuertes Teilsystem unterstelle, in „Faktizität <strong>und</strong> Geltung“ zugunsten<br />
einer institutionellen Betrachtungsweise aufgegeben, aus der heraus er die<br />
kommunikative <strong>und</strong> administrative Macht im demokratischen Rechtsstaat verschränke.<br />
Das von Petersen übernommene Schleusenmodell deliberativer Demokratie<br />
stilisiere den Staat jedoch zum einzig möglichen kollektiven Akteur <strong>und</strong><br />
reduziere die Selbstregierung der Bürger auf episodische Politisierungsschübe<br />
<strong>und</strong> die Einspeisung von Problembewusstsein in die institutionellen Bahnen der<br />
liberalen repräsentativen Demokratie.<br />
Demgegenüber identifiziert Schmalz-Bruns im modularen Aufbau des politi-<br />
81<br />
82<br />
83<br />
So ist eine der gr<strong>und</strong>legenden theoretischen Weichenstellung im Werk von Habermas die<br />
Unterscheidung von Arbeit <strong>und</strong> Interaktion, von technischer <strong>und</strong> kommunikativer Rationalität<br />
<strong>und</strong> das Anliegen seines theoretischen Werkes insgesamt, wie er schon 1968 formuliert,<br />
die Entfaltung wissenschaftlich-technischer Rationalität der „uneingeschränkten Kommunikation<br />
über Ziele der Lebenspraxis“ <strong>und</strong> der Wahl dessen, was wir wollen können, zu unterstellen<br />
(Habermas 1968: 99).<br />
Vgl. dazu etwa Habermas 1992: 428f., 435f.<br />
Ähnliche Orientierungen auf gesellschaftliche, horizontale, problemorientierte <strong>und</strong> nicht an<br />
repräsentative staatliche Institutionen geb<strong>und</strong>ene Partizipationsformen finden sich in unterschiedlichen<br />
Versionen etwa auch bei Joerges/Neyer 1998, Warren 2002, Grote/Glibki<br />
2003, Schmitter 2003 <strong>und</strong> Pettit 2003.
42<br />
schen Systems, in der sich über viele Ebenen erstreckenden Stufung von Entscheidungsprozessen,<br />
vielfältige Ansatzpunkte für eine breite <strong>und</strong> kompetente<br />
Beteiligung, die Habermas übersehe. An diese Beteiligungsmöglichkeiten knüpft<br />
er die Perspektive einer weiteren Vergesellschaftung des Staates sowie einer vom<br />
staatlichen Institutionensystem ablösbaren Reflexivität politischer Prozesse,<br />
durch die sich die Erweiterung demokratischer Partizipation mit der rationalisierenden<br />
Wirkung einer problem- <strong>und</strong> ergebnisbezogenen Politik verbinden lasse. 84<br />
Konkret kann man sich hier eine breite Palette verschiedenster Mitwirkungsmöglichkeiten<br />
vorstellen, die Transparenzregeln, Expertenkommissionen, aber auch<br />
Informations- <strong>und</strong> Anhörungsrechte für Betroffene umfasst. Eine Vielzahl funktional<br />
spezialisierter <strong>und</strong> netzwerkartig integrierter Teilöffentlichkeiten soll dann<br />
bessere Partizipationsmöglichkeiten bieten als die <strong>und</strong>ifferenzierte <strong>und</strong> medialer<br />
Kolonialisierung ausgesetzte allgemeine Öffentlichkeit. Die exakte Bestimmung<br />
von Entscheidungsbefugnissen für diese anvisierte Vielzahl von deliberierenden<br />
Teilöffentlichkeiten kann dabei in dem Maße in den Hintergr<strong>und</strong> treten, wie die<br />
politische Willensbildung als kognitiver Prozess <strong>und</strong> nicht als Entscheidung zwischen<br />
kontingenten <strong>und</strong> konflikthaften Handlungsalternativen gilt. Der positive<br />
Zusammenhang zwischen der epistemischen Qualität von politischen Entscheidungen<br />
<strong>und</strong> ihrer Informalisierung, den wir bei Habermas bereits in Form einer<br />
„Gewichtsverschiebung“ von den Institutionen der parlamentarischen Demokratie<br />
zu den informellen Arenen <strong>und</strong> Foren gesellschaftlicher Willensbildung kennen<br />
gelernt haben, wird nun einen großen Schritt weiter getrieben zur Vergesellschaftung<br />
der Politik in problemorientierten Beratungen zwischen Regierungsvertretern,<br />
Experten <strong>und</strong> Betroffenen.<br />
Die Legitimität von Beschlüssen löst sich damit weiter aus der Rückbindung<br />
an ein Entscheidungshandeln des Souveräns, der Bürger bzw. ihrer Repräsentanten,<br />
<strong>und</strong> wird zu einer Sache des Reflexivitäts- <strong>und</strong> Rationalitätsniveaus der Beratungen.<br />
Von einer solchen Modifikation der Demokratie verspricht sich<br />
Schmalz-Bruns zweierlei: eine Verwirklichung der Idee demokratischer Selbstbestimmung<br />
in den Partizipationsmöglichkeiten der vielfältigen Beratungsprozesse<br />
<strong>und</strong> zugleich die Überwindung nationalstaatlicher Grenzen, die der Selbstregierung<br />
eines wie auch immer bestimmten Demos gesetzt bleiben. 85 Hier sind<br />
also ganz offensichtlich zwei traditionelle Ziele linker Gesellschaftskritik aufgegriffen:<br />
die Überwindung des Nationalstaates <strong>und</strong> die Rücknahme der Politik in<br />
die Gesellschaft.<br />
84<br />
85<br />
Vgl. dazu Schmalz-Bruns 1995, insbes. S. 102-120.<br />
Vgl. Schmalz-Bruns 2002: 278.
43<br />
Deutlicher noch als bei Habermas liegt dieser Perspektive die Ersetzung willentlicher<br />
Entscheidung durch rationale Erkenntnis zugr<strong>und</strong>e. Neuerdings distanziert<br />
sich Schmalz-Bruns allerdings von einem an der Moralphilosophie orientierten<br />
Typus diskursiver Rationalität, dem er mit verschiedenen Habermaskritikern<br />
vorwirft, elitär zu wirken <strong>und</strong> ganze Gruppen von einer öffentlich wirksamen<br />
Artikulation ihrer Interessen abzuschneiden. Stattdessen greift er John Deweys<br />
Begriff der „reflexiven Kooperation“ auf <strong>und</strong> fordert, die Rationalitätsstandards<br />
der Deliberationen „nicht im Blick primär auf die Anforderungen einer<br />
dem wissenschaftlichen Diskurs nachgebildeten, rein argumentativen Verständigung,<br />
sondern auf die Erfahrung sozialer Kooperation in der Lösung gemeinsamer<br />
Probleme hin auszurichten“ (Schmalz-Bruns 2002: 278f.). Von einer solchen<br />
Problemorientierung erhofft er sich zudem eine Verstärkung der individuellen<br />
Motivation, sich an der öffentlichen Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung überhaupt zu<br />
beteiligen sowie Kriterien zur Entscheidung der ja nicht unwichtigen Frage, was<br />
im Diskurs als „guter Gr<strong>und</strong>“ gelten kann. 86<br />
Den nahe liegenden Einwand gegen eine solche Perspektive der Integration<br />
durch Problemlösung hat jüngst Michael Greven formuliert: In pluralistischen<br />
Gesellschaften ist bereits die Definition von Problemen eine Machtfrage. Informelle<br />
Beratungsforen <strong>und</strong> Expertengremien bergen deshalb die Gefahr, das Prinzip<br />
politischer Gleichheit, das der Mehrheitsentscheidung durch gewählte Repräsentanten<br />
zugr<strong>und</strong>e liegt, durch einen zweifelhaften Rationalitätsanspruch zu ersetzen.<br />
87 Dieser Einwand ist in zweierlei zu vertiefen:<br />
Erstens ersetzt die „vergesellschaftete“ Variante deliberativer Demokratie das<br />
86<br />
87<br />
Vgl. Schmalz-Bruns 2002: 281. Bereits auf den ersten Blick handelt sich Schmalz-Bruns<br />
mit dieser scheinbar geringen pragmatistischen Modifikation des Habermasschen Modells<br />
ein gewaltiges Problem ein, das der Gründergeneration der Frankfurter Schule durchaus<br />
bewusst war: Wenn sich die Qualität von Gründen an ihrem Beitrag zur Lösung von Problemen<br />
gesellschaftlicher Kooperation bemisst, sind es letztlich die gesellschaftliche Form<br />
der Kooperation <strong>und</strong> die aus ihr zu schließenden funktionalen Erfordernisse, die über Rationalität<br />
<strong>und</strong> Irrationalität von Gründen entscheiden. In anderen Worten: Die Differenzierung<br />
zwischen funktionaler <strong>und</strong> kommunikativer Rationalität, mit der Habermas die Kritik instrumenteller<br />
Vernunft der Frankfurter Gründergeneration fortführen will, ist so nicht aufrecht<br />
zu erhalten, die kommunikative passt sich der funktionalen Vernunft an.<br />
Vgl. dazu Greven 2005: 270f. Dass sein Modell deliberativer Demokratie in Widerspruch<br />
zum Prinzip politischer Gleichheit gerät, sieht Schmalz-Bruns selbst. Da eine wirklich allgemeine<br />
Partizipation auch bei einer unterstellten Vernetzung zwischen der Vielzahl von<br />
funktionalen <strong>und</strong> sektoralen Teilöffentlichkeiten nicht zu gewährleisten ist, sei es umso<br />
wichtiger, „auch nachträglich Einwände zuzulassen, sofern sie geltend machen können, dass<br />
reziprok-allgemein nicht zurückweisbare Ansprüche ignoriert worden sind" (Schmalz-Bruns<br />
2002: 280). Wie eine solche Möglichkeit verwirklicht werden könnte, ob sie schließlich<br />
mehr Partizipationsmöglichkeiten böte als bestehende Möglichkeiten der Verwaltungsklage,<br />
bleibt allerdings völlig unklar.
44<br />
bereits bei Habermas geschwächte Repräsentationsprinzip vollständig durch die<br />
prozedural-epistemische Qualität der Deliberationen in den funktional <strong>und</strong> sektoral<br />
spezifizierten Teilöffentlichkeiten. Das zweigleisige Demokratiemodell von<br />
Habermas sieht vor, dass zumindest bei nicht routinemäßig zu bearbeitenden<br />
Problemen die informellen Kommunikationen der nichtvermachteten Peripherie<br />
die institutionalisierte Meinungs- <strong>und</strong> Willensbildung der repräsentativen Demokratie,<br />
insbesondere die Beratungen <strong>und</strong> Entscheidungen der Parlamente, steuern.<br />
Es ersetzt die herkömmlichen Repräsentationsverfahren nicht, sondern verschiebt<br />
lediglich die Gewichte zugunsten der informellen Kommunikationsprozesse an<br />
der Peripherie. Wie wir oben gesehen haben, impliziert jedoch bereits diese Verschiebung<br />
einen Bedeutungsverlust der Willensbeziehung <strong>und</strong> der symbolischen<br />
Dimension des Repräsentationsprinzips gegenüber der Rationalitätsvermutung<br />
der deliberativen Prozesse. Das Projekt einer auf problemzentrierten deliberativen<br />
Foren <strong>und</strong> Gremien basierenden transnationalen Demokratie will demgegenüber<br />
die Erzeugung demokratischer Legitimität sowohl von der Meinungsbildung<br />
einer allgemeinen Öffentlichkeit als auch von den Wahlentscheidungen des Souveräns<br />
abkoppeln. Wenn wie bei Schmalz-Bruns <strong>und</strong> anderen die Deliberationen<br />
in sektoral <strong>und</strong> funktional spezifizierten Öffentlichkeiten, Gremien <strong>und</strong> Kommissionen<br />
allein schon demokratische Legitimität erzeugen sollen, besteht kein Bezug<br />
mehr auf eine Willensbeziehung zwischen Bürgern <strong>und</strong> Repräsentanten <strong>und</strong><br />
die Dimension einer symbolischen Repräsentation gemeinsamer Ordnungsvorstellungen<br />
<strong>und</strong> Werte verschwindet. Ob ohne diese beiden Dimensionen des Repräsentationsprinzips<br />
angesichts der oben bereits angesprochenen engen Verquickung<br />
von Macht <strong>und</strong> Wissensfragen Legitimität erzeugt werden kann, scheint<br />
höchst zweifelhaft. Allenfalls ist zu erwarten, dass offene, kontroverse Positionen<br />
berücksichtigende Verfahren dem Widerstand betroffener Gruppen gegen die<br />
beschlossenen Ergebnisse weitgehend die Legitimation entziehen. Ist diese Wirkung<br />
schon problematisch, so ist darüber hinaus zu befürchten, dass die Ersetzung<br />
des Repräsentationsprinzips durch epistemisch bestimmte Beratungsverfahren<br />
zu einer weiteren Schwächung derjenigen Interessen führen wird, die durch<br />
die Willensbeziehung <strong>und</strong> die symbolische Dimension im Repräsentationsprinzip<br />
noch einen gewissen Schutz gegen funktionale Erfordernisse insbesondere des<br />
ökonomischen Reproduktionsprozesses genießen. So formuliert etwa Richard<br />
Münch zu der von ihm prinzipiell befürworteten Komitologie der Europäischen<br />
Union:<br />
„Es hat wenig Sinn, an diese faktisch sich vollziehende Legitimation durch
45<br />
Verfahren normative Maßstäbe anzulegen, die im Idealfall der Repräsentativdemokratie<br />
auf der Basis von Volkssouveränität wurzeln. ...Es ist unter<br />
solchen Bedingungen kaum möglich, repräsentativ ein Gemeinwohl zu ermitteln,<br />
das auch die Schwächeren nicht zu kurz kommen lässt. Politische<br />
Entscheidungsfindung ist in diesem Fall kein Prozess, der das Gemeinwohl<br />
sucht ..., sondern ein Prozess des fortlaufenden Durchspielens von Vorschlägen,<br />
die eine Reihe von Hürden überspringen müssen, um am Ende in<br />
der Regel mit einer Vielzahl von Korrekturen versehen durchzukommen<br />
oder doch zu scheitern. Das Kriterium „demokratischer“ Qualität ist hier die<br />
Zahl von checks oder unterschiedlichsten Prüfungsinstanzen, die ein Vorschlag<br />
durchlaufen muss, bis er ans Ziel gelangt <strong>und</strong> kollektiv verbindlich<br />
wird“ (Münch 2003: 126).<br />
Die Selbstregierung der Bürger, ihre Wahrnehmung öffentlicher Autonomie, die<br />
noch den Ausgangspunkt der deliberativen Demokratietheorie bildete, ist hier<br />
zusammengeschrumpft auf die Chance, in die eine oder andere Teilöffentlichkeit<br />
sachbezogene Verbesserungsvorschläge einzubringen. Eine Chance, die ungeachtet<br />
der theoretisch formulierten Inklusionsforderungen zudem nach Kompetenzen<br />
<strong>und</strong> Ressourcen extrem ungleich verteilt sein dürfte.<br />
Zweitens drohen Beratungen um so eher technokratische Züge anzunehmen,<br />
je mehr sie sich von der ethischen Selbstverständigung einer bestimmten Gemeinschaft<br />
entfernen <strong>und</strong> lediglich durch ein von wem auch immer definiertes –<br />
Problem konstituiert sind. Schmalz-Bruns hält es für einen Vorzug seiner Version<br />
deliberativer Demokratie, dass sie eine Vorstellung von Öffentlichkeit enthalte,<br />
die „kein über geteilte Werte vermitteltes Kollektiv oder eine Gemeinschaft“<br />
voraussetze, sondern „sich unmittelbar auf die kooperativen Anstrengungen all<br />
derjenigen (beziehe), die über gemeinsame Probleme <strong>und</strong> die Folgen von Handlungen<br />
miteinander verb<strong>und</strong>en sind“ (Schmalz-Bruns 2002: 277). Abgesehen<br />
davon, dass eine von allen lebensweltlichen Bezügen befreite, nur durch problemlösende<br />
Zusammenarbeit bestimmte Deliberation ebenso ein Ding der Unmöglichkeit<br />
ist wie die machtfreie Definition des Problems selbst, hat das Ideal<br />
einer von Wert- <strong>und</strong> Gemeinschaftsbezügen befreiten Beratung erhebliche Konsequenzen.<br />
Es impliziert, die noch von Habermas erhoffte „Programmierung“ des<br />
politischen Systems durch lebensweltlich generierte Sinnkriterien aufzugeben, da<br />
sich funktional <strong>und</strong> sektoral spezialisierte, problemorientierte Teilöffentlichkeiten<br />
ja gerade durch ihre Lösung aus den lebensweltlichen Horizonten spezifischer<br />
Gemeinschaften auszeichnen. Der bereits oben gegen Habermas vorgetragene<br />
Einwand, der Rationalitätsanspruch seines deliberativen Demokratiemodells<br />
begünstige funktionale <strong>und</strong> ökonomische Rationalität gegenüber narrativ auszu-
46<br />
legenden Sinn- <strong>und</strong> Wertorientierungen, gilt hier also erst recht.<br />
Während der junge Marx mit seiner Perspektive einer Vergesellschaftung der<br />
Politik noch darauf hoffte, den abstrakten Staatsbürger durch eine Revolutionierung<br />
der Produktionsverhältnisse in den wirklichen individuellen Menschen zurücknehmen<br />
zu können 88 , löst die deliberative Version einer Vergesellschaftung<br />
des Staates die Sphäre politischer Freiheit <strong>und</strong> Gleichheit auf zugunsten eines<br />
Netzwerkes funktional bestimmter Erkenntnisprozesse. Die Verfehlung des Politischen<br />
im reflexionsmoralischen Autonomieideal bei Habermas wird hier weiterentwickelt<br />
zur Perspektive einer entpolitisierten gesellschaftlichen Problemlösung.<br />
88 Vgl. dazu Marx, MEW 1: 370.
47<br />
Literatur<br />
Abromeit, Heidrun (2002): Wozu braucht man Demokratie? Die postnationale Herausforderung<br />
der Demokratietheorie, Opladen.<br />
Arendt, Hannah (1974): Über die Revolution, München.<br />
Arendt, Hannah (1979): Hannah Arendt on Hannah Arendt, in: Hill, Melvyn (Hg.): Hannah<br />
Arendt: The Recovery of the Public World, New York, S. 301-339.<br />
Arendt, Hannah (1981): Vita Activa oder Vom tätigen Leben, München.<br />
Aristoteles (1994): Politik. Nach der Übersetzung von Franz Susemihl, Reinbek.<br />
Barber, Benjamin (1994): Starke Demokratie, Hamburg.<br />
Barber, Benjamin (1993): Fo<strong>und</strong>ationalism and Democracy, in: Jahrbuch für politisches Denken<br />
1993, Stuttgart, S. 29-38.<br />
Benhabib, Seyla (1995): Ein deliberatives Modell demokratischer Legitimität, in: Deutsche<br />
Zeitschrift für Philosophie, 43. Jg. H.1/1995, S. 3-29.<br />
Benhabib, Seyla (1995a): Liberaler Dialog kontra Kritische Theorie diskursiver Legitimierung,<br />
in: Brink, Bert van den/Reijen, William van (Hg.): Bürgergesellschaft, Recht <strong>und</strong><br />
Demokratie, Frankfurt a.M., S. 411-431.<br />
Blanke, Thomas (1994): Sanfte Nötigung, in: Kritische Justiz, Jg. 27, S. 439-461.<br />
Bohman, James (1998): The Coming of Age of Deliberative Democracy, in: The Journal of<br />
Political Philosophy, 6. Jg., H. 4, S. 400-425.<br />
Buchstein, Hubertus (1997): Repräsentation ohne Symbole – Die Repräsentationstheorie des<br />
‚Federalist’, in: Göhler, Gerhard u.a.(Hg.): Institution – Macht – Repräsentation, Baden-<br />
Baden, S. 376-432.<br />
Buchstein, Hubertus/Jörke, Dirk: Das Unbehagen an der Demokratietheorie, in: Leviathan, 31.<br />
Jg., H.4, S. 470-495.<br />
Cohen, Joshua (1989): Deliberation and Democratic Legitimacy, in: Hamlin, A./Pettit, B. (eds.):<br />
The Good Polity. Oxford, S. 17-34.<br />
Coles, Roman (2000): Of Democracy, Discourse, and Dirt Value. Developments in Recent<br />
Critical Theory, in: Political Theory, 24. Jg., H. 4, S. 540-564.<br />
Cooke, Maeve (1997): Authenticity and Autonomy, in: Political Theory, 25. Jg., H. 2, S. 258-<br />
288.<br />
Dryzek, John S. (1990): Discursive Democracy. Policy, Politics and Political Science, Cambridge<br />
and New York.<br />
Glibki, Bernard/Grote, Jürgen R. (2003): From Democratic Government to Participatory Governance,<br />
in: Grote, J./Glibki, B. (Hg.): Participatory Governance, Opladen, S. 17-34.<br />
Göhler, Gerhard (1992): Politische Repräsentation in der Demokratie, in: Leif, Thomas/Legrand,<br />
Hans-Josef/Klein, Ansgar (Hg.): Die politische Klasse in Deutschland:<br />
Eliten auf dem Prüfstand, Bonn, S. 108-125.<br />
Grant, Ruth (2002): Political Theory, Political Science, and Politics, in: Political Theory, 30.<br />
Jg., H. 4, S. 577-595.<br />
Greven, Michael (1991): Macht <strong>und</strong> Politik in der politischen Theorie von Jürgen Habermas, in:<br />
Ders. (Hg.): Macht in der Demokratie, Baden-Baden, S. 213-238.<br />
Greven, Michael (1998): Mitgliedschaft, Grenzen <strong>und</strong> politischer Raum: Problemdimensionen<br />
der Demokratisierung in der EU, in: Problemdimensionen der Demokratisierung der Europäischen<br />
Union. In: Kohler-Koch, Beate (Hg.): Regieren in entgrenzten Räumen, PVS<br />
Sonderheft 29, Opladen, S. 249-270.<br />
Greven, Michael (2005): The Informalization of Transnational Governance: A Threat to Democratic<br />
Government, in: Grande, Edgar/ Pauly, Louis W. (Hg.): Complex Sovereignty:<br />
Reconstituting Political Authority in the Twenty-First Century, S. 261-284.<br />
Habermas, Jürgen (1962): Strukturwandel der Öffentlichkeit, Neuwied <strong>und</strong> Berlin.<br />
Habermas, Jürgen (1968): Technik <strong>und</strong> Wissenschaft als „Ideologie“, Frankfurt a.M.
48<br />
Habermas, Jürgen (1973): Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt a.M.<br />
Habermas, Jürgen (1981): Theorie des Kommunikativen Handelns, Bd.1 <strong>und</strong> 2, Frankfurt a.M.<br />
Habermas, Jürgen (1983): Moralbewußtsein <strong>und</strong> kommunikatives Handeln, Frankfurt a.M.<br />
Habermas, Jürgen (1984): Vorstudien <strong>und</strong> Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns,<br />
Frankfurt a. M.<br />
Habermas, Jürgen (1985): Die Neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt a.M.<br />
Habermas, Jürgen (1991): Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt a.M.<br />
Habermas, Jürgen (1992): Faktizität <strong>und</strong> Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts <strong>und</strong><br />
des demokratischen Rechtsstaates, Frankfurt a.M.<br />
Habermas, Jürgen: (1994): Nachwort zur 4. Auflage von Faktizität <strong>und</strong> Geltung, in: Ders., Faktizität<br />
<strong>und</strong> Geltung, Frankfurt a.M., S. 661-680.<br />
Habermas, Jürgen (1996): Die Einbeziehung des Anderen. Studien zu politischen Theorie,<br />
Frankfurt a.M.<br />
Habermas, Jürgen (1996a): Anhang zu Faktizität <strong>und</strong> Geltung. Replik auf Beiträge zu einem<br />
Symposion der Cardozo Law School, in: Die Einbeziehung des Anderen, a.a.O., S. 309-<br />
399.<br />
Habermas, Jürgen (1998): Die postnationale Konstellation, Frankfurt a.M.<br />
Habermas, Jürgen (1998a): Richtigkeit vs. Wahrheit. Zum Sinn der Sollgeltung moralischer<br />
Urteile <strong>und</strong> Normen, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 46. Jg., H. 2, S. 179-208.<br />
Habermas, Jürgen (2004): Der gespaltene Westen, Frankfurt a.M.<br />
Hamilton, Alexander/Jay, John/Madison, James (2000): The Federalist, ed. The Modern Library,<br />
New York.<br />
Hierath, Bettina (2001): Repräsentation <strong>und</strong> Gleichheit. Neue Aspekte in der politikwissenschaftlichen<br />
Repräsentationsforschung, Opladen.<br />
Höffe, Otfried: Eine Konversion der Kritischen Theorie. Zu Jürgen Habermas’ Rechts- <strong>und</strong><br />
Staatstheorie, in: Neue Züricher Zeitung, 26.2. 1993, S. 43-44.<br />
Howard, Dick (2002): The Spector of Democracy, New York.<br />
Jörges, Christian/Neyer, Jürgen (1998): Vom intergouvernementalen Verhandeln zur deliberativen<br />
Politik: Gründe <strong>und</strong> Chancen für eine Konstitutionalisierung der europäischen Komitologie,<br />
in: Kohler-Koch, Beate (Hg.): Regieren in entgrenzten Räumen (PVS Sonderheft<br />
29), Opladen, S. 207-233.<br />
Krause, Skadi/Malowitz, Karsten (1999): Zum Begriff der Gerechtigkeit in der Diskursethik<br />
von Jürgen Habermas, in: Münkler, Herfried/Llanque, Marcus (Hg.): Konzeptionen der<br />
Gerechtigkeit, Baden-Baden, S. 277-306.<br />
Lefort, Claude (1990): Die Frage der Demokratie, in: Rödel, Ulrich (Hg.): Autonome Gesellschaft<br />
<strong>und</strong> libertäre Demokratie, Frankfurt/M, S. 281-297.<br />
Manin, Bernard (1987): On Legitimacy and Deliberation, in: Political Theory, 15. Jg., H. 3, S.<br />
338-368.<br />
Marx, Karl: Zur Judenfrage, in: MEW 1, Berlin 1972, S. 347-370.<br />
McCarthy, Thomas (1994): Practical Discourse: On the Relation of Morality to Politics, in:<br />
Calhoun, Craig (ed.): Habermas and the Public Sphere, Massachusetts, S. 51-72.<br />
Miller, David (1992): Deliberative Democracy and Social Choice, in: Political Studies, 40. Jg.,<br />
S. 54-67.<br />
Mouffe, Chantal (1997): Decision, Deliberation and Democratic Ethos, in: Philosophy Today,<br />
41. Jg., S. 24-30.<br />
Mouffe, Chantal (1999): Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism, in: Social Research,<br />
66. Jg., H..3, S. 745-758.<br />
Münch, Richard (2003): Politik in der globalisierten Moderne, in: Nassehi, A. /Schroer, M.<br />
(Hg.): Der Begriff des Politischen, Soziale Welt, Sonderheft 14, S. 117-131.<br />
Nullmeier, Frank (1995): Diskursive Öffentlichkeit. Möglichkeiten einer Radikalisierung der<br />
Kritik, in: Göhler, Gerhard (Hg.): Macht der Öffentlichkeit – Öffentlichkeit der Macht,<br />
Baden-Baden, S. 85-110.<br />
Nullmeier, Frank (2000): Argumentationsmacht <strong>und</strong> Rechtfertigungsfähigkeit schwacher Inte-
49<br />
ressen, in: Willems, Ulrich/Winter (Hg.): Politische Repräsentation schwacher Interessen,<br />
Opladen, S. 93-109.<br />
Pettit, Philip (2002): Depoliticizing Democracy, in: Associations Bd. 7, Nr. 1, S. 23-37.<br />
Rehg, William (1994): Insight and Solidarity. A Study in the Discourse Ethics of Jürgen<br />
Habermas, Berkeley.<br />
Rousseau, Jean-Jacques (1977): Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtes, in:<br />
Politische Schriften Band 1, Paderborn, S. 59-208.<br />
Scheit, Herbert (1987): Wahrheit - Diskurs – Demokratie, Freiburg/München.<br />
Schmalz-Bruns, Rainer (1995): Reflexive Demokratie, Baden-Baden.<br />
Schmalz-Bruns, Rainer (1997): Bürgergesellschaftliche Politik – ein Modell der Demokratisierung<br />
der Europäischen Union, in: Wolf, Klaus-Dieter (Hg.): Projekt Europa im Übergang?,<br />
Baden-Baden, S. 211-235.<br />
Schmalz-Bruns, Rainer (1999): Deliberativer Supranationalismus. Demokratisches Regieren<br />
jenseits des Nationalstaates, in: Zeitschrift für internationale Beziehungen, 6. Jg. H.2, S.<br />
185-244.<br />
Schmalz-Bruns, Rainer (2002): Demokratisierung der Europäischen Union – Oder Europäisierung<br />
der Demokratie? In: Matthias Lutz-Bachmann/James Bohman (Hg.): Weltstaat o-<br />
der Staatenwelt? Frankfurt/M., S. 260-307.<br />
Schmitter, Philippe, C. (2002): Participation in Governance Arrangements, in: Glibki, Bernard/Grote,<br />
Jürgen R.: From Democratic Government to Participatory Governance, in:<br />
Grote, J./Glibki, B. (Hg): Participatory Governance, Opladen, S. 51-70.<br />
Thaa, Winfried (1999): Grenzen der Politik. Vom Substanzverlust der Politik beim „Einholen“<br />
transnationaler Vergesellschaftung, in: Leviathan, 27. Jg. H.2, S. 199-217.<br />
Thaa, Winfried (2001): ‘Lean Citizenship’: The Fading Away of the Political in Transnational<br />
Democracy. In: European Journal of International Relations, Vol. 7 (4), S. 503-523.<br />
Urbinati, Nadia (2000): Representation as Advocacy. A Study of Democratic Deliberation, in:<br />
Political Theory, 28. Jg., H.6, S. 758-786.<br />
Villa, Dana (1992): Postmodernism and the Public Sphere, in: American Political Science Review,<br />
86. Jg., H.3, S. 712-721.<br />
Vollrath, Ernst (1982): Ein philosophischer Begriff des Politischen? In: Neue Hefte für Philosophie,<br />
21. Jg. H. 1/1982, S. 35-46.<br />
Vollrath, Ernst (1987): Associational versus Communicative Rationality of Politics, in: B.<br />
Parekh, B./Pantham, T. (Hg.): Political Discourse, New Delhi, S. 194-201.<br />
Vollrath, Ernst (1989): Metapolis <strong>und</strong> Apolitie, in: Perspektiven der Philosophie, Neues Jahrbuch<br />
Bd. 15, S. 191-232.<br />
Vollrath, Ernst (1992): Identitätsrepräsentation <strong>und</strong> Differenzrepräsentation, in: Rechtsphilosophische<br />
Hefte Nr. 1, S. 65-78.<br />
Vollrath, Ernst (1995): Zwei Begriffe des Politischen? Jürgen Habermas <strong>und</strong> die störrische Faktizität<br />
des Politischen, in: Politisches Denken. Jahrbuch 1994, Stuttgart , S. 175-192.<br />
Vollrath, Ernst (1996): Proteus <strong>und</strong> Medusa. Die politische Apperzeption der deutschen Staatsrechtslehre<br />
im Werk von Jürgen Habermas, in: PVS, 37. Jg. H. 2, S. 341-356.<br />
Walzer, Michael (1999): Deliberation, and What Else? In: Macedo, Stephen (Hg.): Deliberative<br />
Politics, New York/Oxford, S. 58-69.<br />
Warren, Mark E. (2002): What Can Democratic Participation Mean Today? In: Political Theory,<br />
30. Jg., H. 5, S. 677-701.<br />
Willems, Ulrich (2003): Moralskepsis, Interessenreduktionismus <strong>und</strong> Strategien der Förderung<br />
von Demokratie <strong>und</strong> Gemeinwohl, in: Ders. (Hg.), Interesse <strong>und</strong> Moral als Orientierungen<br />
politischen Handelns, Baden-Baden, S. 9-100.<br />
Williams, Melissa S. (2000): The Uneasy Alliance of Group Representation and Deliberative<br />
Democracy, in: Kymlicka, W./Norman, W. (eds.): Citizenship in Diverse Societies, Oxford,<br />
S. 124-152.<br />
Young, Iris Marion (1987) Impartiality and the Civil Public, in: Benhabib, Seyla/Cornell, Drucilla<br />
(Hg.): Feminism as Critique, Minneapolis, S. 56-76.
50<br />
Zerilli, Linda M.: ‘We Feel Our Freedom’. Imagination and Judgment in the Thought of Hannah<br />
Arendt, in: Political Theory, Jg. 33, Nr.2, S. 158-188.