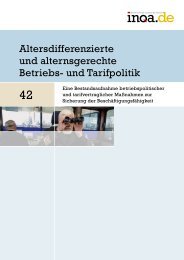Holger Alda - SOFI
Holger Alda - SOFI
Holger Alda - SOFI
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
18<br />
sich lediglich ablesen, dass die optimale Clusteranzahl zwischen zwei und 14 liegen sollte.<br />
Aufschlussreicher ist ein Blick auf den Duda-Hart-Index. Nach dem Je(2) / Je(1) – Kriterium<br />
(lokales Maximum) und der Pseudo-T-Squared-Statistik (lokales Minimum) existieren gute<br />
Lösungen für vier und zehn Cluster, sechs und zwölf Cluster werden ebenfalls von der Teststatistik<br />
relativ gut bewertet. Die Wahl der Cluster fiel auf zehn in beiden Landesteilen. Die<br />
Vier-Clusterlösung erscheint für eine differenzierende Betriebstypologie nicht ausreichend.<br />
Der Wert zehn ist vor diesem Hintergrund eine gut geeignete Anzahl, weil der Je(2) / Je(1) –<br />
Index nach dem Ward-Verfahren dort ein lokales Maximum, und die Pseudo-T²-Statistik ein<br />
lokales Minimum hat. Wie auch die späteren Analysen in Abschnitt 5 bestätigen, ist in den<br />
westdeutschen Daten für das Jahr 2004 die Zehn-Clusterlösung robust. Die Vier-Clusterlösung<br />
ist in diesem Zusammenhang als Gruppenvariable der Zehn-Clusterlösung zu interpretieren,<br />
wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird. Die Beschreibung der Typen im nächsten Abschnitt<br />
erfolgt anhand der jeweiligen Clusterzentren, d.h. anhand der multivariaten Mittelwerte<br />
der typisierenden Variablen nach der Anwendung des K-Means-Verfahrens.<br />
4. Sozioökonomische Profile der Betriebstypen in den Dimensionen<br />
Entlohnung, Beschäftigungsstabilität und Einsatz von Qualifikationen 18<br />
und ihr Abdeckungsgrad über Betriebe und Beschäftigte<br />
Die Beschreibung der Betriebstypen beruht wie beschrieben auf der Zehn-Clusterlösung.<br />
Erwähnenswert ist darüber hinaus die Vier-Clusterlösung, denn diese vier Cluster können als<br />
übergeordnete Gruppen der zehn interpretiert werden. Zuerst wird auf die Gruppe und<br />
anschließend auf die dazu gehörenden einzelnen Betriebstypen eingegangen. Diese vier<br />
Gruppen bleiben unabhängig von der konkret „gewählten“ Clusteranzahl – sofern diese zwischen<br />
fünf und 15 liegt – stabil. Mit der konkreten Clusterlösung wird demnach insbesondere<br />
der Grad der Ausdifferenzierung der einzelnen Typen innerhalb der Gruppen festgelegt. Die<br />
multivariaten Mittelwerte der typisierenden Variablen befinden sich im Anhang A2.<br />
Gruppe I: Traditionell organisierte Betriebe generieren überwiegend stabile Beschäftigung,<br />
haben ein mittleres bis niedriges Lohnprofil und setzen ein breites Spektrum an Berufen<br />
ein, bei denen die mittlere Qualifikationsebene dominiert. Sie entsprechen – abhängig von der<br />
Betriebsgröße – am ehesten der im zweiten Abschnitt skizzierten idealtypisch-fordistischen<br />
betrieblichen Arbeitsorganisation. Die Gruppe umfasst drei Betriebstypen.<br />
Im soliden Betrieb (Typ Ia) werden Beschäftigte nahezu ausschließlich für ihre formell erworbenen<br />
Qualifikationen (nicht gerade üppig) bezahlt. Sie haben aber (dafür?) eine relativ<br />
hohe Beschäftigungsstabilität. In diesem Betriebstyp gesellt sich gleiches gern zu gleichem,<br />
denn die Beschäftigten in diesen Betrieben werden relativ ähnlich und homogen bezahlt. Bei<br />
diesem Betriebstyp sind Personalfluktuationen auf allen Ebenen (Lohn- und Qualifikationsgruppen)<br />
selten, was eine solide betriebliche Personalpolitik und Fluktuationen überwiegend<br />
durch Generationenaustausch nahe legt, die Betriebe nur zu geringen Personalanpassungsprozessen<br />
veranlasst (dementsprechend gut muss die Auswahl des Personals sein). Die Anteile<br />
18 Alle Namensgebungen für Betriebstypen sind beschreibend und nicht wertend.