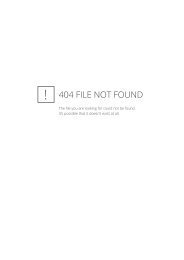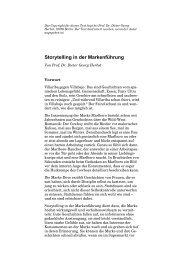Wissensmanagement - Prof. Dr. Dieter Georg Herbst
Wissensmanagement - Prof. Dr. Dieter Georg Herbst
Wissensmanagement - Prof. Dr. Dieter Georg Herbst
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 30 -<br />
Roth ausgedrückt: "Ein Mensch wird müde seiner Fragen, nie kann die Welt<br />
ihm Antwort sagen. Doch gern gibt Antwort alle Welt, auf Fragen, die er nie<br />
gestellt."<br />
Das Beispiel Mitarbeitergespräch<br />
Das direkte, persönliche Gespräch zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter<br />
ist durch nichts zu ersetzen. Um es deutlich zusagen: Welche Bedeutung die<br />
strategischen Ziele des Unternehmens für jeden einzelnen Arbeitsplatz haben,<br />
ist Führungsaufgabe! Der Mitarbeiter muss selbst prüfen, was sie für<br />
ihn bedeuten und sein Vorgesetzter muss ihn dabei unterstützen, interpretieren,<br />
verdeutlichen. Keine Technologie ist in der Lage, dies zu tun!<br />
Kein Computer kann einem Mitarbeiter erklären, wie er zum Erreichen<br />
der strategischen Unternehmensziele beitragen kann.<br />
Im regelmäßigen Mitarbeitergespräch geht es um mindestens vier Bereiche:<br />
1. Leistungsbeurteilung für eine abgelaufene Periode<br />
2. Zielvereinbarung für die kommende Periode<br />
3. Verknüpfung mit dem Entgelt und dem Bonus<br />
4. Förderung durch Weiterbildung und Training<br />
Der Vorgesetzte formuliert seine Erwartungen an Aufgaben, Ziele und Verhalten<br />
des Mitarbeiters. Dies ist zugleich Grundlage für die spätere Bewertung.<br />
Da gute Leistungen honoriert und schlechte geahndet werden, sind<br />
Gehalt, Bonus und Zulagen wichtiger Teil des Mitarbeitergesprächs.<br />
Bestandteile dieses Mitarbeitergespräche sollte das Thema Wissen sein, dessen<br />
Entstehen, Entwicklung, Anwendung und Bewahrung. Im Gespräch<br />
achtet der Vorgesetzte besonders auf die Sicht des Mitarbeiters: Wie sieht<br />
er seine Leistung? Was hat sie in seinen Aufgaben gefördert, was hat sie<br />
behindert? Einschätzungen, Wünsche, Anregungen und Befürchtungen werden<br />
offengelegt und diskutiert und fließen in Entscheidungen ein wie zum<br />
Beispiel die Vereinbarung von Zielen: Sind sie aus Sicht der Mitarbeiter realistisch?<br />
Sind sie erreichbar? Welche Unterstützung ist erforderlich, um sie<br />
umzusetzen. Damit wird dieses Gespräch eine Verabredung, mit der sie sich<br />
identifizieren können, das sie motiviert und ihre Kreativität fördert (weitere<br />
Erläuterungen zum Thema finden Sie im Buch „Interne Kommunikation“<br />
von <strong>Dieter</strong> <strong>Herbst</strong>).<br />
Formale und informelle Kommunikation<br />
Für das <strong>Wissensmanagement</strong> sind zwei Formen von Kommunikation bedeutend:<br />
formale und informelle. Beide dienen dem Austausch:<br />
4.2.1 Die formale Kommunikation<br />
Formale Kommunikation umfasst alle Inhalte und Kanäle, die absichtlich und<br />
dauerhaft eingerichtet sind. Sie lassen sich danach unterscheiden, in welche<br />
Richtung sie verlaufen:<br />
© <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Dieter</strong> <strong>Herbst</strong>, Berlin, 25.10.01