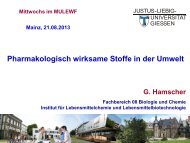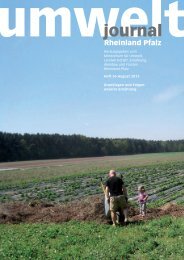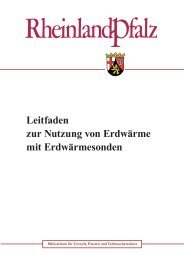Jahresbericht 2007 - Rheinland-Pfalz
Jahresbericht 2007 - Rheinland-Pfalz
Jahresbericht 2007 - Rheinland-Pfalz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Tiergesundheit & Tierseuchen<br />
übrigen Fuchspopulation. Auch wenn die Zahl der<br />
bisher in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> untersuchten Stadtfüchse<br />
mit 101 Tieren noch vergleichsweise gering ist, so<br />
machen diese Ergebnisse doch deutlich, dass auch<br />
in menschlichen Ansiedlungen mit dem Kleinen<br />
Fuchsbandwurm gerechnet werden muss.<br />
Hunde und Katzen entwurmen<br />
Der Parasit durchläuft einen komplizierten Entwicklungsweg.<br />
Der reife vier- bis fünfgliedrige Bandwurm<br />
lebt im Darm des Fuchses. Kleiner Fuchsbandwurm<br />
wird er genannt, weil er nur etwa drei Millimeter<br />
groß ist. Dafür ist die Zahl der Würmer pro Fuchs<br />
gigantisch: Es können bis zu 200.000 sein. Nur das<br />
letzte Glied des Bandwurms enthält die circa 300 infektiösen<br />
Eier. Reife Endglieder werden etwa alle 14<br />
Tage mit dem Kot ausgeschieden. Da dieser häufig<br />
noch unverdaute pflanzliche Anteile enthält, ist er als<br />
Nahrungsquelle für Mäuse interessant. Die nehmen<br />
die Eier auf und werden so zum Zwischenwirt. Die im<br />
Ei enthaltene Larve schlüpft im Mäusemagen, wandert<br />
in die Leber und kapselt sich dort als sogenannte<br />
Finne ab. Frisst ein Fuchs eine solche Maus, wird<br />
die Larve bei der Verdauung im Magen freigesetzt,<br />
gelangt in den Darm und entwickelt sich dort wieder<br />
zu einem Bandwurm. Hunde und Katzen können sich<br />
ebenfalls über Mäuse infizieren. Sie sollten daher im<br />
Abstand von maximal sechs Wochen entwurmt werden.<br />
Diese Tiere sind zwar nur selten Träger des Parasiten;<br />
wegen ihrer besonderen Nähe zum Menschen<br />
ist aber trotzdem Vorsicht geboten.<br />
Psittakose: Vogelkrankheit<br />
auf Menschen übertragbar<br />
Gefahr für Wellensittiche und Papageien: Die<br />
Psittakose endet für diese Vögel oft tödlich.<br />
Im LUA werden regelmäßig Proben auf Chlamydophila<br />
psittaci untersucht. Chlamydophila psittaci ist<br />
ein Erreger, der bei Papageien und Sittichen die Psittakose<br />
oder Papageienkrankheit auslöst. Er kann bei<br />
diesen Vogelarten zu massiven Verlusten innerhalb<br />
einer Tierpopulation führen, ist daher anzeigepflichtig<br />
und wird staatlich bekämpft. Bei anderen Zier -,<br />
Haus- und Wildvögeln wird die Krankheit als Ornithose<br />
bezeichnet. Bei diesen Vogelarten verläuft die<br />
Krankheit in der Regel nicht seuchenhaft und unterliegt<br />
der Meldepflicht.<br />
Im Jahr <strong>2007</strong> wurden 483 Proben auf den Erreger<br />
untersucht. Dabei handelte es sich überwiegend um<br />
40 Landesuntersuchungsamt <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong><br />
Papageien können an der Psittakose sterben. Die Krankheit<br />
wird von Bakterien ausgelöst, die auch Menschen krank<br />
machen können.<br />
Kotproben oder um solche, bei denen ein klinischer<br />
Verdacht auf Psittakose oder Ornithose vorlag. Der<br />
Großteil stammte von Papageien und Sittichen. Insgesamt<br />
wurden 44 Mal Chlamydophila psittaci mit<br />
der PCR-Methode nachgewiesen.<br />
Bei infizierten Vögeln treten verschiedene Krankheitssymptome<br />
auf. Vor allem bei Jungtieren kommt<br />
es zu akuten Erkrankungen mit Apathie, Schwäche,<br />
Nasen- und Augenausfluss, Durchfall sowie starken<br />
Atembeschwerden, zum Teil mit tödlichem Verlauf.<br />
Subakute und chronische Formen treten häufiger<br />
bei erwachsenen Tieren auf und gehen mit Apathie,<br />
Abmagerung, Durchfall und Atemnot einher. Bei erwachsenen<br />
Tieren kommt es aber auch vor, dass die<br />
Krankheit ohne Symptome verläuft, der Erreger aber<br />
in inaktivierter Form im Organismus bleibt. Durch<br />
bestimmte Faktoren wie Stress, Nahrungsumstellung<br />
oder Parasitenbefall kann der Erreger aber jederzeit<br />
wieder aktiv werden und eine Erkrankung auslösen.<br />
Infizierte Tiere scheiden den Erreger über Sekrete<br />
und den Kot aus. Menschen und Tiere stecken sich<br />
über die Atemwege an, zum Beispiel durch Einatmen<br />
von erregerhaltigen Kot- oder Staubpartikeln. Die<br />
Symptome können bei Menschen unauffällig sein,<br />
allerdings kommen auch schwere grippeartige Erkrankungen<br />
bis hin zur Lungenentzündung vor.<br />
Der Nachweis des Erregers hat strikte Maßnahmen<br />
im betroffenen Bestand zur Folge, um eine Gefährdung<br />
für den Menschen und die Ausbreitung zu verhindern.<br />
Nach einer Antibiotika-Therapie muss der<br />
Behandlungserfolg durch eine zweimalige Kotprobenuntersuchung<br />
überprüft werden. Erst wenn kein