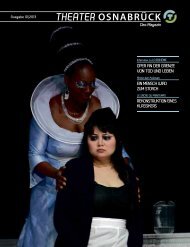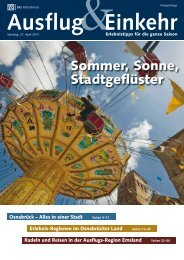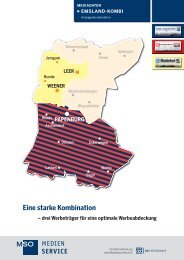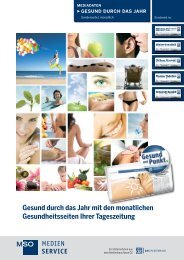Ems-Zeitung - MSO Medien-Service
Ems-Zeitung - MSO Medien-Service
Ems-Zeitung - MSO Medien-Service
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
26 KULTUR<br />
„Ich halte die Thesen<br />
und die kulturpolitischen<br />
Zielsetzungen,<br />
die diesen Vorschlägen<br />
zugrunde liegen,<br />
für falsch“, sagt<br />
Kulturstaatsminister<br />
Bernd Neumann. Kulturförderung<br />
nach<br />
dem Prinzip von Angebot<br />
und Nachfrage<br />
„würde zu einer Kommerzialisierung<br />
der<br />
gesamten Kultur führen“.<br />
Neumanns Fazit:<br />
„Die vier Autoren<br />
schütten das Kind mit<br />
dem Bade aus.“<br />
Bernd Neumann,<br />
Staatsminister für Kultur<br />
Eine Streichung von<br />
50 Prozent der Zuwendung<br />
„geht weit an der<br />
Realität einer vielfältigen<br />
und länderbezogenen<br />
Struktur von<br />
Kultur und Kulturförderung<br />
vorbei“, sagt<br />
Landeskulturministerin<br />
Johanna Wanka.<br />
Die Debatte müsse<br />
mehr „als nur Aspekte<br />
der Finanzierung aufgreifen“.<br />
Ihr Instrument:<br />
das Kulturentwicklungskonzept<br />
des<br />
Landes.<br />
Johanne Wanka,<br />
Landeskulturministerin<br />
„Das Buch will provozieren<br />
und nicht argumentieren.<br />
Das ist<br />
schade“, sagt Oliver<br />
Scheytt zu „Der Kulturinfarkt“<br />
und<br />
warnt vor einer „Gespensterdebatte“.<br />
„Denkverbote lösen<br />
keine Probleme. Wir<br />
brauchen bessere Argumente,<br />
um öffentliche<br />
Kulturausgaben<br />
zu begründen und die<br />
Bürger davon zu überzeugen“,<br />
sagt Scheytt<br />
und fordert eine „kluge<br />
Revision der kulturellenInfrastruktur“.<br />
Oliver Scheytt,<br />
Ruhr.2010<br />
KOMPAKT<br />
Diesney floppt mit<br />
„John Carter“<br />
dpa NEW YORK. Der Flop<br />
des Mars-Abenteuers<br />
„John Carter“ wird für Disney<br />
teuer. Der Film werde<br />
im laufenden Quartal voraussichtlich<br />
einen operativen<br />
Verlust von 200 Millionen<br />
Dollar bringen, kündigte<br />
der Unterhaltungsriese<br />
an. Der Film soll rund<br />
250 Millionen Dollar gekostet<br />
haben – plus weitere<br />
rund 100 Millionen für<br />
Werbung. Weltweit brachte<br />
der Film bislang 184 Millionen<br />
Dollar ein, an denen<br />
auch die Kinos verdienen.<br />
„Kulturinfarkt“: Hilft<br />
nur der große Schnitt?<br />
Buchautoren provozieren: Die Debatte läuft<br />
Von Stefan Lüddemann<br />
OSNABRÜCK. Steht<br />
Deutschlands Kulturszene<br />
vor dem Infarkt? Das Buch<br />
„Der Kulturinfarkt“ hat eine<br />
Debatte ausgelöst. Auf dieser<br />
Seite sagen wir, was von<br />
dem Buch und seinen Thesen<br />
zu halten ist. Wir versammeln<br />
Stellungnahmen<br />
einflussreicher Kulturmacher<br />
und zeigen an drei Beispielen,<br />
wie überraschend<br />
innovativ Kultur finanziert<br />
wird.<br />
Die Diagnose: Deutschland<br />
steuert auf den „Kulturinfarkt“<br />
zu. Die öffentlich finanzierte<br />
Kulturlandschaft<br />
erweist sich, fern von Marktgeschehen<br />
und Publikumswünschen,<br />
als reformunfähig.<br />
„Von allem zu viel und<br />
überall das Gleiche“: Mit<br />
dem Untertitel ihres Buches<br />
zielen die Autoren, allesamt<br />
Kulturmanager und Kulturberater,<br />
auf den ihrer Meinung<br />
nach unübersehbaren<br />
Stillstand einer öffentlich<br />
verantworteten Kultur, die<br />
ihre wesentlichen Versprechen<br />
nicht hat einlösen können.<br />
Emanzipation durch<br />
Kultur? Integration von Minderheiten,<br />
gar wirtschaftliche<br />
Belebung durch Theater,<br />
Museen, Konzerthäuser? Alles<br />
Fehlschläge – sagen die<br />
Autoren. Dieter Haselbach,<br />
Armin Klein, Pius Knüsel<br />
und Stephan Opitz sehen die<br />
öffentlich geförderten Kultureinrichtungen<br />
als Sachwalter<br />
der Vorlieben und Interessen<br />
einer Minderheit,<br />
als Kartell, das Besitzstände<br />
wahrt und Erneuerung blockiert.<br />
Die Therapie: Das Autorenquartett<br />
rät zum radikalen<br />
Schnitt. „Was wäre gefährdet,<br />
wenn die Hälfte der<br />
Theater und Museen ver-<br />
Von Ralf Döring<br />
OSNABRÜCK. Am Ende ist<br />
es fast wie immer. Aber eben<br />
nur fast. Während das Publikum<br />
applaudiert, verschwindet<br />
Hermann Bäumer in den<br />
hinteren Reihen des OsnabrückerSymphonieorchesters,<br />
um sich bei Sonja Kettenhofen<br />
zu bedanken – sie<br />
hatte Montagmorgen noch<br />
nicht gewusst, dass sie<br />
abends als Solohornistin auf<br />
dem Podium der Osnabrückhalle<br />
sitzen würde. Sie hat ih-<br />
schwände? [. . .] Wäre das<br />
wirklich die Apokalypse?“,<br />
fragen die Autoren und empfehlen,<br />
die „Halbierung der<br />
Infrastruktur“. Jede zweite<br />
Kultureinrichtung wollen sie<br />
geschlossen sehen. Erst der<br />
entschiedene Verzicht<br />
schafft nach diesem Konzept<br />
Freiraum für neue Entwicklungen.<br />
Die Diagnostiker des<br />
„Kulturinfarkts“ schlagen<br />
vor, die frei werdenden Mittel<br />
für Laienkultur, die Förderung<br />
der digitalen Kulturindustrie,<br />
für Kunsthochschulen<br />
und kulturelle Bildung<br />
zu verwenden. Außerdem<br />
sollen ihrem Votum zufolge<br />
die verbleibenden öffentlichen<br />
Kulturhäuser besser<br />
finanziert werden.<br />
Die Kritik: Haselbach,<br />
Klein, Knüsel und Opitz legen<br />
mit „Der Kulturinfarkt“<br />
nicht einfach ein Buch vor,<br />
sie werfen ein Pamphlet wie<br />
einen Sprengsatz in die Kulturszene.<br />
Mit dem Vorschlag,<br />
die Kulturszene zu halbieren,<br />
lösen sie polemische Reaktionen<br />
aus, weil sie an Besitzstände<br />
und Identitäten rühren.<br />
Diese Streitschrift rüttelt<br />
eine Szene auf, die seit Oliver<br />
Scheytts Buch „Kulturstaat<br />
Deutschland“ (2008) keine<br />
nennenswerte Programmatik<br />
mehr entwickelt hat.<br />
Die Infarkt-Diagnose sorgt<br />
für helle Aufregung – mehr<br />
aber auch nicht. Die vier Autoren<br />
leben als Ausbilder, Berater<br />
und Planer von der Kulturszene<br />
nicht nur gut, sie<br />
sind für ihren nun heftig beklagten<br />
Zustand auch mit<br />
verantwortlich. Jetzt betreiben<br />
sie Kulturverachtung –<br />
vor allem deshalb, weil sie ein<br />
schlampig geschriebenes<br />
und lückenhaft dokumentiertes<br />
Werk vorlegen, das erkennbar<br />
aus hastig verschraubten<br />
Beratertexten gebastelt<br />
ist.<br />
FINANZ-CHECK: KUNST<br />
„Es geht um gute Ideen“<br />
Einnahmen über Sponsoren und Eintritte<br />
lü DÜSSELDORF/BREMEN.<br />
Öffentliche Vollversorgung?<br />
Davon können viele Museen<br />
und Kunsthallen nur träumen.<br />
Werner Lippert, Ausstellungsmanager<br />
des Düsseldorfer<br />
NRW-Forums, erhält<br />
jährlich 910 000 Euro<br />
von Stadt, Land und der Messe<br />
Düsseldorf für sein Haus.<br />
Der Jahresetat liegt aber bei<br />
rund drei Millionen. Den<br />
Fehlbetrag besorgt sich Lippert<br />
auf dem freien Markt.<br />
Das Ausstellungsprogramm<br />
wird gar bis zu 85 Prozent<br />
über Sponsoren finanziert.<br />
„Wir machen aktuelle Themen,<br />
haben ein junges Publikum“,<br />
sagt Lippert und fügt<br />
an: „Es geht nicht immer um<br />
das Geld, es geht um gute<br />
Ideen.“ Sein Lieblingsbeispiel<br />
in der Nachbarschaft:<br />
Das Wuppertaler Von-der-<br />
Heydt-Museum hat nach seinen<br />
Worten unter der neuen<br />
Leitung Ausstellungstätigkeit<br />
und Besucherzahlen<br />
deutlich gesteigert. Lipperts<br />
Fazit: Oft machen die richtigen<br />
Köpfe den Unterschied.<br />
Sponsoren sind auch in<br />
Bremen gefragt. 2,4 Millionen<br />
erhält die Kunsthalle<br />
jährlich von der Stadt – bei einem<br />
Jahresetat von mindestens<br />
fünf Millionen Euro. Das<br />
fehlende Geld erwirtschaftet<br />
das vom Kunstverein getragene<br />
Haus über Mitgliedsbeiträge,<br />
Eintritts- und Shoperlöse<br />
sowie Sponsorengelder.<br />
Nach den Worten von Ulrich<br />
Keller, Rechnungsführer des<br />
Kunstvereins, bringen gerade<br />
die großen Publikumsausstellungen<br />
Geld ins Haus.<br />
Das knappe Wirtschaften hat<br />
allerdings auch seinen Preis.<br />
„Wir sind unterbesetzt“,<br />
schildert Keller die personelle<br />
Situation der beim Publikum<br />
beliebten Kunsthalle.<br />
ren erkrankten Kollegen bravourös<br />
vertreten – keine<br />
Selbstverständlichkeit. Denn<br />
in Brahms’ zweiter Sinfonie<br />
gibt es einiges zu tun.<br />
Anschließend dürfen die<br />
weiteren Bläsersolisten den<br />
Applaus entgegennehmen;<br />
schließlich bedankt sich Bäumer<br />
bei den Stimmführern<br />
der Streicher, zwängt sich<br />
durch die Pulte zum Bratscher<br />
Francisco Saezguerra –<br />
er hat soeben sein letztes<br />
Symphoniekonzert gespielt<br />
und verabschiedet sich dem-<br />
Die Autoren fordern von<br />
der Kultur vehement, sich in<br />
der „Wirklichkeit“ des Marktes<br />
zu bewähren. Gleichzeitig<br />
verraten sie nahezu alle Leistungen,<br />
die Kultur und Künste<br />
für Menschen wertvoll machen.<br />
Bildung, Erfahrung,<br />
Kommunikation, Genuss, Erinnerung?<br />
Das alles und noch<br />
viel mehr findet vor den<br />
selbst ernannten Scharfrichtern<br />
der Kultur keine Gnade.<br />
Wie Ankläger, die nur Belege<br />
für die Schuld der insgeheim<br />
längst Abgeurteilten suchen,<br />
übersehen sie die Bewegung<br />
in der Kulturlandschaft<br />
selbst, die längst auf dem<br />
Weg zu neuen Zielgruppen,<br />
alternativen Formaten und<br />
kreativen Finanzierungsmodellen<br />
ist.<br />
Diese Szene interessiert<br />
längst nicht mehr, was Haselbach<br />
und Co. allen Ernstes<br />
noch als Orientierungspunkte<br />
der Kulturlandschaft sehen:<br />
Adornos „Kulturindustrie“<br />
(1947) und Hilmar Hoffmanns<br />
„Kultur für alle“<br />
(1979). Das Autorenquartett<br />
kämpft gegen eine abgelebte<br />
Vergangenheit, ignoriert zugleich,<br />
was den Vorschlag der<br />
Kulturhalbierung einem<br />
Wirklichkeitscheck aussetzen<br />
würde – der Abgleich mit<br />
den Erfahrungen, die beim<br />
Rückbau der Kulturlandschaft<br />
in den neuen Bundesländern<br />
zu machen waren.<br />
Zuweilen wollen es diese Kulturkritiker<br />
nicht allzu genau<br />
wissen. Was für ein seltsames<br />
Realitätsverständnis.<br />
Dieter Haselbach,<br />
Armin<br />
Klein, Pius<br />
Knüsel, Stephan<br />
Opitz:<br />
„Der Kulturinfarkt“.<br />
Knaus.<br />
287 Seiten,<br />
19,99 Euro.<br />
FINANZ-CHECK: THEATER<br />
Das Personal ist bezahlt<br />
Fördermittel sichern am Theater die Löhne<br />
dab OSNABRÜCK. Rund 17<br />
Millionen Euro kostet das<br />
Theater Osnabrück in der aktuellen<br />
Spielzeit. Der Löwenanteil<br />
davon, erklärt der<br />
Kaufmännische Direktor<br />
Matthias Köhn, stammt aus<br />
öffentlicher Förderung: Von<br />
diesen 14,5 Millionen trägt<br />
die Stadt rund zwei Drittel,<br />
das Land etwa eins. Der<br />
Landkreis ist mit 600 000<br />
Euro dabei. „Die Fördermittel<br />
betragen in der Regel etwa<br />
80 Prozent vom Gesamtetat“,<br />
erklärt Köhn. „Das entspricht<br />
in etwa dem Personalkostenanteil.“<br />
Die Mitarbeiter sind also<br />
bezahlt. Damit sie dann auch<br />
Bühnenbilder bauen, Kostüme<br />
schneidern, Programmhefte<br />
drucken, sprich: Theater<br />
machen können, müssen<br />
noch mal zweieinhalb Millionen<br />
Euro reingeholt werden.<br />
„Und zwar über Eigenein-<br />
Farbspiele mit Haarrissen<br />
nächst in den Ruhestand. Abschied<br />
allerorts gewissermaßen:<br />
Zu Beginn des Abends<br />
dankten Intendant Ralf<br />
Waldschmidt, Ex-GMD Bäumer<br />
und Orchestervorstand<br />
Matthias Wernecke dem ehemaligen<br />
Vorsitzenden des<br />
Musikvereins Klaus Laßmann<br />
für fast drei Jahrzehnte<br />
engagierte Arbeit mit Worten,<br />
Blumen und Geschenken.<br />
Gesten des Abschieds umrahmten<br />
also dieses erste<br />
Konzert Hermann Bäumers<br />
KOMMENTAR<br />
Stichworte für Populisten<br />
Von Stefan Lüddemann<br />
ultur braucht Debatte.<br />
Das haben jene Kultursachwalter<br />
ignoriert, die mit<br />
Sätzen wie „Theater muss<br />
sein“ oder „Wir fördern, was<br />
es schwer hat“ Begründungen<br />
geliefert haben, die einfach<br />
keine sind, oder dem<br />
Rückzug in die selbst gewählte<br />
Nische gefährlichen<br />
Vorschub geleistet haben.<br />
Antje Vollmers Vorschlag,<br />
alle deutschen Stadttheater<br />
als UNESCO-Welterbe un-<br />
nahmen“, sagt Köhn: „Über<br />
den Kartenverkauf, das<br />
Sponsoring und den Verdienst<br />
aus Gastspielen.“<br />
Dass Theater nicht unternehmerisch<br />
denken, lässt<br />
Köhn nicht gelten. Er verweist<br />
auf ein funktionierendes<br />
Controlling-System, auf<br />
eingehaltene Etats und die<br />
Entwicklung neuer Angebote<br />
wie die Theater-Abo-Busse<br />
für das Umland. Die Osnabrücker<br />
nutzen das Programm:<br />
Die Auslastung beziffert<br />
Köhn mit gut 80 Prozent.<br />
Das ist wichtig; schließlich<br />
steckt die Stadt etwa die<br />
Hälfte des Kulturetats in das<br />
Haus. Dafür, so Köhn, kriegt<br />
sie aber auch viel zurück:<br />
„Das Theater leistet etwas,<br />
zum Beispiel in der Bildungsarbeit.<br />
Ein Drittel unserer Besucher<br />
sind Kinder und Jugendliche.<br />
Bundesweit ist<br />
das ein Spitzenwert.“<br />
als Gastdirigent des OsnabrückerSymphonieorchesters.<br />
Und was soll man sagen:<br />
Es war ein holpriger Beginn.<br />
Max Regers Romantische<br />
Suite zählt gewiss nicht zu<br />
den Rennern des Orchesterrepertoires.<br />
Doch der Komponist<br />
aus der Oberpfalz<br />
mischt höchst originell zarte<br />
impressionistische Farben<br />
mit Anklängen an die<br />
deutsch-österreichische Musiktradition,<br />
wie sie auch<br />
Bruckner, Mahler, Strauss<br />
pflegten. Nur leider zogen<br />
dö OSNABRÜCK. Thomas Albert<br />
ist von der Freien Hansestadt<br />
Bremen auf Diät gesetzt<br />
worden. Mit knapp 900 000<br />
Euro sicherte die Stadt noch<br />
vor vier Jahren die Basisfinanzierung<br />
des Bremer Musikfestes,<br />
dieses Jahr sind es<br />
nur noch 550 000 Euro. Die<br />
aber sind sicher. Das habe<br />
der zuständige Finanzsenator<br />
gestern bei der Vorstellung<br />
des diesjährigen Musikfest-Programmsversprochen,<br />
sagt Albert.<br />
Nun lässt sich mit dem<br />
Geld der Stadt nicht einmal<br />
der laufende Betrieb des Musikfests<br />
finanzieren. Ohnehin<br />
arbeiten die meisten nur<br />
stundenweise fürs Musikfest:<br />
eine halbe Stelle Öffentlichkeitsarbeit,<br />
eine Viertelstelle<br />
für einen Techniker, 25 Stunden<br />
Buchhaltung und so weiter.<br />
Anderthalb Stellen<br />
Künstlerisches Betriebsbüro.<br />
sich an diesem Abend etliche<br />
Haarrisse durchs pastose<br />
Farbspiel. Sicher weiß Bäumer,<br />
was sein – nun ja ehemaliges<br />
– Orchester kann. So<br />
weiß er die dynamische<br />
Bandbreite von kaum hörbar<br />
bis prachtvoll auftrumpfend<br />
abzurufen. Auch zeichnet das<br />
Orchester die Linien nach,<br />
die Bäumer mit seinen Händen<br />
formt. Und doch hörte<br />
sich das manchmal an, als<br />
tappten die Musiker unsicher<br />
und allein gelassen durch die<br />
Eichendorff’ schen Welten,<br />
MITTWOCH,<br />
21. MÄRZ 2012<br />
Jedes zweite Kulturhaus<br />
schließen? Praktisch sähe<br />
das so aus wie in dieser – zum<br />
Glück ganz und gar fiktiven –<br />
Zusammenstellung. Von links<br />
oben nach rechts unten: Theater<br />
Osnabrück, Kunsthalle<br />
Schirn in Frankfurt, Galerie<br />
der Gegenwart in Hamburg,<br />
Essens Museum Folkwang,<br />
Philharmonie in Berlin, Lagerhalle<br />
Osnabrück, Thalia-Theater<br />
Hamburg, Festspielhaus in<br />
Bayreuth. Fotos: dpa, dapd, Archiv<br />
FINANZ-CHECK: MUSIK<br />
Ein Kanal für Lebenssaft<br />
Sockelbetrag von der Kommune<br />
Vier ganze Stellen kommen<br />
da zusammen, und bereits<br />
dafür muss Albert Gelder einwerben.<br />
23 000 Besucher besuchten<br />
letztes Jahr rund 30 Konzerte;<br />
die Platzauslastung<br />
liegt seit Jahren bei 85 Prozent.<br />
Dafür bekommt das Publikum<br />
große Namen – Rolando<br />
Villazón, Diana Damrau<br />
und Murray Perahia sind<br />
dieses Jahr dabei – und spannende<br />
Newcomer. Die musikalische<br />
Qualität ist exquisit<br />
und kostet: dieses Jahr 3,1<br />
Millionen Euro. Vier Fünftel<br />
davon wirbt Albert selbst ein<br />
– über Sponsoren, die ihn<br />
zum Teil seit über 20 Jahren<br />
unterstützen. „Die sind mit<br />
Herzblut dabei und dokumentieren<br />
ihre gesellschaftliche<br />
Verantwortung“, sagt Albert.<br />
Denn Kultur ist für den<br />
Musikfest-Leiter „ein Kanal<br />
für Lebenssaft“.<br />
Hermann Bäumer und das Osnabrücker Symphonieorchester bleiben mit Brahms und Reger hinter den Erwartungen zurück<br />
K<br />
ter Schutz zu stellen, markierte<br />
den Gipfelpunkt einer<br />
Kulturpolitik als Bestandsschutz<br />
um jeden Preis.<br />
Mit dem „Kulturinfarkt“<br />
schlägt die Tonlage nun rabiat<br />
um. Die Streitschrift<br />
liefert Stichworte für Populisten,<br />
Mahner und Warner.<br />
Die einen wollen am liebsten<br />
die ganze Kultur dichtmachen,<br />
die anderen sehen<br />
selbst mit der kleinsten Einsparung<br />
den Untergang des<br />
Abendlandes heraufziehen.<br />
Beides hilft nicht weiter.<br />
Dabei arbeitet die Kulturszene<br />
längst an neuen Herausforderungen.<br />
Statt Sattheit<br />
und Reformstau zu beklagen,<br />
hätten die Infarkt-<br />
Diagnostiker auch avancierte<br />
Beispiele einer erneuerten<br />
Kulturarbeit beschreiben<br />
können. Das furiose<br />
Verdammungsurteil sorgt<br />
für <strong>Medien</strong>echo, der ernst<br />
gemeinte Vorschlag nicht.<br />
Dabei verdiente Kultur Hingabe<br />
und keinen Zynismus.<br />
s.lueddemann@noz.de<br />
die Reger als Grundlage seiner<br />
Komposition heranzog.<br />
Gleiches gilt auch für die<br />
zweite Sinfonie von Johannes<br />
Brahms, die ihrer dunkelgrünen<br />
Grundstimmung wegen<br />
auch „Pastorale“ genannt<br />
wird. Erst ab dem dritten<br />
Satz scheinen Orchester und<br />
Dirigent zueinandergefunden<br />
zu haben, stellt sich die<br />
Gespanntheit ein, mit der Orchester<br />
und Dirigent oft begeistert<br />
haben – zuletzt beim<br />
fünften Sinfoniekonzert mit<br />
Schostakowitschs Zehnter.