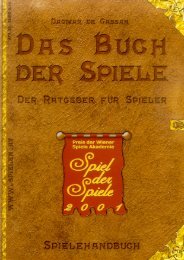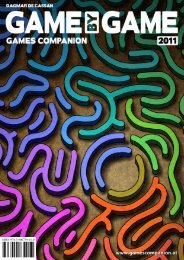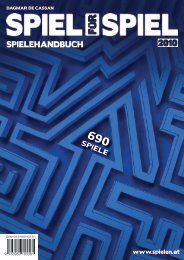Spielen Sie bei uns mit! - Ãsterreichisches Spiele Museum
Spielen Sie bei uns mit! - Ãsterreichisches Spiele Museum
Spielen Sie bei uns mit! - Ãsterreichisches Spiele Museum
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DIE GESCHICHTE DES WÜRFELSPIELS<br />
von Hugo Kastner<br />
Vorabdruck aus: „Die große Humboldt Enzyklopädie der Würfelspiele“<br />
Glücksspiel & Schicksal<br />
„Schicksal“ und „Lotterie“ haben in zahlreichen Sprachen die gleiche<br />
Wurzel, da nach Überzeugung vieler Völker das individuelle wie auch das<br />
kollektive Schicksal vom Wurf der Götterhände bestimmt werden. Nicht<br />
nur im Alten Testament, wo Saul einen Streit <strong>mit</strong> seinem Sohn durch<br />
Gottesurteil, durch Ziehen eines Loses, zu schlichten versucht, auch in<br />
Homers Ilias wird das Schicksal der Trojaner auf den sprichwörtlich<br />
goldenen Waagschalen entschieden. Bei den alten Germanen würfeln<br />
die Asen, die zwölf Hauptgötter, <strong>mit</strong> Leidenschaft um die Herrschaft<br />
über die Welt. Im Mittelalter spiegelt sich der bedingungslose Glaube<br />
an das Gottesurteil <strong>bei</strong> allen Prozessen wider. Der Mensch akzeptierte<br />
schon immer eine höhere Macht, sei es Gott oder den Zufall. Daher wird<br />
auch das Verlangen verständlich, die Zukunft, das ungewisse Schicksal,<br />
vorauszusehen, es zu verstehen und es letztlich zu beeinflussen. Auch<br />
das französische Wort für Würfel dé, abgeleitet vom Lateinischen datum,<br />
erinnert an die divinatorischen Handlungen antiker Auguren. Der Würfel<br />
galt und gilt schlechthin als Sinnbild für die Entscheidung zwischen Glück<br />
und Unglück.<br />
Eine der monumentalen, ehemals heidnischen Kultstätten, die Kaaba,<br />
wurde 630 zum zentralen Heiligtum des Islams. Am Anfang und Ende<br />
der Pilgerfahrt wird der Meteoritstein siebenmal umkreist. Dasein und<br />
Ewigkeit verbinden sich an dieser nach dem Hexaeder benannten Stätte<br />
(arab. ka’b = Würfel) in einmaliger Art und Weise. Aber auch in der<br />
Bibel wird in der Offenbarung des Johannes das himmlische Jerusalem,<br />
das Ziel der Menschheit, als würfelförmige Stadt beschrieben. Wörtlich<br />
heißt es: Und der Engel, der zu mir sprach, hatte einen goldenen Messstab, <strong>mit</strong><br />
dem die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer gemessen wurden. Die Stadt war viereckig<br />
angelegt und ebenso lang wie breit. Er maß die Stadt <strong>mit</strong> dem Messstab; ihre Länge,<br />
Breite und Höhe sind gleich: zwölftausend Stadien. Und er maß ihre Mauer; sie ist<br />
hundertvierundvierzig Ellen hoch nach Menschenmaß, das der Engel benutzt hatte.<br />
Ihre Mauer ist aus Jaspis gebaut und die Stadt ist aus reinem Gold, wie aus reinem<br />
Glas. (Off 21,15-18)<br />
Diesem, dem Schicksal ergebenen Denken, steht die moderne Aufklärung<br />
gegenüber, die Anfang des 20. Jahrhunderts den genialen Physiker Albert<br />
Einstein zu seinem berühmten Bonmot veranlasst: „Gott würfelt nicht!“<br />
Einstein sagt da<strong>mit</strong> dem Zufall den Kampf an und verwendet ganz<br />
bewusst den Würfel als symbolisches Bild. Der weite Kreis zurück zu<br />
Platon, der bereits 400 v. Chr. die fünf regelmäßigen Körper (Tetraeder,<br />
Hexaeder, Oktaeder, Dodekaeder, Ikosaeder) beschrieb, schließt sich in<br />
ungeahnter Art und Weise. Platon würfelte <strong>mit</strong> den platonischen Körpern<br />
ebenso wenig wie Einstein, sondern dachte vielmehr darüber nach, ob<br />
Weltall und Elemente aus diesen eleganten Formen zusammengesetzt<br />
sein könnten. Da<strong>bei</strong> ordnete er dem Element Erde den Würfel zu,<br />
verdammte jedoch gleichzeitig das exzessive Würfeln um Geld, Sklaven<br />
und Ländereien. Der Würfel stand schon damals, im 4. Jahrhundert vor<br />
Christus, als Symbol für <strong>uns</strong>er Universum.<br />
Astragale & Kaurimuscheln<br />
Bis zu <strong>uns</strong>eren modernen Würfeln war es aber ein weiter Weg. Die<br />
sechs Tetraeder, die Sir Leonard Woolley in der Stadt Ur fand und <strong>mit</strong> der<br />
wahrscheinlich das Royal Game of Ur gespielt wurde, würden heute kaum als<br />
Würfel erkannt werden. Und doch sind diese aus Lapislazuli und Elfen<strong>bei</strong>n<br />
geformten, <strong>mit</strong> jeweils zwei markierten Ecken ausgestatteten Tetraeder,<br />
die ältesten bis heute bekannten Vorläufer <strong>uns</strong>eres Spielgeräts. Eine<br />
parallele Entwicklung <strong>mit</strong> Würfelstangen, die durch einfache und doppelte<br />
Striche sowie einem Kreuz markiert waren, findet sich im ägyptischen<br />
Spiel Senet. Auch das indische Chausar kennt die Würfelstangen, allerdings<br />
bereits <strong>mit</strong> fast modern anmutenden Augenwerten. Jahrhundertelang<br />
wurde in Indien Pachisi, der Vorläufer des Klassikers Mensch ärgere Dich<br />
nicht!, <strong>mit</strong> sechs Kaurimuscheln gespielt. Zeigten zwei bis sechs Öffnungen<br />
nach oben, gab es entsprechende Punkte von 2 bis 6, eine oder keine<br />
Öffnung dagegen brachten 10 bzw. 25 Punkte für den Wurf.<br />
Den Arabern oder den Etruskern werden die ersten sechsseitigen Würfel<br />
zugeschrieben. Allerdings steht über letzterer Spekulation ein großes<br />
Fragezeichen. Immerhin zeigen Ausgrabungen von Militärlagern, dass<br />
römische Legionäre offensichtlich einen eher atypischen, vierzehnseitigen<br />
Würfel verwendeten, der, so ist Wandbildern zu entnehmen, ausschließlich<br />
dem Glücksspiel diente. Und als Nachfahren der Etrusker hätten die<br />
Römer wohl auch deren Spielgerät übernommen. Auch Cäsars berühmter<br />
Ausspruch <strong>bei</strong>m Überschreiten des Rubikon - alea iacta est - wird sich eher<br />
auf die damals üblichen Astragale (Mittelfußknöchelchen von Schafen und<br />
Ziegen) bezogen haben, und diese hatten ausnahmslos nur vier Seiten,<br />
wie zahlreiche Funde bestätigen. Zur Zeit des Römischen Imperiums<br />
würfelte man gleichzeitig <strong>mit</strong> vier „Knöcheln“ (lat. aleae), die zahlreiche<br />
Kombinationen ermöglichten, vom berauschenden Venuswurf (lat. iactus<br />
Veneris) bis zu den vernichtenden vier Einsen, dem Hundewurf (lat.<br />
iactus canis), der den sofortigen Verlust anzeigte. Wie sagt das lateinische<br />
Sprichwort: Aut Caesar, aut nihil (Alles oder nichts).<br />
Historie & Teufelszeug<br />
Erst eine griechische Handschrift aus dem 10. Jahrhundert erwähnt<br />
zum ersten Mal den Hexaeder, wo<strong>bei</strong> auch bereits auf die magische „7“,<br />
die ja in den gegenüberliegenden Seiten eines Würfels zum Ausdruck<br />
kommt, hingewiesen wird. Dies <strong>mit</strong> allerlei mystischen Deutungen, die<br />
auch heute noch nichts von ihrer Nachhaltigkeit verloren haben. Der<br />
Prediger Bareletta machte bereits im 13. Jahrhundert die überraschende<br />
Feststellung: „Wie der Herr die 21 Buchstaben schuf ..., so erfand der Teufel den<br />
Würfel, auf dessen Seiten er 21 Punkte anbrachte.“ Noch drastischer brachte<br />
König Ludwig der Heilige (1236-1270) seine Antipathie zum Ausdruck.<br />
Er verbot kurzerhand die Herstellung von Würfeln und glaubte da<strong>mit</strong><br />
das Würfelspiel unterbinden zu können. Immerhin konnte er sich auf<br />
den um 1220 von Ritter Eike von Repgow verfassten „Sachsenspiegel“,<br />
das älteste deutsche Rechtsbuch, berufen. Hier steht schwarz auf weiß<br />
in lateinischer Sprache: „Wer einen Rock verleiht, kann ihn zurückfordern. Wer<br />
dagegen einen Rock <strong>mit</strong> Würfeln verspielt, der verliert ihn endgültig.“ (Frei übersetzt,<br />
Anm. d. Verf.)<br />
Möglicherweise steht diese Verurteilung des Glücksspiels auch <strong>mit</strong> der im<br />
Matthäusevangelium beschriebenen Kreuzigungsszene in Zusammenhang,<br />
wo wörtlich steht: „Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das Los (englische<br />
Ausgabe „dice“ Würfel; Anm. d. Verf.) und verteilten seine Kleider unter sich.“<br />
Eine in den Psalmen gemachte Prophezeihung war da<strong>mit</strong> erfüllt. Am<br />
Ende des Mittelalters wurden in Nürnberg, der späteren <strong>Spiele</strong>stadt, unter<br />
dem Heiligen Kapistran, einem Franziskanermönch, sogar 40.000 Würfel<br />
auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wer darin eine Bestätigung für seine<br />
persönliche Skepsis erblickt, darf nicht vergessen, dass <strong>bei</strong> eben diesem<br />
Anlass auch 3640 Schachbretter den Flammen zum Opfer fielen. Auch<br />
das heute als intellektuell geltende Schachspiel wurde also als Teufelszeug<br />
verurteilt. Als ein wesentlicher Grund galten die ständigen Querelen und<br />
die da<strong>mit</strong> zusammenhängenden Gotteslästerungen. Ein weiterer Grund<br />
ist in den zahlreichen Betrügereien zu sehen, die so manchen Glücksritter<br />
buchstäblich seine letzte Jacke und Hose kosteten. Drakonische Strafen,<br />
wie an den Pranger stellen (in Basel trug der Verurteilte einen gelben<br />
Hut und einen <strong>mit</strong> drei Würfeln bemalten Mantel), halfen aber ebenso<br />
wenig wie generelle Verbote, die in Mailand sogar bis zur Verbannung<br />
in eine mehr als hundert Meilen entfernte Gegend reichten (Mailänder<br />
Magistrat, 1396). Für ein Jahr durfte niemand in die Wohnung eines<br />
solcherart Verurteilten übersiedeln. Eine spanische Illustration aus dem<br />
13. Jahrhundert bringt die Gefahr klar auf den Punkt: Im Hintergrund<br />
einer Spelunke, in der dem Würfelspiel gefrönt wird, lauert der Satan. Es<br />
gibt drei Tore: das der Hoffnung, durch das die Gäste eintreten, und zwei<br />
weitere, das Tor der Ehrlosigkeit und das Tor des Todes, durch die sie<br />
wieder fortgehen.<br />
Seit dem frühen 16. Jahrhundert wechselten bisweilen ganze Vermögen<br />
ihre Besitzer. König Heinrich IV. soll an einem Abend <strong>bei</strong>m Belote 600.000<br />
Franken verloren haben, für damalige Zeit ein Milliardenvermögen.<br />
Erasmus von Rotterdam, der berühmte Gelehrte, stellte sich daher<br />
die Frage, ob Würfelspieler nicht eher gefährlichen Irren ähnelten als<br />
einfachen Narren. Hier schließt sich der Bogen zu den Betrachtungen des<br />
römischen Schriftstellers Tacitus, dessen Schriften (Germania, Kapitel<br />
24) wir entnehmen können, dass auch die Germanen leidenschaftliche<br />
Würfelspieler waren: „Das Würfelspiel betreiben sie auch im nüchternen Zustand<br />
wie ernste Geschäfte, und zwar <strong>mit</strong> solcher Leichtfertigkeit <strong>bei</strong>m Gewinnen und<br />
Verlieren, dass sie dann, wenn alles vertan ist, <strong>mit</strong> einem entscheidenden letzten Wurf<br />
2006 Das Buch der <strong>Spiele</strong> - Österreichisches <strong>Spiele</strong>handbuch<br />
Seite 63