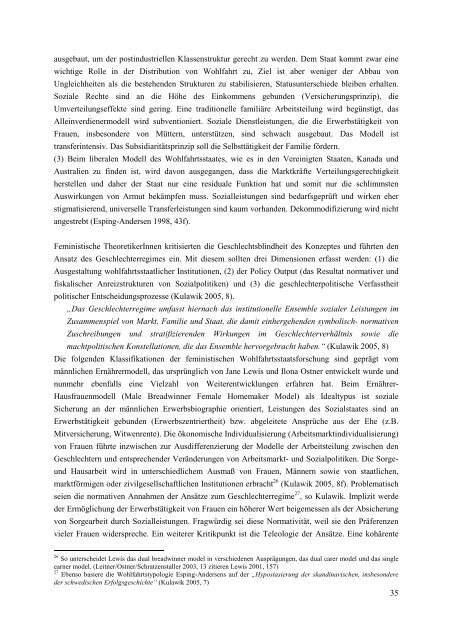dissertation
dissertation
dissertation
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ausgebaut, um der postindustriellen Klassenstruktur gerecht zu werden. Dem Staat kommt zwar eine<br />
wichtige Rolle in der Distribution von Wohlfahrt zu, Ziel ist aber weniger der Abbau von<br />
Ungleichheiten als die bestehenden Strukturen zu stabilisieren, Statusunterschiede bleiben erhalten.<br />
Soziale Rechte sind an die Höhe des Einkommens gebunden (Versicherungsprinzip), die<br />
Umverteilungseffekte sind gering. Eine traditionelle familiäre Arbeitsteilung wird begünstigt, das<br />
Alleinverdienermodell wird subventioniert. Soziale Dienstleistungen, die die Erwerbstätigkeit von<br />
Frauen, insbesondere von Müttern, unterstützen, sind schwach ausgebaut. Das Modell ist<br />
transferintensiv. Das Subsidiaritätsprinzip soll die Selbsttätigkeit der Familie fördern.<br />
(3) Beim liberalen Modell des Wohlfahrtsstaates, wie es in den Vereinigten Staaten, Kanada und<br />
Australien zu finden ist, wird davon ausgegangen, dass die Marktkräfte Verteilungsgerechtigkeit<br />
herstellen und daher der Staat nur eine residuale Funktion hat und somit nur die schlimmsten<br />
Auswirkungen von Armut bekämpfen muss. Sozialleistungen sind bedarfsgeprüft und wirken eher<br />
stigmatisierend, universelle Transferleistungen sind kaum vorhanden. Dekommodifizierung wird nicht<br />
angestrebt (Esping-Andersen 1998, 43f).<br />
Feministische TheoretikerInnen kritisierten die Geschlechtsblindheit des Konzeptes und führten den<br />
Ansatz des Geschlechterregimes ein. Mit diesem sollten drei Dimensionen erfasst werden: (1) die<br />
Ausgestaltung wohlfahrtsstaatlicher Institutionen, (2) der Policy Output (das Resultat normativer und<br />
fiskalischer Anreizstrukturen von Sozialpolitiken) und (3) die geschlechterpolitische Verfasstheit<br />
politischer Entscheidungsprozesse (Kulawik 2005, 8).<br />
„Das Geschlechterregime umfasst hiernach das institutionelle Ensemble sozialer Leistungen im<br />
Zusammenspiel von Markt, Familie und Staat, die damit einhergehenden symbolisch- normativen<br />
Zuschreibungen und stratifizierenden Wirkungen im Geschlechterverhältnis sowie die<br />
machtpolitischen Konstellationen, die das Ensemble hervorgebracht haben.“ (Kulawik 2005, 8)<br />
Die folgenden Klassifikationen der feministischen Wohlfahrtsstaatsforschung sind geprägt vom<br />
männlichen Ernährermodell, das ursprünglich von Jane Lewis und Ilona Ostner entwickelt wurde und<br />
nunmehr ebenfalls eine Vielzahl von Weiterentwicklungen erfahren hat. Beim Ernährer-<br />
Hausfrauenmodell (Male Breadwinner Female Homemaker Model) als Idealtypus ist soziale<br />
Sicherung an der männlichen Erwerbsbiographie orientiert, Leistungen des Sozialstaates sind an<br />
Erwerbstätigkeit gebunden (Erwerbszentriertheit) bzw. abgeleitete Ansprüche aus der Ehe (z.B.<br />
Mitversicherung, Witwenrente). Die ökonomische Individualisierung (Arbeitsmarktindividualisierung)<br />
von Frauen führte inzwischen zur Ausdifferenzierung der Modelle der Arbeitsteilung zwischen den<br />
Geschlechtern und entsprechender Veränderungen von Arbeitsmarkt- und Sozialpolitiken. Die Sorge-<br />
und Hausarbeit wird in unterschiedlichem Ausmaß von Frauen, Männern sowie von staatlichen,<br />
marktförmigen oder zivilgesellschaftlichen Institutionen erbracht 26 (Kulawik 2005, 8f). Problematisch<br />
seien die normativen Annahmen der Ansätze zum Geschlechterregime 27 , so Kulawik. Implizit werde<br />
der Ermöglichung der Erwerbstätigkeit von Frauen ein höherer Wert beigemessen als der Absicherung<br />
von Sorgearbeit durch Sozialleistungen. Fragwürdig sei diese Normativität, weil sie den Präferenzen<br />
vieler Frauen widerspreche. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Teleologie der Ansätze. Eine kohärente<br />
26 So unterscheidet Lewis das dual breadwinner model in verschiedenen Ausprägungen, das dual carer model und das single<br />
earner model. (Leitner/Ostner/Schratzenstaller 2003, 13 zitieren Lewis 2001, 157)<br />
27 Ebenso basiere die Wohlfahrtstypologie Esping-Andersens auf der „Hypostasierung der skandinavischen, insbesondere<br />
der schwedischen Erfolgsgeschichte“ (Kulawik 2005, 7)<br />
35