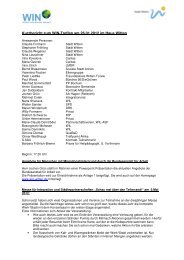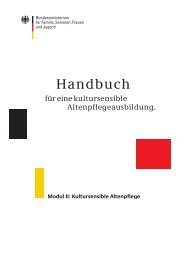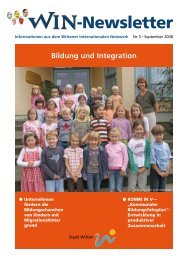Integration als Chance für Nordrhein-Westfalen und seine Kommunen
Integration als Chance für Nordrhein-Westfalen und seine Kommunen
Integration als Chance für Nordrhein-Westfalen und seine Kommunen
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
16 | 2. Rahmenbedingungen <strong>und</strong> aktuelle Entwicklungen17 | 2. Rahmenbedingungen <strong>und</strong> aktuelle Entwicklungen• Schließlich machen sowohl die Ergebnisse von Kommunal- <strong>und</strong> Landtagswahlenin diversen B<strong>und</strong>esländern <strong>als</strong> auch der Anstieg der Zahl rechtsextremerGewalttaten in <strong>Nordrhein</strong>-<strong>Westfalen</strong> im Jahre 2005 um 16 % (vgl.Verfassungsschutzbericht des Landes <strong>Nordrhein</strong>-<strong>Westfalen</strong> über das Jahr2005, S. 25) deutlich, dass Rechtsextremismus <strong>und</strong> Fremdenfeindlichkeitnach wie vor eine der größten gesellschaftspolitischen Herausforderungenfür die freiheitliche Demokratie darstellen <strong>und</strong> somit unsere besondereAufmerksamkeit erfordern.Dem stehen Tendenzen zur „Normalisierung“ der Einstellung zu Deutschlandgegenüber. So zeigte sich beispielsweise im Zusammenhang der Fußball-Weltmeisterschaft ein veränderter Umgang mit politischen Symbolen wie derdeutschen Fahne sowohl bei Deutschen <strong>als</strong> auch bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.Außenminister Frank-Walter Steinmeier sprach in diesemZusammenhang von einer „Selbstverwandlung“ der Deutschen <strong>und</strong> sagte, dieWeltmeisterschaft habe Deutschland neues Ansehen eingebracht (vgl. FAZ10.7.06) 17 . B<strong>und</strong>espräsident Horst Köhler äußerte: „Man sieht auch, dass wiruns zu unserer Fahne bekennen, ohne dass wir daraus jetzt eine politischeGroßaktion eines neuen Nationalismus machen. Die Menschen <strong>und</strong> das Publikumhaben uns gezeigt, was guter Patriotismus ist“ (FAZ 10.7.06). 18• Sie kann zur Abgrenzung nicht nur gegenüber der aufnehmenden Gesellschaft,sondern auch innerhalb der „Zuwanderergesellschaft“ führen <strong>und</strong>birgt daher die Gefahr des Rückzugs in die eigene (Sub-)Kultur (vgl. dazuauch Strohmeier).Wesentlich ist daher eine spezifische Ausgestaltung der <strong>Integration</strong>sarbeit fürverschiedene Zuwanderergruppen, die den jeweiligen kulturellen UnterschiedenRechnung trägt <strong>und</strong> auf der örtlichen Ebene ansetzt. Dabei gilt es auch,alters- <strong>und</strong> geschlechtsspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen.Bei aller Heterogenität innerhalb der „Zuwanderergesellschaft“ manifestierensich in einigen Bereichen Unterschiede zwischen den Zugewanderten <strong>und</strong> derAufnahmegesellschaft. Beispielhaft ist der Bereich der politischen Partizipationzu nennen. So liegt die Wahlbeteiligung bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichtedeutlich unter der der einheimischen Bevölkerung. Aufgr<strong>und</strong> derSegregation kann dies mittelfristig zur Entwicklung „demokratiefreier Zonen“in einigen Stadtteilen führen, zumal sich dort vielfach auch nicht wahlberechtigteZugewanderte konzentrieren (vgl. dazu Storz/Wilmes; Wüst, Andreas,S. 228 ff. sowie die Forschungsergebnisse des Zentrums für interdisziplinäreRuhrgebietsforschung der Universität Bochum (ZEFIR)).Gesellschaftliche Veränderungen zeigen sich aber auch bei den Menschen mitZuwanderungsgeschichte. So wird zunehmend spürbar, dass sich ein Großteilder Zugewanderten der Herausforderung eines „Lebens zwischen den Kulturen“stellen muss. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte leben häufig zwischendem gesamtgesellschaftlich dominierenden Wertesystem der B<strong>und</strong>esrepublikDeutschland <strong>und</strong> dem Wertesystem des Herkunftslandes, das auchdann eine Rolle spielen kann, wenn die Zugewanderten diese nicht mehr odernur noch rudimentär aus eigener Erfahrung kennen. Als besonders problematischstellt sich diese Entwicklung dar, wenn sich das Wertesystem der Familievon dem der Aufnahmegesellschaft unterscheidet, was sich beispielsweise inverschiedenen Vorstellungen von der Rolle der Frau zeigen <strong>und</strong> zu vielfältigenKonflikten nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch in der Schule oder amArbeitsplatz führen kann.Ferner tritt die Vielfalt <strong>und</strong> Heterogenität der unterschiedlichen „Zuwanderer-Communities“immer deutlicher zu Tage. Menschen mit Zuwanderungsgeschichtebilden eine „heterogene Population, die <strong>als</strong> Deutsche oder Nicht-Deutsche, <strong>als</strong> lange hier Lebende, vielleicht hier Geborene oder gerade erstEingewanderte sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, <strong>und</strong> dieauch hinsichtlich ihres (ausländer-)rechtlichen Status nicht vergleichbar sind“(Stellungnahme der B<strong>und</strong>eskonferenz für Erziehungsberatung, S. 149).2.4 Notwendigkeit einer geschlechterdifferenzierten PerspektiveDie unterschiedlichen Lebensentwürfe <strong>und</strong> -wirklichkeiten von einheimischenFrauen <strong>und</strong> Männern in Deutschland sind äußerst vielfältig. Diese Komplexitätwächst mit Blick auf Menschen mit Zuwanderungsgeschichte: „Deutlich stelltsich heraus, dass Migrantinnen <strong>und</strong> Migranten zum Teil verschiedene soziale,rechtliche <strong>und</strong> ökonomische Herkunfts- <strong>und</strong> Aufnahmebedingungen vorfindenbzw. das Geschlechterverhältnis jeweils unterschiedliche Erfahrungen <strong>und</strong> Konsequenzenstrukturiert (Westphal (Internetdokument ohne Seitenangabe))“.Ein Erfolgsfaktor effektiver <strong>Integration</strong>sarbeit, der der Pluralität der Lebensformenvon Frauen <strong>und</strong> Männern mit Zuwanderungsgeschichte Rechnungträgt, ist die zielgruppenorientierte Arbeit (vgl. Kapitel 4.3). Gender Mainstreamingkann in diesem Zusammenhang <strong>als</strong> Analyseinstrument dienen, integrationsrelevanteProdukte <strong>und</strong> Prozesse auf geschlechtsspezifische Fragen hin zuüberprüfen <strong>und</strong> entsprechend auszurichten.Die Herausbildung verschiedener ethnischer, religiöser oder kultureller Identitäteninnerhalb der Gruppe der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte <strong>und</strong>die Segregation einzelner Gruppen von Zugewanderten auf der Stadtteilebenesind mit zwei möglichen Folgen verb<strong>und</strong>en:• Sie kann positiv wirken, indem sie Identität stiftet, zur Bildung von Netzwerkenanregt <strong>und</strong> ein konfliktarmes Zusammenleben innerhalb der jeweiligenGruppe ermöglicht,17/18 Vgl. www.faz.net/s/Rub47986C2FBFBD461B8A2C1EC681AD639D/Doc~EC0360851A27F49F2B8E8DD08716511A8~ATpl~Ecommon~Scontent.html[Zugriff am 25.9.06].Die spezifischen Rollen, Interessen, Potenziale <strong>und</strong> Bedarfe von Mädchen <strong>und</strong>Jungen, jungen <strong>und</strong> älteren Frauen <strong>und</strong> Männern mit Zuwanderungsgeschichtegilt es in allen integrationsrelevanten Handlungsfeldern.Da die Kategorien Gender/soziales Geschlecht <strong>und</strong> Ethnizität – ebenso wiealters- oder statusspezifische Aspekte – quer zu den traditionellen Handlungsfeldernverlaufen, handelt es sich im eigentlichen Sinne um zwei Querschnittsaufgaben,die es parallel <strong>und</strong> gleichermaßen in Politik, Wirtschaft <strong>und</strong>Gesellschaft – hier auch ganz besonders im Verwaltungsbereich – zu implementierengilt. Die Frage nach geschlechtsspezifischen Wirkungen integrativer(kommunaler) Maßnahmen muss dementsprechend auch in jeder Phase