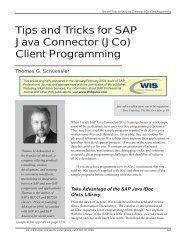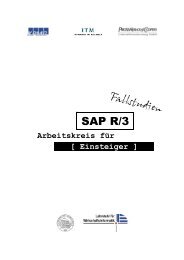Theorieskript.pdf - Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik - TUM
Theorieskript.pdf - Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik - TUM
Theorieskript.pdf - Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik - TUM
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Theorieskript</strong> Branchenneutrale Informationssysteme am Beispiel SAP R/33.3.2. ReferenzeinkaufsorganisationJe nach Einstellung Ihres Systems können zentraler und dezentraler Einkauf getrenntnebeneinander existieren oder der dezentrale Einkauf kann Kontrakte und Konditionennutzen, die vom Zentraleinkauf angelegt wurden. Dies kann mit Hilfe derReferenzeinkaufsorganisation (Einkaufsorganisation, auf deren Konditionen oderKontrakte solche Einkaufsorganisationen zugreifen dürfen, die mit ihr verbunden sind)abgebildet werden.Eine Referenzeinkaufsorganisation kann einem oder keinem Buchungskreis zugeordnetsein. In der Regel ist ihr kein Werk zugeordnet, allerdings können Ihr ein, kein odermehrere Werke zugeordnet werden.Vorteile der Referenzeinkaufsorganisation:• Eine Referenzeinkaufsorganisation kann einen umfangreichen Kontraktaushandeln, den andere Einkaufsorganisationen nutzen können. DieEinkaufsorganisationen, die für die Beschaffung in den einzelnen Werkenverantwortlich sind, können Materialien über diesen sog. Zentralkontraktabrufen und somit dessen vorteilhafte Konditionen nutzen.• Mit Hilfe von SAP - ALE (Application Link Enabling) können auch einzelneFirmen, die zu einem Konzern gehören, aber jeweils mit unabhängigen SAP-Systemen arbeiten, Kontrakte gemeinsam nutzen. Es handelt sich dabei um sog.‘Verteilte Kontrakte’.Im Handelsumfeld reduziert das Arbeiten mit einer Referenzeinkaufsorganisation denDatenpflegeaufwand, da Einkaufsorganisationsdaten für Lieferantenstammsätze undEinkaufsinfosätze nur von der Referenz- Einkaufsorganisation angelegt werden müssen.Andere Einkaufsorganisationen, die im Customizing mit ihr verbunden sind, könnendiese Daten nutzen, ohne selbst Daten pflegen zu müssen.4. EinkaufsprozessNach diesem Kapitel kennen Sie den typischen Ablauf eines externen Beschaffungsvorgangs,von der Bedarfsermittlung über die Bestellung bis hin zurBezahlung, und dessen Abbildung im R/3 innerhalb der verschiedenen Module undKomponenten.4.1. Typischer Ablauf eines EinkaufsprozessesDie externe Beschaffung im MM-System basiert auf einem Zyklus generellerAktivitäten.Im einzelnen umfaßt der typische Beschaffungszyklus folgende Phasen:1. BedarfsermittlungDer Bedarf an Materialien entsteht entweder in den Fachabteilungen oder imRahmen der Disposition. Bei Materialien, die im Materialstamm definiert sind,kontrolliert das System den jeweiligen Meldebestand und ermittelt so dienachzubestellenden Materialien. Sie haben die Möglichkeit,Bestellanforderungen entweder selbst zu erfassen oder sie durch das Systemautomatisch erzeugen zu lassen.18 Technische Universität München, <strong>Lehrstuhl</strong> für <strong>Wirtschaftsinformatik</strong>