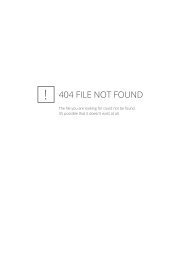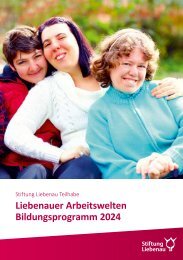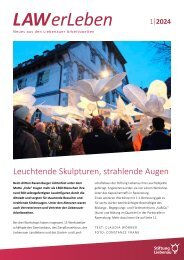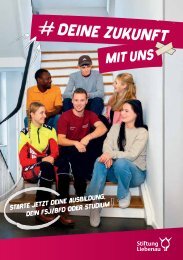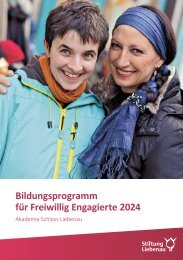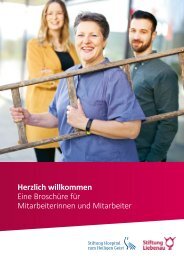Autonomie stärken - Eine Orientierung für Mitarbeiter-/innen (2013)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zwingen uns, eine Grundlegung der Ethik aus anderen Ansätzen heraus zu prüfen.<br />
1. Herkömmliche Dominanz des Merkmals „Vernunft“ <strong>für</strong> die Ethik<br />
Kant unterscheidet zwischen „vernunftlosen Wesen“, die „Sachen“ heißen und als<br />
Mittel „nur einen relativen Wert haben“, und „vernünftigen Wesen“, die „Personen<br />
genannt werden, weil ihre Natur sie schon als Zwecke an sich selbst (…) auszeichnet“.<br />
Damit gibt er eine Grundlegung der Moral vor, die jedoch bei näherer Betrachtung<br />
nicht hinreicht. Zum einen, weil der Status der Tiere so nicht eindeutig geklärt werden<br />
kann, zum andern, weil der Status der Person bei strenger Auslegung Kleinkindern,<br />
geistig behinderten oder dementen Menschen nicht zukommt. Zwar hat Kant<br />
sie dennoch in seine Ethik integriert aus der Überzeugung heraus, dass mit dem<br />
Menschsein das Personsein gegeben sei. Doch zeigt die inzwischen heftig entbrannte<br />
Diskussion um die Frage, ob der Personstatus eines Lebewesens sich allein auf den<br />
Vernunftbesitz gründe, die Gefahr einer Engführung. Als Beispiel einer solchen Engführung<br />
lässt sich die Argumentation des australisch-amerikanischen Ethikers Peter<br />
Singer anführen. „Personen“ sind <strong>für</strong> Singer nur Lebewesen, die aktuell Rationalität<br />
und Selbstbewusstsein besitzen. Und nur diese dürfen, weil sie Präferenzen äußern<br />
können, nicht getötet werden.<br />
Den Besitz der Vernunft (Rationalität, Selbstbewusstsein) als dominantes Merkmal des<br />
Menschseins zu bezeichnen und mit <strong>Autonomie</strong> zu identifizieren, wie es Singer tut,<br />
hat eine lange Tradition. Die Formel vom Menschen als „animal rationale“ (Lebewesen,<br />
das mit Vernunft begabt ist) ist eine der ältesten und zugleich wirkmächtigsten<br />
Bestimmungen des Menschseins. Sie geht schon auf die klassische griechische Philosophie<br />
zurück. Allerdings findet sich bei Aristoteles als Charakteristik des Menschen<br />
neben dem Prädikat „zoon logon echon“ (Lebewesen, das Vernunft besitzt) gleichrangig<br />
und im selben Atemzug das Prädikat „zoon politikon“ (Lebewesen, das gesellschaftlich<br />
lebt). Man kann daraus folgern, dass wesentlich <strong>für</strong> den Menschen neben<br />
der Vernunft auch das Soziale ist, das „In der Gemeinschaft leben“, noch allgemeiner:<br />
das „In Beziehungen leben“.<br />
2. Der Ansatz beim „dialogischen Prinzip“ (Martin Buber)<br />
In den philosophischen Strömungen des 20. Jahrhunderts kam es zu Neuansätzen, die<br />
auch <strong>für</strong> die Ethik den Akzent auf das „Leben in Beziehung“ setzten. Hier ist zunächst<br />
der 1878 in Wien geborene, 1938 nach Jerusalem emigrierte und 1965 dort gestorbene<br />
jüdische Philosoph Martin Buber zu nennen. Von Kant und Nietzsche beeinflusst,<br />
sieht er sich im Gegensatz zu Descartes, dessen Ausgang vom „Ich“ die Welt als<br />
Subjekt-Objekt-Verhältnis deutet.<br />
Im Zentrum von Bubers philosophischem Denken steht hingegen die Wirklichkeit der<br />
Beziehung zum anderen Menschen, kurz: „das Zwischenmenschliche“ oder „das Dialogische“.<br />
„Nicht durch ein Verhältnis zu seinem Selbst, sondern nur durch ein Verhältnis<br />
zu einem anderen Selbst kann der Mensch ganz werden“, sagt Buber. „Dieses andere<br />
Selbst mag ebenso begrenzt und bedingt sein wie er, im Miteinander wird Unbegrenztes<br />
und Unbedingtes erfahren.“<br />
Bubers philosophisches Hauptwerk „Ich und Du“ entfaltet diese Grundlinien <strong>für</strong> das<br />
„Verhältnis des Zwischen“. Gleich zu Beginn werden hier zwei „Grundworte“ unterschieden,<br />
die der Menschen sprechen kann: „Ich - Du“ und „Ich - Es“. Sie benennen<br />
die beiden Grundhaltungen des Menschen gegenüber der Welt. Dabei bezeichnet<br />
das Grundwort „Ich - Du“ eine „Beziehung“, das Grundwort „Ich - Es“ hingegen ein<br />
„Verhältnis“. Die Beziehung von Ich und Du meint den Punkt, an dem sich zwei Menschen<br />
wirklich begegnen. Dieser Gedanke ist der Hauptaspekt von Bubers Schaffen.<br />
Der Mensch ist auf ein Du hin ausgerichtet und kann erst in der Begegnung mit dem<br />
Gegenüber zu sich selbst, zum Ich, finden: „Der Mensch wird am Du zum Ich.“<br />
<strong>Autonomie</strong> erwächst also <strong>für</strong> Buber – anders als <strong>für</strong> Kant – nicht nur aus der Vernunft,<br />
sondern auch aus der Vertrauensbeziehung. Ohne Zweifel ist die <strong>Autonomie</strong>,<br />
die ein Mensch gewinnt, oft bewirkt durch das Vertrauen, das er zu Anderen hat und<br />
das Andere zu ihm haben. <strong>Autonomie</strong> ist nicht nur bedingt dadurch, dass wir uns von<br />
der Vernunft leiten lassen, die den Anderen als Selbstzweck anerkennt; sie hängt<br />
auch ab von Beziehungsstärke und Ichstärke, von der Wertschätzung der Anderen<br />
und vom Selbstwertgefühl, vom Vertrauen in Andere und vom Selbstvertrauen. Dies<br />
22 23