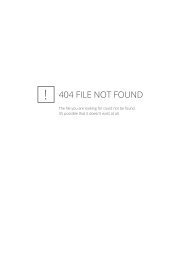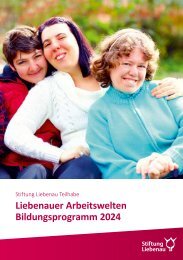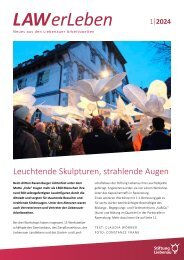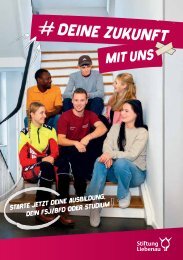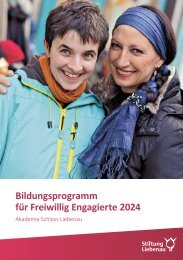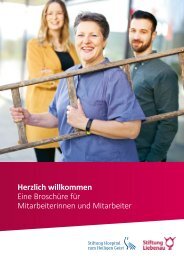Autonomie stärken - Eine Orientierung für Mitarbeiter-/innen (2013)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
den Wohnbereich wurde angegangen. Die epileptischen Anfälle von Herrn U. konnten<br />
durch Veränderung der Medikamente auf etwa einen Anfall im Monat verringert<br />
werden. Die Umstellung der Medikation erstreckte sich über mehrere Wochen. Herr<br />
U. wurde vom Arzt ausführlich belehrt, welche Gefahren bestehen, wenn er keinen<br />
Schutzhelm trägt, und was ihm passieren kann.<br />
Im Verlauf eines Jahres fanden mehrere Gespräche von Seiten des Sozialdienstes<br />
und der Fachkräfte <strong>für</strong> Arbeits- und Berufsförderung (FAB) mit Herrn U. statt, um<br />
herauszufinden, warum er strikt das Tragen eines Helmes ablehnt. Ihm wurde gesagt,<br />
dass er den Arbeitsplatz wechseln dürfe, wenn er den Schutzhelm trage. Auch die<br />
gesetzliche Betreuung hat <strong>für</strong> diesen Fall ihre Zustimmung angekündigt.<br />
Nach vielen Gesprächen stellte sich unter anderem heraus, dass Herr U. sehr große<br />
Angst davor hat, mit einem Helm auf dem Kopf von Anderen ausgelacht und beschimpft<br />
zu werden. Hier konnte dann angesetzt werden. Durch Information und Gespräche<br />
mit ihm und seinem Arbeitsumfeld konnte ihm die Angst vor dem Tragen des<br />
Schutzhelmes genommen werden.<br />
Es wurden interne Schutzmaßnahmen getroffen, die am Arbeitsplatz <strong>für</strong> Herrn U.<br />
berücksichtigt werden. So sitzt z.B. Herr U. im Lkw nicht neben dem Fahrer, sondern<br />
am Fensterplatz, damit er bei einem Anfall während der Fahrt nicht ins Lenkrad fällt;<br />
die Fahrer wurden im Umgang mit Epilepsie geschult etc.<br />
Die gesetzliche Betreuung von Herrn U. wurde informiert und ist nun mit dem Arbeitsplatzwechsel<br />
einverstanden.<br />
Meinungsbild in der Ethikkommission:<br />
Welche objektiven Entscheidungsverfahren sind dem Fall angemessen?<br />
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, den Sachverhalt aus den verschiedenen Perspektiven<br />
der am Fall Beteiligten zu bedenken. Dieser Reflexionsprozess scheint wichtig und<br />
zentral. Wichtig war auch die Entscheidung, zu konkreten Vereinbarungen und Verpflichtungen<br />
<strong>für</strong> den betroffenen Menschen mit Behinderung zu gelangen. Ebenso<br />
wichtig war die Kontrollfrage, ob alle Chancen <strong>für</strong> ein eigenverantwortliches Handeln<br />
des Betroffenen genutzt wurden.<br />
(9) Sonjas Eltern wollen, dass sie sterben darf<br />
Ausgangssituation:<br />
Die einjährige Sonja (Name geändert) wird ins Kinderhospiz verlegt. Nach Geburtskomplikationen<br />
mit Sauerstoffmangel war es zu einer schwersten Hirnschädigung<br />
gekommen. Das Kind atmet selbständig, es wird vollständig über eine Magensonde<br />
ernährt, zeigt keinerlei Reaktionen und erfüllt letztendlich die Kriterien der irreversiblen<br />
Bewusstlosigkeit. Die Eltern erwarten das komplette Absetzen der künstlichen<br />
Ernährung im Kinderhospiz und wünschen, dass „ihr Kind endlich sterben darf“.<br />
Das Dilemma:<br />
Bei diesem extremen Fall weicht <strong>Autonomie</strong> gänzlich totaler Fremdbestimmung. Das<br />
Kind konnte sich selbst nie äußern, die Eltern sind als Verantwortliche die alleinigen<br />
Ansprechpartner. Sie sind verpflichtet, ihre Entscheidung im Interesse des Kindswohls<br />
zu treffen.<br />
„Hirntod“ ist nach der Richtlinie der Bundesärztekammer strikt definiert – dem gegenüber<br />
ist „irreversible Bewusstlosigkeit“ etwas anderes. Ist irreversible Bewusstlosigkeit<br />
wirklich irreversibel? Irreversible Bewusstlosigkeit per se bedeutet nicht unbedingt<br />
lebensbegrenzt erkrankt. Erniedrigt nicht die unbedingte Lebenserhaltung den<br />
Betroffenen zum Objekt medizinischer und pflegerischer Kunstfertigkeit? Was dient<br />
dem Wohl des Patienten? Kann aus dem Grundrecht „Jeder Mensch hat ein Recht zu<br />
leben“ auch zwingend eine „Pflicht zu leben“ abgeleitet werden?<br />
Der Arzt steht zwischen der Pflicht, Leben zu erhalten, und der Pflicht, Leiden zu<br />
mindern, wobei die Schwere des Leidens hier nicht gemessen/objektiviert werden<br />
kann. Inwieweit darf das Wohl der Angehörigen in die Entscheidung einfließen? Aus<br />
juristischer Sicht sind Magensonde und künstliche Ernährung Eingriffe in die körperliche<br />
Integrität eines Menschen und bedürfen der Einwilligung. In der Regel beziehen<br />
sich gerichtliche Urteile und vergleichbare Fälle mit Absetzen der künstlichen Ernäh-<br />
50 51