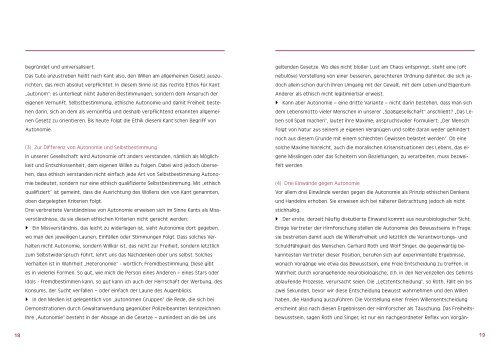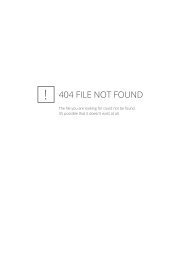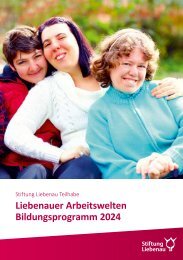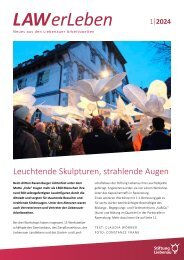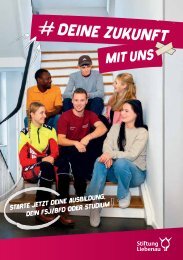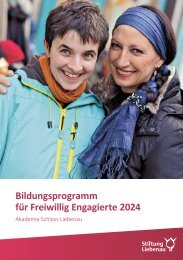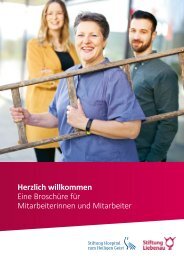Autonomie stärken - Eine Orientierung für Mitarbeiter-/innen (2013)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
egründet und universalisiert.<br />
Das Gute anzustreben heißt nach Kant also, den Willen am allgemeinen Gesetz auszurichten,<br />
das mich absolut verpflichtet. In diesem Sinne ist das rechte Ethos <strong>für</strong> Kant<br />
„autonom“: es unterliegt nicht äußeren Bestimmungen, sondern dem Anspruch der<br />
eigenen Vernunft. Selbstbestimmung, ethische <strong>Autonomie</strong> und damit Freiheit bestehen<br />
darin, sich an dem als vernünftig und deshalb verpflichtend erkannten allgemeinen<br />
Gesetz zu orientieren. Bis heute folgt die Ethik diesem Kant’schen Begriff von<br />
<strong>Autonomie</strong>.<br />
(3) Zur Differenz von <strong>Autonomie</strong> und Selbstbestimmung<br />
In unserer Gesellschaft wird <strong>Autonomie</strong> oft anders verstanden, nämlich als Möglichkeit<br />
und Entschlossenheit, dem eigenen Willen zu folgen. Dabei wird jedoch übersehen,<br />
dass ethisch verstanden nicht einfach jede Art von Selbstbestimmung <strong>Autonomie</strong><br />
bedeutet, sondern nur eine ethisch qualifizierte Selbstbestimmung. Mit „ethisch<br />
qualifiziert“ ist gemeint, dass die Ausrichtung des Wollens den von Kant genannten,<br />
oben dargelegten Kriterien folgt.<br />
Drei verbreitete Verständnisse von <strong>Autonomie</strong> erweisen sich im Sinne Kants als Missverständnisse,<br />
da sie diesen ethischen Kriterien nicht gerecht werden:<br />
Ein Missverständnis, das leicht zu widerlegen ist, sieht <strong>Autonomie</strong> dort gegeben,<br />
wo man den jeweiligen Launen, Einfällen oder Stimmungen folgt. Dass solches Verhalten<br />
nicht <strong>Autonomie</strong>, sondern Willkür ist, das nicht zur Freiheit, sondern letztlich<br />
zum Selbstwiderspruch führt, lehrt uns das Nachdenken über uns selbst. Solches<br />
Verhalten ist in Wahrheit „Heteronomie“ - wörtlich: Fremdbestimmung. Diese gibt<br />
es in vielerlei Formen. So gut, wie mich die Person eines Anderen – eines Stars oder<br />
Idols - fremdbestimmen kann, so gut kann ich auch der Herrschaft der Werbung, des<br />
Konsums, der Sucht verfallen – oder einfach der Laune des Augenblicks.<br />
In den Medien ist gelegentlich von „autonomen Gruppen“ die Rede, die sich bei<br />
Demonstrationen durch Gewaltanwendung gegenüber Polizeibeamten kennzeichnen.<br />
Ihre „<strong>Autonomie</strong>“ besteht in der Absage an die Gesetze – zumindest an die bei uns<br />
geltenden Gesetze. Wo dies nicht bloßer Lust am Chaos entspringt, steht eine (oft<br />
nebulöse) Vorstellung von einer besseren, gerechteren Ordnung dahinter, die sich jedoch<br />
allein schon durch ihren Umgang mit der Gewalt, mit dem Leben und Eigentum<br />
Anderer als ethisch nicht legitimierbar erweist.<br />
Kann aber <strong>Autonomie</strong> – eine dritte Variante – nicht darin bestehen, dass man sich<br />
dem Lebensmotto vieler Menschen in unserer „Spaßgesellschaft“ anschließt? „Das Leben<br />
soll Spaß machen“, lautet ihre Maxime; anspruchsvoller formuliert: „Der Mensch<br />
folgt von Natur aus seinem je eigenen Vergnügen und sollte daran weder gehindert<br />
noch aus diesem Grunde mit einem schlechten Gewissen belastet werden“. Ob eine<br />
solche Maxime hinreicht, auch die moralischen Krisensituationen des Lebens, das eigene<br />
Misslingen oder das Scheitern von Beziehungen, zu verarbeiten, muss bezweifelt<br />
werden.<br />
(4) Drei Einwände gegen <strong>Autonomie</strong><br />
Vor allem drei Einwände werden gegen die <strong>Autonomie</strong> als Prinzip ethischen Denkens<br />
und Handelns erhoben. Sie erweisen sich bei näherer Betrachtung jedoch als nicht<br />
stichhaltig.<br />
Der erste, derzeit häufig diskutierte Einwand kommt aus neurobiologischer Sicht.<br />
Einige Vertreter der Hirnforschung stellen die <strong>Autonomie</strong> des Bewusstseins in Frage;<br />
sie bestreiten damit auch die Willensfreiheit und letztlich die Verantwortungs- und<br />
Schuldfähigkeit des Menschen. Gerhard Roth und Wolf Singer, die gegenwärtig bekanntesten<br />
Vertreter dieser Position, berufen sich auf experimentelle Ergebnisse,<br />
wonach Vorgänge wie etwa das Bewusstsein, eine freie Entscheidung zu treffen, in<br />
Wahrheit durch vorangehende neurobiologische, d.h. in den Nervenzellen des Gehirns<br />
ablaufende Prozesse, verursacht seien. Die „Letztentscheidung“, so Roth, fällt ein bis<br />
zwei Sekunden, bevor wir diese Entscheidung bewusst wahrnehmen und den Willen<br />
haben, die Handlung auszuführen. Die Vorstellung einer freien Willensentscheidung<br />
erscheint also nach diesen Ergebnissen der Hirnforscher als Täuschung. Das Freiheitsbewusstsein,<br />
sagen Roth und Singer, ist nur ein nachgeordneter Reflex von Vorgän-<br />
18 19