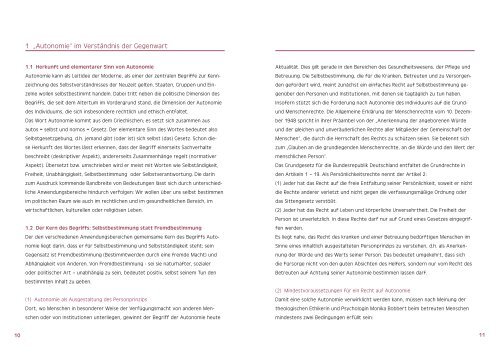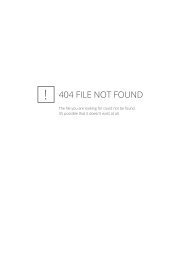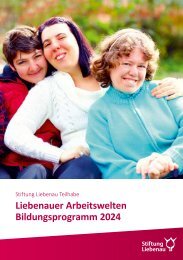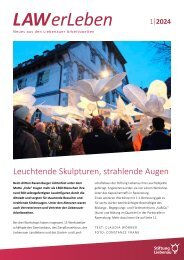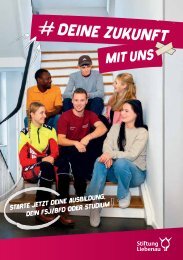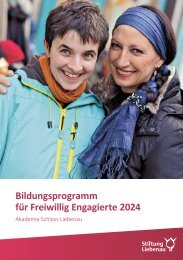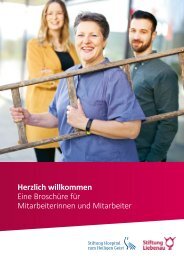Autonomie stärken - Eine Orientierung für Mitarbeiter-/innen (2013)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1 „<strong>Autonomie</strong>“ im Verständnis der Gegenwart<br />
1.1 Herkunft und elementarer Sinn von <strong>Autonomie</strong><br />
<strong>Autonomie</strong> kann als Leitidee der Moderne, als einer der zentralen Begriffe zur Kennzeichnung<br />
des Selbstverständnisses der Neuzeit gelten. Staaten, Gruppen und Einzelne<br />
wollen selbstbestimmt handeln. Dabei tritt neben die politische Dimension des<br />
Begriffs, die seit dem Altertum im Vordergrund stand, die Dimension der <strong>Autonomie</strong><br />
des Individuums, die sich insbesondere rechtlich und ethisch entfaltet.<br />
Das Wort <strong>Autonomie</strong> kommt aus dem Griechischen; es setzt sich zusammen aus<br />
autos = selbst und nomos = Gesetz. Der elementare Sinn des Wortes bedeutet also<br />
Selbstgesetzgebung, d.h. jemand gibt (oder ist) sich selbst (das) Gesetz. Schon diese<br />
Herkunft des Wortes lässt erkennen, dass der Begriff einerseits Sachverhalte<br />
beschreibt (deskriptiver Aspekt), andererseits Zusammenhänge regelt (normativer<br />
Aspekt). Übersetzt bzw. umschrieben wird er meist mit Worten wie Selbständigkeit,<br />
Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung oder Selbstverantwortung. Die darin<br />
zum Ausdruck kommende Bandbreite von Bedeutungen lässt sich durch unterschiedliche<br />
Anwendungsbereiche hindurch verfolgen: Wir wollen über uns selbst bestimmen<br />
im politischen Raum wie auch im rechtlichen und im gesundheitlichen Bereich, im<br />
wirtschaftlichen, kulturellen oder religiösen Leben.<br />
1.2 Der Kern des Begriffs: Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung<br />
Der den verschiedenen Anwendungsbereichen gemeinsame Kern des Begriffs <strong>Autonomie</strong><br />
liegt darin, dass er <strong>für</strong> Selbstbestimmung und Selbstständigkeit steht; sein<br />
Gegensatz ist Fremdbestimmung (Bestimmtwerden durch eine fremde Macht) und<br />
Abhängigkeit von Anderen. Von Fremdbestimmung - sei sie naturhafter, sozialer<br />
oder politischer Art – unabhängig zu sein, bedeutet positiv, selbst seinem Tun den<br />
bestimmten Inhalt zu geben.<br />
(1) <strong>Autonomie</strong> als Ausgestaltung des Personprinzips<br />
Dort, wo Menschen in besonderer Weise der Verfügungsmacht von anderen Menschen<br />
oder von Institutionen unterliegen, gewinnt der Begriff der <strong>Autonomie</strong> heute<br />
Aktualität. Dies gilt gerade in den Bereichen des Gesundheitswesens, der Pflege und<br />
Betreuung. Die Selbstbestimmung, die <strong>für</strong> die Kranken, Betreuten und zu Versorgenden<br />
gefordert wird, meint zunächst ein einfaches Recht auf Selbstbestimmung gegenüber<br />
den Personen und Institutionen, mit denen sie tagtäglich zu tun haben.<br />
Insofern stützt sich die Forderung nach <strong>Autonomie</strong> des Individuums auf die Grundund<br />
Menschenrechte. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember<br />
1948 spricht in ihrer Präambel von der „Anerkennung der angeborenen Würde<br />
und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der<br />
Menschen“, die durch die Herrschaft des Rechts zu schützen seien. Sie bekennt sich<br />
zum „Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der<br />
menschlichen Person“.<br />
Das Grundgesetz <strong>für</strong> die Bundesrepublik Deutschland entfaltet die Grundrechte in<br />
den Artikeln 1 – 19. Als Persönlichkeitsrechte nennt der Artikel 2:<br />
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht<br />
die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder<br />
das Sittengesetz verstößt.<br />
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der<br />
Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen<br />
werden.<br />
Es liegt nahe, das Recht des kranken und einer Betreuung bedürftigen Menschen im<br />
Sinne eines inhaltlich ausgestalteten Personprinzips zu verstehen, d.h. als Anerkennung<br />
der Würde und des Werts seiner Person. Das bedeutet umgekehrt, dass sich<br />
die Fürsorge nicht von den guten Absichten des Helfers, sondern nur vom Recht des<br />
Betreuten auf Achtung seiner <strong>Autonomie</strong> bestimmen lassen darf.<br />
(2) Mindestvoraussetzungen <strong>für</strong> ein Recht auf <strong>Autonomie</strong><br />
Damit eine solche <strong>Autonomie</strong> verwirklicht werden kann, müssen nach Meinung der<br />
theologischen Ethikerin und Psychologin Monika Bobbert beim betreuten Menschen<br />
mindestens zwei Bedingungen erfüllt sein:<br />
10 11