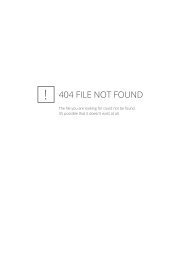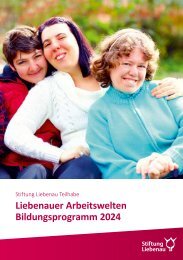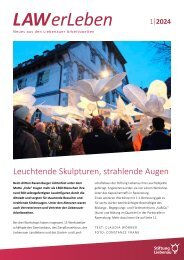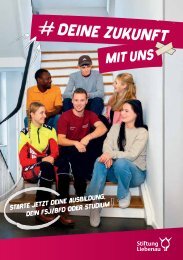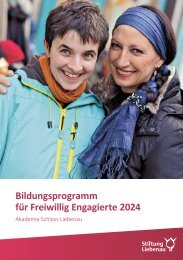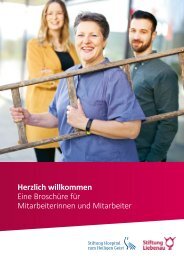Autonomie stärken - Eine Orientierung für Mitarbeiter-/innen (2013)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
dern auch darum, eine Willensbildung zu ermöglichen über Sachverhalte, die den<br />
Betreuten zum großen Teil fremd sind, muss die Asymmetrie zwischen Betreuten und<br />
Helfern soweit wie möglich verringert werden. Monika Bobbert spricht von „vier großen<br />
Asymmetrien“, die die Situation im Krankenhaus kennzeichnen, die aber unseres<br />
Erachtens wohl ebenso <strong>für</strong> den Pflege- und Betreuungsbereich gelten:<br />
1. Die professionellen Helfer haben einen fachlichen Wissensvorsprung gegenüber<br />
den Betreuten<br />
2. Sie bewegen sich innerhalb der Institution in einer ihnen vertrauten Rolle, die<br />
ihnen Sicherheit gibt<br />
3. Sie leiden im Unterschied zu denen, die sie betreuen, nicht unter gesundheitlichen<br />
Beeinträchtigungen<br />
4. Sie stehen nicht in Abhängigkeit von den Betreuten und unterliegen damit<br />
nicht dem Druck, deren Erwartungen zu entsprechen.<br />
Um die <strong>Autonomie</strong> der betreuten Menschen zu fördern, ist es notwendig, diese<br />
Asymmetrien abzubauen bzw. dort, wo sie nicht verringert werden können, zumindest<br />
bewusst mit ihnen umzugehen.<br />
(2) Ethische Urteilskompetenz gew<strong>innen</strong><br />
Die Fallbeispiele haben gezeigt, dass in oft schwierigen Situationen Entscheidungen<br />
getroffen werden mussten. Das verlangt von den Betreuer<strong>innen</strong> die Fähigkeit einer<br />
sorgfältigen Wahrnehmung und Beobachtung sowohl der Klienten als auch der eigenen<br />
Verhaltensweisen im Konfliktfall. Notwendig ist auch die Kompetenz zur Analyse<br />
der Zusammenhänge, in denen <strong>Autonomie</strong> gefährdet ist bzw. gefördert werden kann.<br />
Ebenso wichtig ist die <strong>Orientierung</strong> der <strong>Mitarbeiter</strong> an Leitwerten, die dem Professionsethos<br />
und dem Leitbild der Betreuungsorganisation entsprechen. Erforderlich<br />
ist die Fähigkeit, in Verhaltensalternativen angesichts von <strong>Autonomie</strong>wünschen zu<br />
denken. Zudem ist es bei dilemmatischen Situationen notwendig, dass Entscheidungen<br />
klar, transparent und nachvollziehbar begründet werden. Zur Professionalität<br />
ethischer Urteilskompetenz zählt schließlich die Überprüfung der gefällten Entscheidung<br />
und deren eventuelle Revision oder Abänderung, wenn das Ziel einer gestärkten<br />
<strong>Autonomie</strong> nicht (mehr) erreichbar scheint.<br />
(3) In Beratung mit dem Betroffenen und seinem Umfeld entscheiden<br />
In allen Fallbeispielen ist auch deutlich geworden, dass es keine einsamen Entscheidungen<br />
von professionellen Helfern über die <strong>Autonomie</strong>chancen der Betroffenen<br />
geben darf. Entscheidungen in brisanten Situationen bedürfen der Einbeziehung des<br />
Betroffenen oder eines Stellvertreters, der die (mutmaßlichen) Anliegen des nicht<br />
(mehr) entscheidungsfähigen Betreuten vertritt. Bewährt hat sich auch das Prinzip<br />
der Interdisziplinarität, weil verschiedene Fachperspektiven den Fall in seiner Vielschichtigkeit<br />
offen legen und die Kreativität in der Lösungsfindung befördern. Das<br />
hat zwar den Nachteil einer zeitlichen Verzögerung in der Entscheidungsfindung,<br />
macht aber gemeinsam gefundene Lösungen tragfähiger. Je nach Situation ist es<br />
auch hilfreich, wenn das verwandtschaftliche und soziale Umfeld in die Entscheidungsbildung<br />
integriert wird. Auch dieser Schritt kann „lästig“ sein, birgt aber den<br />
Vorteil, dass die Ressourcen des Umfelds in die Lösungssuche produktiv eingebracht<br />
werden können.<br />
(4) Mit der „zweitbesten Lösung“ leben lernen<br />
In den Fallbeispielen wurde erkennbar, dass selten „glatte“ und ideale Lösungen<br />
gefunden werden konnten. Immer musste zwischen den verschiedenen Ansprüchen<br />
ein tragfähiger Kompromiss gefunden werden. In der Regel kann sich bei der Auflösung<br />
von dilemmatischen Situationen nicht eine Seite allein durchsetzen. Es bedarf<br />
also auch des Mutes, zu so genannten „zweitbesten Lösungen“ zu stehen. Oft ist<br />
eine „möglichst gute“, aber praktikable Lösung besser als die optimale, die sich in der<br />
Praxis als nicht realisierbar erweist.<br />
62 63