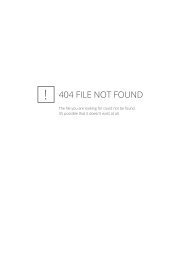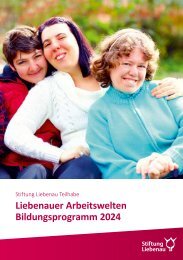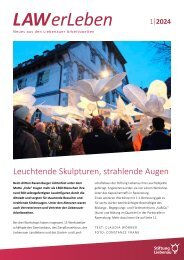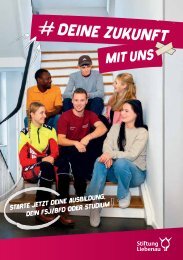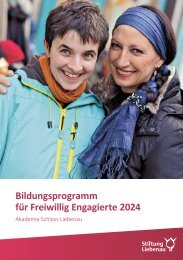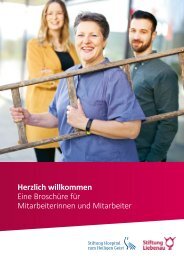Autonomie stärken - Eine Orientierung für Mitarbeiter-/innen (2013)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sie). In manchen Fällen kann Mitleid ein legitimes Motiv sein, aber in vielen Fällen ist<br />
es das nicht. Das Mitleid ist zweideutig, weil der, der Hilfe leistet, seine Hilfe nicht vor<br />
der Vernunft begründet.<br />
<strong>Eine</strong> weitere Legitimation <strong>für</strong> die Einschränkung von Grundrechten wäre ein „aufgeklärter<br />
Paternalismus“, wie ihn der Sozialphilosoph John Rawls beschrieben hat. Er<br />
hält bevormundende Eingriffe in die Grundrechte sittlich nur dann <strong>für</strong> gerechtfertigt,<br />
wenn Menschen vor der Schwäche und dem Versagen ihrer Vernunft geschützt<br />
werden sollen. Nur die Gerechtigkeit und die Kenntnis der längerfristigen Bedürfnisse<br />
der Betroffenen kann also ein solches Eingreifen rechtfertigen. Mit der Beachtung<br />
dieser Kriterien ist letztlich die Menschenwürde der Beteiligten gesichert. Intervenieren<br />
gegen den Willen des Betroffenen darf man also nur, wenn der Maßstab der<br />
Menschenwürde gewahrt bleibt.<br />
Ein weiterer, ethisch legitimer Grund <strong>für</strong> Intervention gegen oder ohne den Willen<br />
des Betroffenen ist die Integrität des Menschen. Sind die Verhaltensweisen des Betroffenen<br />
derart, dass sie ihn selbst oder sein Umfeld schwer gefährden, ist ein freiheitseinschränkender<br />
Eingriff erlaubt oder sogar geboten. Um aber dem Manipulations-<br />
oder Unterdrückungsverdacht zu entgehen, muss dieser richterlich genehmigt<br />
sein. Als ethischer Maßstab hinter diesem Argument steht die unbedingte Akzeptanz<br />
der Person. Diese kann philosophisch-ethisch hergeleitet werden, sie ist aber auch<br />
theologisch mit der Gottesebenbildlichkeit begründbar. Die Achtung vor jeder Person<br />
gebietet also einen äußerst umsichtigen Umgang mit dem Eingreifen in die persönlichen<br />
Rechte eines Anderen. <strong>Eine</strong> aus der Personalität des Menschen abgeleitete<br />
Ethik der Anerkennung und der Achtsamkeit setzt damit auch die Maßstäbe <strong>für</strong> die<br />
Grenzen der Eingriffe in das selbstbestimmte Leben von Menschen mit geistiger Behinderung<br />
oder Menschen, die teilweise oder gar nicht mehr über ihr Leben souverän<br />
verfügen können.<br />
(3) Die Aufgaben von Sozialunternehmen zur Stärkung der <strong>Autonomie</strong><br />
Probleme mit der Achtung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen<br />
tauchen besonders dann auf, wenn sekundäre Abhängigkeiten zu den ohnehin schon<br />
vorhandenen Erfahrungen von Begrenztheit hinzukommen. Oft ist dies dann der Fall,<br />
wenn Menschen mit Behinderungen oder anderen Einschränkungen in einem professionellen<br />
und institutionellen Kontext betreut werden. Neben dem Versorgungs- und<br />
Betreuungsauftrag neigen soziale Einrichtungen nicht selten zu kolonisierenden Verhaltensweisen,<br />
die Menschen mit Behinderungen zusätzliche Abhängigkeitsprobleme<br />
verschaffen. Auch die Aktionen der professionellen Helfer sind nicht immer auf eine<br />
die Selbstbestimmung fördernde Interventionsstruktur aus. Menschen, die in Kontakt<br />
mit Hilfeeinrichtungen kommen, sehen sich einer spezifischen Zweischneidigkeit ausgesetzt:<br />
Der Schutz- und Schonrahmen gewährleistet – gerade den Schwächsten<br />
– einen sicheren und sichernden Lebensrahmen, stationäre Lebenswelten sind die<br />
Chance <strong>für</strong> Menschen, die genau diesen Rahmen brauchen. Dabei kann in der Regel<br />
bei Menschen mit Behinderungen nur in eingeschränktem Umfang von einer freiwilligen<br />
Entscheidung <strong>für</strong> ein Leben im stationären Kontext die Rede sein. Weil dem so ist,<br />
benötigen soziale Einrichtungen und ihre professionellen Helfer Strukturen, Reflexionsebenen<br />
und gegebenenfalls auch Qualitätskontrollen, damit sichergestellt ist, dass<br />
Menschen mit Behinderungen und ihre Stellvertretungen eine Chance haben, dass<br />
ihre Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte so weit wie möglich gewahrt bleiben.<br />
Dies gilt insbesondere in solchen Grenzfällen, die häufig durch selbst- und fremdschädigendes<br />
Verhalten auffallen. In jedem einzelnen Fall gilt es auch kritisch zu überprüfen,<br />
inwieweit das Verhalten von <strong>Mitarbeiter</strong>n oder die Strukturen der Einrichtung<br />
ursächlich zu diesem schädigendem Verhalten beigetragen haben. Wenn dies gelingt,<br />
leisten Einrichtungen und ihre <strong>Mitarbeiter</strong> einen wichtigen Beitrag zu einer Kultur der<br />
Anerkennung beschädigten Lebens. Sie dienen damit zugleich der Humanisierung des<br />
Gemeinwesens, das sich häufig zu seiner Entlastung von Menschen verabschiedet und<br />
seine Verantwortung an die Hilfeeinrichtungen delegiert hat. Soziale Einrichtungen<br />
leisten zudem durch einen sensiblen, ethisch reflektierten Umgang mit Menschen,<br />
die unter starken Willenseinschränkungen leiden, einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe<br />
dieser Menschen am gesellschaftlichen Leben.<br />
30 31