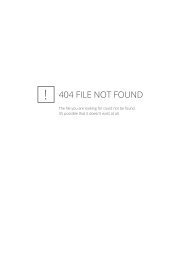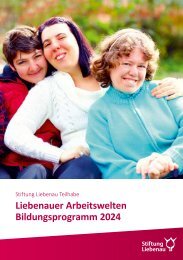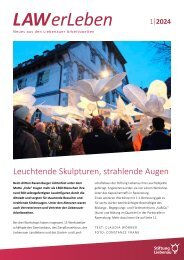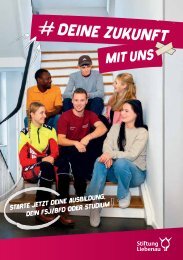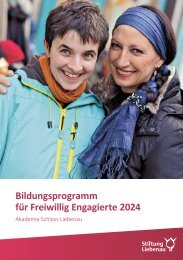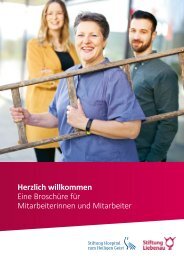Autonomie stärken - Eine Orientierung für Mitarbeiter-/innen (2013)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
griffs nicht Voraussetzung <strong>für</strong> Selbstbestimmung und <strong>Autonomie</strong>. Deshalb wird hier<br />
(mit Ausnahme der Irrtumslehre in § 119 ff BGB) nicht nach den Bedingungen der<br />
Möglichkeit moralischen Handelns gefragt.<br />
Folgendes Beispiel möge dies verdeutlichen: <strong>Eine</strong> Ehefrau verbürgt sich gegenüber<br />
der Bank ihres Mannes zur Sicherung eines ihm gewährten Darlehens, obwohl sie als<br />
Hausfrau und Mutter zweier Kinder im Zeitpunkt der Bürgschaftsübernahme ohne<br />
Einkommen und Vermögen ist und auch später nach Aufnahme einer zumutbaren<br />
Erwerbstätigkeit nie in der Lage sein wird, sich von der real gewordenen Bürgschaftsschuld<br />
zu befreien. Wenn die Bank nicht zur Übernahme der Bürgschaft gedrängt<br />
oder auf andere Weise die Entscheidungsfreiheit der Frau beeinträchtigt hat,<br />
Auskunftspflichten nicht verletzt und das Haftungsrisiko nicht beschönigt hat, hat<br />
die Frau autonom „aus rechtlicher Perspektive“ gehandelt. Ob sie allerdings, weil sie<br />
sich aus – von ihr möglicherweise missverstandenen – religiösen oder moralischen<br />
Beweggründen veranlasst sah, die Erklärung gegenüber der Bank abzugeben, dem<br />
kategorischen Imperativ von Kant folgend „ethisch qualifiziert“ selbstbestimmt gehandelt<br />
hat, mag die ethische Sicht des <strong>Autonomie</strong>begriffs beantworten. Dieser wird<br />
es möglicherweise gelingen, die Frage nach dem „ethisch qualifiziert selbstbestimmten“<br />
Handeln zu beantworten, wenn die einzelnen Beweggründe (Hilfestellung <strong>für</strong><br />
den Ehepartner, Verantwortung <strong>für</strong> die übrigen Familienmitglieder u.a.m.) <strong>für</strong> das<br />
vormalige Tun (Übernahme der Bürgschaft <strong>für</strong> den Mann) abgewogen werden.<br />
Moral und Recht sind zwar begrifflich und vor allem im Bezugspunkt zu trennen;<br />
zwischen beiden besteht aber dennoch eine Beziehung. Denn Recht lässt sich nach<br />
dem Verständnis des Grundgesetzes in weiten Bereichen nicht ohne jeden Bezug auf<br />
sog. „überpositive Rechtsgrundsätze“ definieren. Das Grundgesetz vollzieht hier eine<br />
bewusste Abkehr vom Rechtspositivismus, d.h. die Geltung von Rechtsnormen ist<br />
nicht allein darauf zurückzuführen, dass sie von einer rechtsetzenden Institution erlassen<br />
wurden. Während sich aber die Moral an die Gesinnung des Menschen richtet,<br />
bezieht sich das Recht auf das äußere Verhalten des Menschen und knüpft an dieses<br />
an. Besonders deutlich wird dies an der Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag<br />
nach den §§ 211 und 212 des Strafgesetzbuchs sowie an der Begründung <strong>für</strong> die<br />
Strafbarkeit des Versuchs.<br />
Das Recht unterscheidet sich von der Moral auch durch die Art, wie es Geltung fordert<br />
und in einem normierten Verfahren durch von der Gemeinschaft autorisierte<br />
Organe zwangsweise durchgesetzt wird. Moralisches Verhalten ist in der Gemeinschaft<br />
nur erzwingbar, soweit es durch das Recht gefordert wird. Es ist zudem in der<br />
Regel auch nur mittelbar zu erzwingen durch das Aussetzen von Sanktionen <strong>für</strong> den<br />
Fall „unmoralischen“ Verhaltens. In diesem Zusammenhang ist dann als „Recht“ nicht<br />
nur die Gesamtheit der von rechtsetzenden Institutionen geschaffenen Rechtsregeln<br />
anzusehen, sondern auch der Vertrag, der – wie beispielsweise derjenige zwischen<br />
Patient oder betreuter Person und beschützender Einrichtung – zwischen natürlichen<br />
und auch juristischen Personen geschlossen wird und der sowohl Verhaltensmaßregeln<br />
als auch Sanktionen vorsehen kann.<br />
Recht entstammt auch oft moralischen und ethischen Bewertungen, benötigt diese<br />
aber nicht immer. Ob sich das gesetzgebende Organ einer Gemeinschaft dazu entschließt,<br />
im Straßenverkehr den Rechts- oder Linksverkehr einzuführen, unterliegt<br />
keiner Wertung nach ethischen oder moralischen Gesichtspunkten. Inwieweit der<br />
staatliche Gesetzgeber überpositiven Rechtsgrundsätzen (abgeleitet aus den Zehn<br />
Geboten oder aus anderen Quellen) beispielsweise durch die Strafgesetzgebung Geltung<br />
verschafft, ist jedoch Ergebnis einer ethischen Bewertung.<br />
Weitere Beispiele mögen die unterschiedlichen Sichtweisen offen legen:<br />
1. Der aus der Ehe ausbrechende Ehepartner verstößt weder mit dem gedachten<br />
noch mit dem versuchten noch mit dem vollendeten Ehebruch gegen weltliche<br />
Rechtsregeln und handelt aus rechtlicher Perspektive auch autonom, weil nicht<br />
fremd bestimmt. Das moralische und ethische Verdikt - auch im Sinne des<br />
Kant’schen Ethikbegriffs - liegt allerdings nahe, zumal wenn die Auswirkungen auf<br />
andere Familienmitglieder, insbesondere Kinder, in die Bewertung mit einbezogen<br />
werden.<br />
14 15