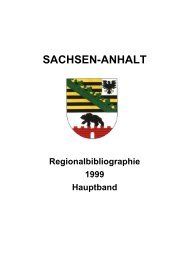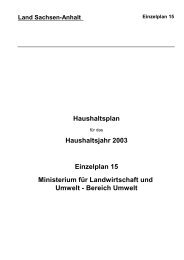Kultur- Reportage: 35 mm Kontrovers: siche- - Martin-Luther ...
Kultur- Reportage: 35 mm Kontrovers: siche- - Martin-Luther ...
Kultur- Reportage: 35 mm Kontrovers: siche- - Martin-Luther ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mit dem Lichtschwert durchs Labyrinth<br />
Die Habilitation ist ein bedeutender Schritt in der Laufbahn eines jeden Wissenschaftlers. Am<br />
16. Juli 2008 hat Privatdozentin (PD) Dr. Kathrin Fahlenbrach diese akademische Hürde ge-<br />
no<strong>mm</strong>en und ihre Habilitationsschrift über „Audiovisuelle Metaphern“ erfolgreich verteidigt.<br />
Von Nicole Trodler<br />
Die Redaktion hat sich die Ergebnisse ihrer Forschung genauer angeschaut.<br />
eim Blick auf Dr. Fahlenbrachs Publikationen lässt sich<br />
relativ schnell eine gewisse Präferenz in ihrer Forschung<br />
identifizieren: Ein wiederkehrendes Element ist<br />
die Frage nach der emotionalen Wirkung von Medien.<br />
Bereits in ihrer Doktorarbeit hatte sie sich mit der medialen Repräsentation<br />
und<br />
Erzeugung von<br />
Emotionen auseinandergesetzt.<br />
Hier ging es noch<br />
um rein visuelle<br />
Medien, nämlich<br />
um die Bedeutung<br />
von Codes<br />
und Symbolen für<br />
das Schaffen eines<br />
PD Dr. Kathrin Fahlenbrach nach<br />
ihrer erfolgreichen Verteidigung<br />
Zusa<strong>mm</strong>engehörigkeitsgefühls<br />
in<br />
Protestbewegungen.<br />
Schon bald<br />
allerdings begann<br />
die heute 42-Jährige sich auch mit audiovisuellen Medien zu<br />
beschäftigen.<br />
Was genau sind Emotionen und wie lösen audiovisuelle Medien<br />
Emotionen aus? Diesen Fragen ging sie zusa<strong>mm</strong>en mit Anne<br />
Bartsch vom MuK-Department und Jens Eder von der Universität<br />
Hamburg in einem langjährigen Forschungsprojekt nach.<br />
Parallel zu diesem Projekt und zu ihrer Lehrtätigkeit am Department<br />
arbeitete Dr. Fahlenbrach in den vergangenen sechs<br />
Jahren auch an ihrem ganz eigenen Ansatz zur Analyse audiovisueller<br />
Medien. Als Ergebnis liegt nun ihre Habilitationsschrift<br />
vor: „Audiovisuelle Metaphern. Zur Körper- und Affektästhetik<br />
in Film und Fernsehen“.<br />
Die Arbeit baut auf der Theorie kognitiver Metaphern von<br />
Lakoff und Johnson auf. Diese besagt, dass das menschliche<br />
Denken, Fühlen und Handeln in großem Maße durch Metaphern<br />
geprägt ist. Dies offenbart sich im Metaphernreichtum<br />
der Sprache und wird besonders deutlich, wenn es um die<br />
Ko<strong>mm</strong>unikation von Emotionen geht. Da kann es vorko<strong>mm</strong>en,<br />
dass jemand vor Wut platzt, vor Freude überschäumt oder in<br />
Tränen versinkt. Metaphern ermöglichen es also, etwas indirekt<br />
zu beschreiben, was auf direktem Wege nicht so wirkungsvoll<br />
ausgedrückt werden kann.<br />
Durch audiovisuelle Medien(angebote), wie Film, Fernsehen,<br />
Werbung oder Musikvideo, sollen bevorzugt die Emotionen des<br />
Publikums angesprochen werden. Um etwa Fernsehzuschauer<br />
durch möglichst intensive Medienerlebnisse vor dem Bildschirm<br />
zu halten, verfolgen die Macher besti<strong>mm</strong>te Gestaltungsstrategien.<br />
Mithilfe des Modells audiovisueller Metaphern soll nun<br />
die Beschreibung dieser Strategien und deren Wirkung auf den<br />
Zuschauer erleichtert werden. Dr. Fahlenbrach zeigt, wie filmische<br />
Gestaltungsmuster bereits auf körperlicher und emotionaler<br />
Ebene wirken, da audiovisuelle Medien wie Film und Fernsehen<br />
auf körperliche Strukturen der Wahrnehmung und der<br />
Erfahrung zurückgreifen. Die filmischen Stilmittel beeinflussen<br />
den Zuschauer unmittelbar und unbewusst, er muss sie also<br />
nicht erst rational interpretieren, um etwas zu empfinden.<br />
Es stellt sich nun die Frage, was audiovisuelle Metaphern konkret<br />
sind. Ein gutes Beispiel ist das Labyrinth-Motiv in Stanley<br />
Kubricks „Shining“. Es steht im übertragenen Sinne für die<br />
Angst und das wachsende Gefühl der Bedrohung, das die Protagonisten<br />
Wendy und Danny erfüllt. Dabei ist es nicht nur das<br />
tatsächliche Labyrinth im Garten des Overlook-Hotels, welches<br />
diese Gefühle symbolisiert. Vielmehr zieht sich das Labyrinth-<br />
Motiv durch den gesamten Film: Wenn Danny mit seinem Dreirad<br />
durch die unendlich wirkenden Gänge des Gebäudes fährt,<br />
welche zum einen mit einem Teppich in Labyrinth-Optik ausgelegt<br />
sind und zum anderen nirgendwo hin zu führen scheinen,<br />
wird die Bedrohung auch für den Zuschauer greifbar.<br />
Ähnliche Metaphern gibt es im gesamten Horrorgenre, man<br />
denke nur an Spukschlösser, dunkle Gassen und unheimliche<br />
Gestalten, die Bedrohungen und Ängste visualisieren, um den<br />
Zuschauer emotional einzubinden.<br />
Forschungn<br />
Hauptziel der Medienmacher: Emotionen erzeugen<br />
Das Labyrinth als AV-Metapher in Kubricks „Shining“<br />
7