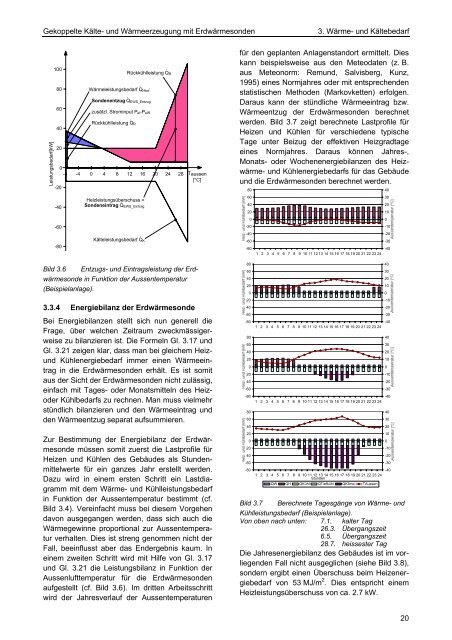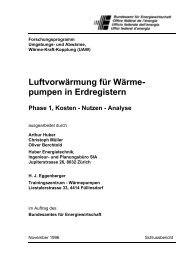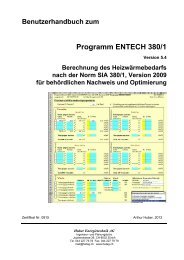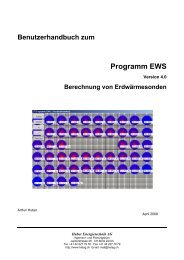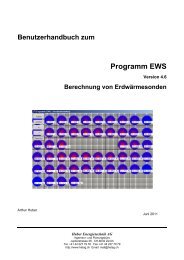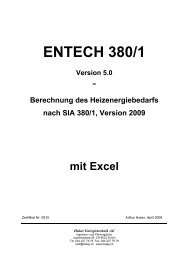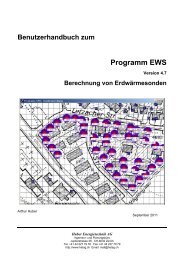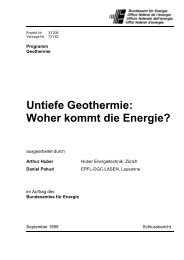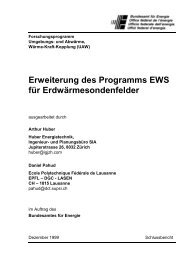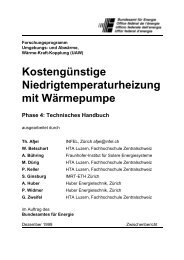Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG
Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG
Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Gekoppelte</strong> <strong>Kälte</strong>- <strong>und</strong> <strong>Wärme</strong>erzeugung mit Erdwärmesonden 3. <strong>Wärme</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kälte</strong>bedarf<br />
Leistungsbedarf[kW]<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
-20<br />
-40<br />
-60<br />
-80<br />
.<br />
Rückkühlleistung QR<br />
.<br />
<strong>Wärme</strong>leistungsbedarf QHtot:<br />
.<br />
Sondenentzug QEWS_Entzug<br />
zusätzl. Strominput Pel-PelR<br />
.<br />
Rückkühlleistung QR<br />
-8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28<br />
Heizleistungsüberschuss . =<br />
Sondeneintrag QEWS_Eintrag<br />
.<br />
<strong>Kälte</strong>leistungsbedarf QK<br />
Taussen<br />
[°C]<br />
Bild 3.6 Entzugs- <strong>und</strong> Eintragsleistung der Erdwärmesonde<br />
in Funktion der Aussentemperatur<br />
(Beispielanlage).<br />
3.3.4 Energiebilanz der Erdwärmesonde<br />
Bei Energiebilanzen stellt sich nun generell die<br />
Frage, über welchen Zeitraum zweckmässigerweise<br />
zu bilanzieren ist. Die Formeln Gl. 3.17 <strong>und</strong><br />
Gl. 3.21 zeigen klar, dass man bei gleichem Heiz<strong>und</strong><br />
Kühlenergiebedarf immer einen <strong>Wärme</strong>eintrag<br />
in die Erdwärmesonden erhält. Es ist somit<br />
aus der Sicht der Erdwärmesonden nicht zulässig,<br />
einfach mit Tages- oder Monatsmitteln des Heizoder<br />
Kühlbedarfs zu rechnen. Man muss vielmehr<br />
stündlich bilanzieren <strong>und</strong> den <strong>Wärme</strong>eintrag <strong>und</strong><br />
den <strong>Wärme</strong>entzug separat aufsummieren.<br />
Zur Bestimmung der Energiebilanz der Erdwärmesonde<br />
müssen somit zuerst die Lastprofile für<br />
Heizen <strong>und</strong> Kühlen des Gebäudes als St<strong>und</strong>enmittelwerte<br />
für ein ganzes Jahr erstellt werden.<br />
Dazu wird in einem ersten Schritt ein Lastdiagramm<br />
mit dem <strong>Wärme</strong>- <strong>und</strong> Kühlleistungsbedarf<br />
in Funktion der Aussentemperatur bestimmt (cf.<br />
Bild 3.4). Vereinfacht muss bei diesem Vorgehen<br />
davon ausgegangen werden, dass sich auch die<br />
<strong>Wärme</strong>gewinne proportional zur Aussentemperatur<br />
verhalten. Dies ist streng genommen nicht der<br />
Fall, beeinflusst aber das Endergebnis kaum. In<br />
einem zweiten Schritt wird mit Hilfe von Gl. 3.17<br />
<strong>und</strong> Gl. 3.21 die Leistungsbilanz in Funktion der<br />
Aussenlufttemperatur für die Erdwärmesonden<br />
aufgestellt (cf. Bild 3.6). Im dritten Arbeitsschritt<br />
wird der Jahresverlauf der Aussentemperaturen<br />
für den geplanten Anlagenstandort ermittelt. Dies<br />
kann beispielsweise aus den Meteodaten (z. B.<br />
aus Meteonorm: Rem<strong>und</strong>, Salvisberg, Kunz,<br />
1995) eines Normjahres oder mit entsprechenden<br />
statistischen Methoden (Markovketten) erfolgen.<br />
Daraus kann der stündliche <strong>Wärme</strong>eintrag bzw.<br />
<strong>Wärme</strong>entzug der Erdwärmesonden berechnet<br />
werden. Bild 3.7 zeigt berechnete Lastprofile für<br />
Heizen <strong>und</strong> Kühlen für verschiedene typische<br />
Tage unter Beizug der effektiven Heizgradtage<br />
eines Normjahres. Daraus können Jahres-,<br />
Monats- oder Wochenenergiebilanzen des Heizwärme-<br />
<strong>und</strong> Kühlenergiebedarfs für das Gebäude<br />
<strong>und</strong> die Erdwärmesonden berechnet werden.<br />
80<br />
40<br />
60<br />
30<br />
40<br />
20<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0<br />
-20<br />
-10<br />
-40<br />
-20<br />
-60<br />
-30<br />
-80<br />
-40<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
-20<br />
-40<br />
-60<br />
-80<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
-20<br />
-40<br />
-60<br />
-80<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
-20<br />
-40<br />
-60<br />
-80<br />
-40<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24<br />
-40<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324<br />
St<strong>und</strong>en<br />
QW QH QKühl QTiefkühl QKlima TAussen<br />
Bild 3.7 Berechnete Tagesgänge von <strong>Wärme</strong>- <strong>und</strong><br />
Kühlleistungsbedarf (Beispielanlage).<br />
Von oben nach unten: 7.1. kalter Tag<br />
26.3. Übergangszeit<br />
6.5. Übergangszeit<br />
28.7. heissester Tag<br />
Die Jahresenergiebilanz des Gebäudes ist im vorliegenden<br />
Fall nicht ausgeglichen (siehe Bild 3.8),<br />
sondern ergibt einen Überschuss beim Heizenergiebedarf<br />
von 53 MJ/m 2 . Dies entspricht einem<br />
Heizleistungsüberschuss von ca. 2.7 kW.<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
-30<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
-30<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
-30<br />
-40<br />
20