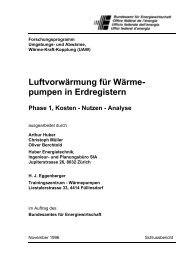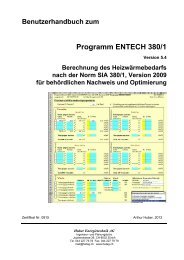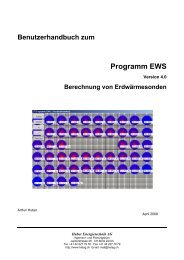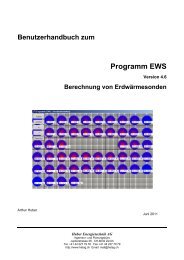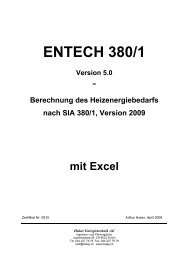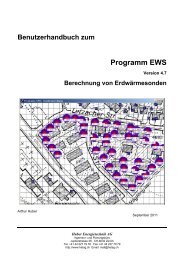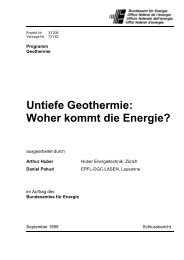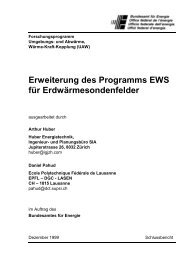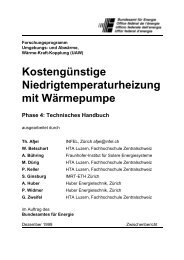Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG
Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG
Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Gekoppelte</strong> <strong>Kälte</strong>- <strong>und</strong> <strong>Wärme</strong>erzeugung mit Erdwärmesonden 4. Komponentenauslegung<br />
Bis anhin wurde gezeigt, wie das Temperaturniveau<br />
in der Erdwärmesonde berechnet werden<br />
kann. Etwas aufwendiger ist eine Aussage über<br />
den anzustrebenden Zielwert für die Dimensionierung.<br />
Dazu müssen die folgenden Randbedingungen<br />
eingehalten werden:<br />
� Die Frostgrenze des Sondenfluids darf nicht<br />
unterschritten werden<br />
� Die Rückkühlspitzen dürfen nicht zu unzulässigen<br />
Druckspitzen in der <strong>Wärme</strong>pumpe<br />
führen ("Hochdruck")<br />
� Der Sondendurchsatz sollte nicht so hoch<br />
gewählt werden, dass mehr als 10 % der<br />
benötigten Energie in die Umwälzpumpen<br />
gesteckt wird.<br />
Neben diesen Randbedingungen ist ein klassisches<br />
Optimierungsproblem zwischen Investitionskosten<br />
(Sondenlänge) <strong>und</strong> Betriebskosten<br />
(COP/EER der <strong>Wärme</strong>pumpe) zu lösen.<br />
Dimensionierung mit PC-Programm EWS<br />
Auch bei der Dimensionierung von Erdwärmesondenfeldern<br />
mit einem PC-Programm ist, wie<br />
bei der Handrechenmethode, die Berechnung der<br />
Sondenbelastung im St<strong>und</strong>enschritt (cf. Kapitel<br />
3.3) notwendig. Als Eingaben für das Erdwärmesondenprogramm<br />
EWS (siehe auch Anhang 9.1)<br />
dienen die Werte der aufsummierten Monatsbilanzen<br />
dieser stündlich berechneten Sondenbelastungen<br />
(Bild 4.5).<br />
Bild 4.5: Eingabe der monatlichen Entzugsenergie<br />
im Programm EWS.<br />
Der nächste Schritt besteht darin, die maximale<br />
Entzugs- <strong>und</strong> Einspeisleistung in die Erdwärmesonden<br />
während des <strong>Wärme</strong>pumpenbetriebs zu<br />
berechnen. Bei diesem Schritt ist zu beachten,<br />
dass das Programm von einem Ein-Aus-Betrieb<br />
ausgeht <strong>und</strong> dass das Maximum nicht direkt aus<br />
der installierten <strong>Wärme</strong>pumpenleistung abgeleitet<br />
werden kann. Dies deshalb, weil bei vernünftiger<br />
Anlagensteuerung immer ein Teil der Gewerbekälte<br />
zur Warmwasserproduktion verwendet werden<br />
kann <strong>und</strong> die Erdwärmesonden somit dadurch<br />
nicht belastet werden.<br />
Angaben über die Bodeneigenschaften <strong>und</strong> Wahl<br />
der Temperatursprungantwort, damit die gegenseitige<br />
Beeinflussung von mehreren Erdwärmesonden<br />
berücksichtigt wird, vervollständigen die<br />
Gr<strong>und</strong>eingaben im Programm.<br />
Im letzten Schritt wird die Optimierung der Bohrtiefe<br />
<strong>und</strong> Anzahl Erdwärmesonden durchgeführt.<br />
Die physikalischen Grenzen liegen nach oben in<br />
der maximalen Kondensationstemperatur der<br />
<strong>Wärme</strong>pumpe <strong>und</strong> nach unten beim Gefrieren des<br />
Sondenfluids oder der Sondenhinterfüllung. Aus<br />
energetischen <strong>und</strong> ökonomischen Gründen wird<br />
man aber nicht an diese Grenzen herangehen<br />
<strong>und</strong> sich sinnvollerweise vornehmen, nicht tiefer<br />
als –5 °C <strong>und</strong> nicht höher als 45 °C – 50 °C bei<br />
der Rücklauftemperatur zu gehen (Bild 4.6).<br />
Bild 4.6: Erdwärmesondentemperatur der Beispielanlage<br />
im Winter.<br />
26