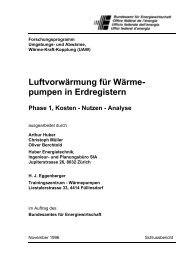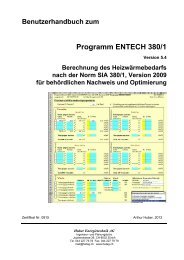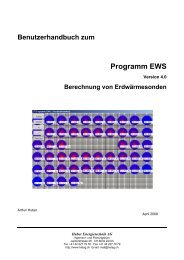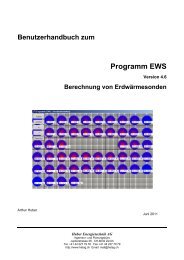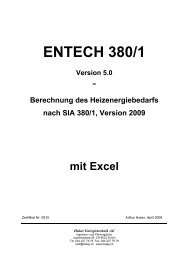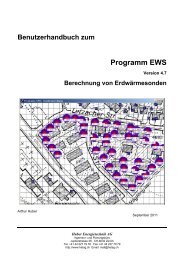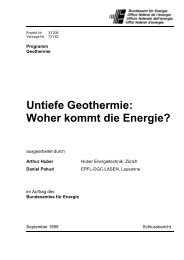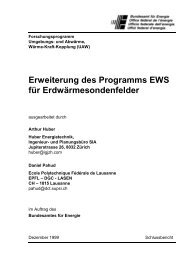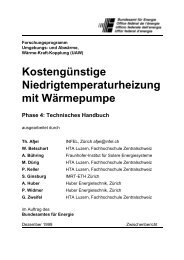Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG
Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG
Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Gekoppelte</strong> <strong>Kälte</strong>- <strong>und</strong> <strong>Wärme</strong>erzeugung mit Erdwärmesonden 9. Anhang<br />
Die Strömungsgeschwindigkeit in einer üblichen<br />
Doppel-U-Sonde berechnet sich aus dem Förderstrom<br />
V& wie folgt:<br />
V&<br />
2V&<br />
v = = [m/s] Gl. 9.26<br />
A π D<br />
2<br />
i<br />
Dabei ist Di der Innendurchmesser der Sondenrohre.<br />
Meist werden die folgenden Sondendimensionen<br />
eingesetzt:<br />
Tabelle 9.5 Typische Dimensionen von Sondenrohren.<br />
Nenndurchmesser Innendurchmesser Di<br />
25 mm Doppel-U-Sonde 0.0204 m<br />
32 mm Doppel-U-Sonde 0.026 m<br />
40 mm Doppel-U-Sonde 0.0326 m<br />
Damit kann die Reynoldszahl Re aus der Strömungsgeschwindigkeit<br />
v [m/s] <strong>und</strong> der kinematischen<br />
Viskosität der Sondenfüllung ν [m 2 /s] bestimmt<br />
werden<br />
Re = vD<br />
ν<br />
Gl. 9.27<br />
Damit kann nun der Druckverlustkoeffizient ξ berechnet<br />
werden. Er ist definiert als<br />
∂p<br />
= ξ<br />
∂x<br />
ρSolev<br />
2 D<br />
i<br />
2<br />
[Pa/m] Gl. 9.28<br />
Im laminaren Bereich (Re < 2320) gilt:<br />
64<br />
ξ =<br />
Gl. 9.29<br />
Re<br />
Im turbulenten Bereich (2320 < Re < 100’000)<br />
kann bei hydraulisch glatten Rohren der folgende<br />
Ansatz verwendet werden:<br />
0.<br />
3164<br />
ξ = 1/<br />
4<br />
Gl. 9.30<br />
Re<br />
Für Re > 100’000 gilt bei hydraulisch glatten Rohren:<br />
0.<br />
221<br />
ξ = 0 . 0032 + 0.<br />
237<br />
Gl. 9.31<br />
Re<br />
Um der Turbulenzproduktion in der Umwälzpumpe<br />
Rechnung zu tragen, wird für Re > 4'000 von<br />
einem minimalen Wert des Druckverlustkoeffizienten<br />
ausgegangen:<br />
ξ Min = 0.<br />
045<br />
Gl. 9.32<br />
Daraus berechnet sich der Druckabfall in der<br />
Erdwärmesonde mit:<br />
H ρ v<br />
D<br />
2<br />
∆ p=<br />
ξ Sole [Pa] Gl. 9.33<br />
i<br />
Der oben beschriebene Rechnungsgang setzt<br />
voraus, dass die optimale Temperaturspreizung<br />
∆T bereits bekannt ist. Dies ist in der Regel nicht<br />
der Fall <strong>und</strong> hängt von den folgenden Faktoren<br />
ab:<br />
• Frostgrenze Sondenfluid<br />
• Stoffeigenschaften Sondenfluid<br />
• Bodeneigenschaften (λ, ρ, cp)<br />
• Klimabedingungen Standort<br />
• Sondenbelastung (Durchschnitt, Spitze)<br />
• Bohrtiefe<br />
• Anzahl Sonden<br />
• Sondengeometrie<br />
• Sondenanordnung<br />
• Hinterfüllung der Bohrung<br />
• Kennlinie <strong>Wärme</strong>pumpe<br />
Um trotzdem sehr schnell zu einer vernünftigen<br />
Auslegung der Sondenpumpe zu gelangen, wurden<br />
zwei Hilfsprogramme EWSDRUCK <strong>und</strong> EWS<br />
erstellt (siehe Anhang 9.1).<br />
58