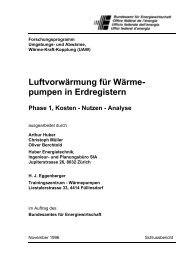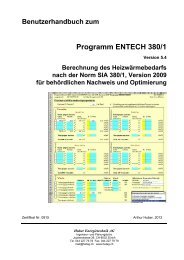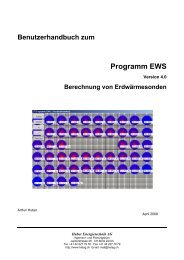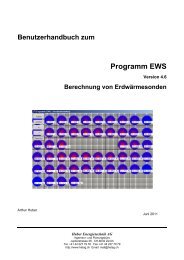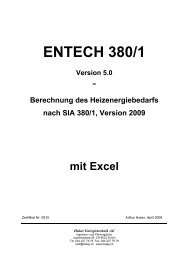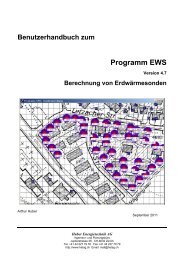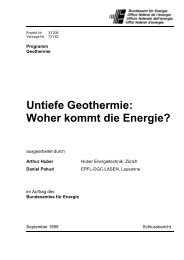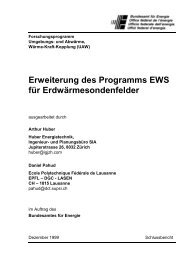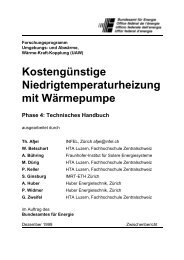Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG
Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG
Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Gekoppelte</strong> <strong>Kälte</strong>- <strong>und</strong> <strong>Wärme</strong>erzeugung mit Erdwärmesonden 1. Einleitung<br />
Im Sommer ist eine direkte Nutzung der Erdwärmesonde<br />
zur Raum- <strong>und</strong> Strukturkühlung möglich,<br />
indem das Erdreich als <strong>Wärme</strong>senke resp. <strong>Kälte</strong>quelle<br />
wirkt. Die Kühlung erfolgt dabei normalerweise<br />
über einen direkten Kreislauf zwischen<br />
Erdwärmesonde <strong>und</strong> Kühlregister. Im Sommer<br />
kann die Erdwärmesonde auch zur Erzeugung<br />
von Gewerbekälte eingesetzt werden, indem sie<br />
die Abwärme einer <strong>Wärme</strong>pumpe bzw. <strong>Kälte</strong>maschine<br />
ins Erdreich abführt. Im Winter dienen Erdwärmesonden<br />
als <strong>Wärme</strong>quellen für monovalent<br />
betriebene <strong>Wärme</strong>pumpen oder für Aussenluftvorwärmung,<br />
Die Erdwärmesonden können im<br />
Winter gleichzeitig auch als <strong>Wärme</strong>senke bzw.<br />
<strong>Kälte</strong>quelle zur Erzeugung von Gewerbekälte eingesetzt<br />
werden.<br />
Bezeichnungen<br />
Bild 1.8 stellt einen Querschnitt durch eine<br />
Doppel-U-Sonde dar.<br />
Sondenrohre<br />
Hinterfüllung<br />
Bohrlochtemperatur Tb<br />
Bohrradius r1<br />
Erde<br />
Bild 1.8: Sondenquerschnitt (<strong>Huber</strong>, 1999).<br />
Bei diesem Sondentyp wird zunächst eine Bohrung<br />
mit dem Radius r1 erstellt. Darin werden vier<br />
Sondenrohre eingeführt <strong>und</strong> mit einer Zement-<br />
Bentonit-Mischung hinterfüllt. In zwei dieser Sondenrohre<br />
fliesst das Sondenfluid hinunter <strong>und</strong> in<br />
den anderen beiden wieder hinauf. Die Rohre sind<br />
am unteren Ende verb<strong>und</strong>en, es existiert also ein<br />
geschlossener Sondenkreislauf, siehe Bild 1.9.<br />
Die mittlere Temperatur am Rand der Bohrung,<br />
auf dem Radius r1, wird als Bohrlochtemperatur Tb<br />
bezeichnet. Die Temperatur, mit welcher das Sondenfluid<br />
die Sonde verlässt, ist die sogenannte<br />
Quellentemperatur TQuelle. Weitere Ausführungen<br />
<strong>und</strong> Berechnungen sind in Anhang 9.5 zu finden<br />
Bild 1.9: Endstück einer Doppel-U-Sonde (Foto:<br />
HAKA-GERODUR <strong>AG</strong>).<br />
1.5 Kennzahlen<br />
1.5.1 Definitionen<br />
Mit Hilfe einer einfachen Berechnung von einigen<br />
typischen Kennzahlen können verschiedene <strong>Wärme</strong>pumpen-<br />
<strong>und</strong> <strong>Kälte</strong>maschinensysteme miteinander<br />
verglichen werden. Klassischerweise werden<br />
zu diesem Vergleich die Leistungszahlen<br />
COP (Coefficient of Performance) bei der <strong>Wärme</strong>pumpe<br />
<strong>und</strong> EER (Energy Efficiency Ratio) bei der<br />
<strong>Kälte</strong>maschine verwendet. Damit die Vergleichbarkeit<br />
aber bei Einzel- <strong>und</strong> Kombimaschinen gegeben<br />
ist, muss eine zusätzliche Gesamtleistungszahl<br />
GLZ definiert werden.<br />
Alle Kennzahlen sind definiert als gemittelte Nutzleistung<br />
zu elektrischer Leistungsaufnahme. Je<br />
höher der Wert der Kennzahl, um so geringer ist<br />
der Strombedarf Pel bei einer gegebenen Nutzleistung.<br />
Wird als Nutzleistung der <strong>Wärme</strong>pumpe die<br />
<strong>Wärme</strong>abgabeseite verwendet, muss also ein<br />
Heizleistungsbedarf QH tot<br />
& gedeckt werden, so wird<br />
die Kennzahl COP verwendet. Mit den zeitlich<br />
gemittelten Momentanwerten kann die Leistungszahl<br />
COP definiert werden als:<br />
Def.:<br />
COP<br />
Q&<br />
Q&<br />
Nutz Htot<br />
= =<br />
Gl. 1.1<br />
Pel<br />
Pel<br />
Wird die <strong>Wärme</strong>pumpe andererseits als <strong>Kälte</strong>maschine<br />
verwendet, ist damit also ein Kühlleistungsbedarf<br />
QK tot<br />
& zu decken, so wird die Kennzahl<br />
EER verwendet:<br />
Def.:<br />
EER<br />
Q&<br />
Q&<br />
Nutz K tot<br />
= =<br />
Gl. 1.2<br />
Pel<br />
Pel<br />
Anstelle EER wird häufig auch der Begriff<br />
COPKühlen verwendet. Bei einer Anwendung mit<br />
gleichzeitigem <strong>Wärme</strong>- <strong>und</strong> Kühlleistungsbedarf<br />
kann die Heizleistung mit einer <strong>Wärme</strong>pumpe <strong>und</strong><br />
die Kühlleistung mit einer separaten <strong>Kälte</strong>maschine<br />
erbracht werden (Zwei-Maschinen-Lö-<br />
4