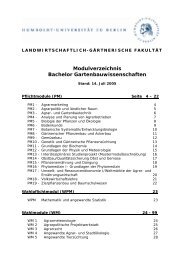PDF-Datei 812 Kb - Humboldt-Universität zu Berlin
PDF-Datei 812 Kb - Humboldt-Universität zu Berlin
PDF-Datei 812 Kb - Humboldt-Universität zu Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1.4. Partnerinduktion<br />
Die Partnerinduktion (BERGANN, 1961), gekennzeichnet durch interzelluläre<br />
Genwirkung tritt nur auf, wenn zwei genetisch verschiedene Zellen oder Zellverbände<br />
(Gewebe) sich in direktem Kontakt <strong>zu</strong>einander befinden. Die dabei modifizierten Zellen<br />
sind geprägt durch konzentrationsbedingte Wanderungsvorgänge. Sie unterscheiden<br />
sich durch das äußere Erscheinungsbild in Be<strong>zu</strong>g auf Musterung oder Körperform. Oft<br />
sind induktive Wirkungen eines genetisch andersartigen Partners auf die Physiologie<br />
und den Stoffwechsel der benachbarten Zellen die Ursache für dieses Phänomen.<br />
Charakteristisch für diese partnerinduktive Beeinflussung bei Pflanzen ist die begrenzte<br />
Wirkung auf unmittelbar benachbarte Zellen, wobei sie nicht auf eine Zellschicht<br />
beschränkt ist und auch innerhalb einer Schicht wirken kann, wenn diese ebenfalls aus<br />
zwei genetisch verschiedenen Geweben besteht. Die Wirkrichtung ist in vertikaler und<br />
horizontaler Richtung und somit dreidimensional. Partnerinduktion ist nicht an eine<br />
periklinalchimärische Konstitution gebunden. Eklatant war eine partnerinduktive<br />
Wirkung der L2 auf eine anthocyandefekte L1-Schicht, die bei Euphorbia pulcherrima<br />
WILLD. ‘Eckes Rosa’ durch BERGANN, 1961 festgestellt werden konnte. Der<br />
partnerinduktive Effekt ließ sich unter anderem auch bei genetisch bedingten<br />
Sprenkelungen an Blüten feststellen, wie z.B. bei Viola sororia WILLD., wo bei einer<br />
genetisch veränderten, blauen Epidermiszelle eine schwache Farbwirkung durch<br />
Anthocyansynthese in den normalerweise anthocyandefekten Nachbarzellen induziert<br />
wird (PLASCHIL, 1997).<br />
1.5 Zur Erzeugung von Pfropfheterohistonten bei Populus<br />
In der Literatur liegen Befunde, von KALBE (1962) - zwei stabile Schichten und<br />
PANKOW (1962) - drei stabile Schichten, über den Scheitelaufbau bei Populus vor.<br />
Wichtig bei der Erzeugung von Pfropfheterohistonten ist, daß sich an der<br />
Verwachsungsstelle beider Pfropfpartner ein Mischkallus bildet, aus dem<br />
Adventivsprosse regenerieren, die in verschiedenen Zellschichten des Sproßscheitels<br />
Gewebe von Unterlage und Pfropfreis besitzen. Aus einem so erzeugten Mischkallus<br />
regenerieren neben Homohistonten der einen als auch der anderen Komponente auch<br />
einige Heterohistonten. Zur Aufrechterhaltung von Pfropfheterohistonten ist ein gutes<br />
Regenerationsvermögen über Seitensproßbildung aus den Achselknospen und eine gute<br />
Bewurzelung von Grünstecklingen oder Steckholz nötig.<br />
14