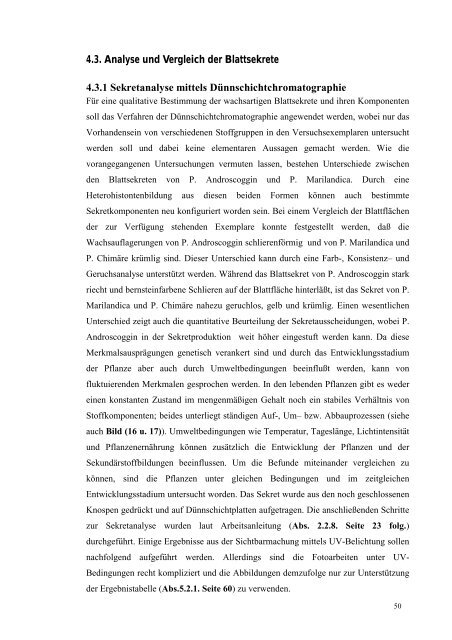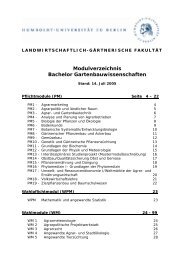PDF-Datei 812 Kb - Humboldt-Universität zu Berlin
PDF-Datei 812 Kb - Humboldt-Universität zu Berlin
PDF-Datei 812 Kb - Humboldt-Universität zu Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4.3. Analyse und Vergleich der Blattsekrete<br />
4.3.1 Sekretanalyse mittels Dünnschichtchromatographie<br />
Für eine qualitative Bestimmung der wachsartigen Blattsekrete und ihren Komponenten<br />
soll das Verfahren der Dünnschichtchromatographie angewendet werden, wobei nur das<br />
Vorhandensein von verschiedenen Stoffgruppen in den Versuchsexemplaren untersucht<br />
werden soll und dabei keine elementaren Aussagen gemacht werden. Wie die<br />
vorangegangenen Untersuchungen vermuten lassen, bestehen Unterschiede zwischen<br />
den Blattsekreten von P. Androscoggin und P. Marilandica. Durch eine<br />
Heterohistontenbildung aus diesen beiden Formen können auch bestimmte<br />
Sekretkomponenten neu konfiguriert worden sein. Bei einem Vergleich der Blattflächen<br />
der <strong>zu</strong>r Verfügung stehenden Exemplare konnte festgestellt werden, daß die<br />
Wachsauflagerungen von P. Androscoggin schlierenförmig und von P. Marilandica und<br />
P. Chimäre krümlig sind. Dieser Unterschied kann durch eine Farb-, Konsistenz– und<br />
Geruchsanalyse unterstützt werden. Während das Blattsekret von P. Androscoggin stark<br />
riecht und bernsteinfarbene Schlieren auf der Blattfläche hinterläßt, ist das Sekret von P.<br />
Marilandica und P. Chimäre nahe<strong>zu</strong> geruchlos, gelb und krümlig. Einen wesentlichen<br />
Unterschied zeigt auch die quantitative Beurteilung der Sekretausscheidungen, wobei P.<br />
Androscoggin in der Sekretproduktion weit höher eingestuft werden kann. Da diese<br />
Merkmalsausprägungen genetisch verankert sind und durch das Entwicklungsstadium<br />
der Pflanze aber auch durch Umweltbedingungen beeinflußt werden, kann von<br />
fluktuierenden Merkmalen gesprochen werden. In den lebenden Pflanzen gibt es weder<br />
einen konstanten Zustand im mengenmäßigen Gehalt noch ein stabiles Verhältnis von<br />
Stoffkomponenten; beides unterliegt ständigen Auf-, Um– bzw. Abbauprozessen (siehe<br />
auch Bild (16 u. 17)). Umweltbedingungen wie Temperatur, Tageslänge, Lichtintensität<br />
und Pflanzenernährung können <strong>zu</strong>sätzlich die Entwicklung der Pflanzen und der<br />
Sekundärstoffbildungen beeinflussen. Um die Befunde miteinander vergleichen <strong>zu</strong><br />
können, sind die Pflanzen unter gleichen Bedingungen und im zeitgleichen<br />
Entwicklungsstadium untersucht worden. Das Sekret wurde aus den noch geschlossenen<br />
Knospen gedrückt und auf Dünnschichtplatten aufgetragen. Die anschließenden Schritte<br />
<strong>zu</strong>r Sekretanalyse wurden laut Arbeitsanleitung (Abs. 2.2.8. Seite 23 folg.)<br />
durchgeführt. Einige Ergebnisse aus der Sichtbarmachung mittels UV-Belichtung sollen<br />
nachfolgend aufgeführt werden. Allerdings sind die Fotoarbeiten unter UV-<br />
Bedingungen recht kompliziert und die Abbildungen dem<strong>zu</strong>folge nur <strong>zu</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng<br />
der Ergebnistabelle (Abs.5.2.1. Seite 60) <strong>zu</strong> verwenden.<br />
50