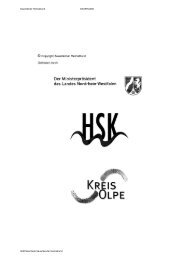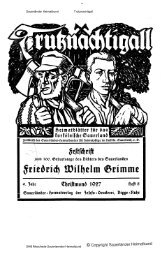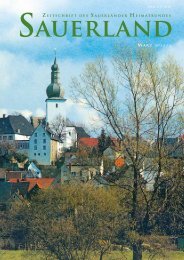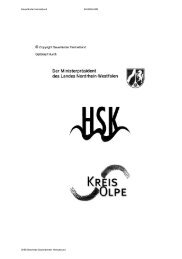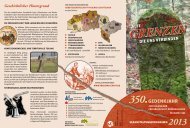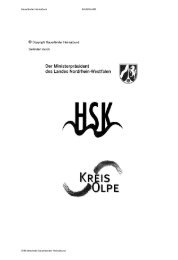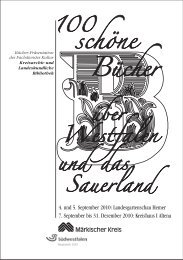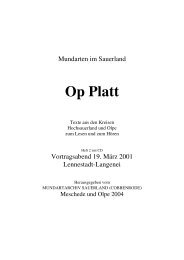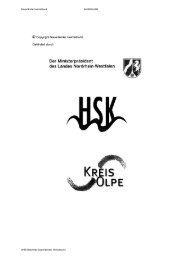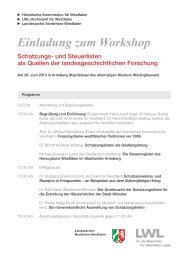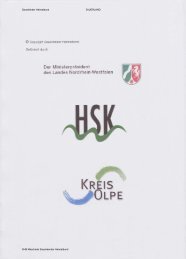Heft 2 - Sauerländer Heimatbund e.V.
Heft 2 - Sauerländer Heimatbund e.V.
Heft 2 - Sauerländer Heimatbund e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
SAUERLAND NR. 2/2010 93<br />
Eichengallen im Sauerland<br />
Was ist das, eine Pflanzengalle?<br />
Pflanzengallen sind abnorme Gebilde,<br />
die von einer Wirtspflanze unter dem<br />
Einfluss eines Gall-Erregers erzeugt werden.<br />
Dessen Larve wächst im Inneren<br />
der pflanzlichen Wucherung heran und<br />
ernährt sich von ihrer Substanz. Die ausschlüpfenden,<br />
in der Regel winzigen Tiere<br />
sind frei beweglich und sorgen für die<br />
Verbreitung und Vermehrung. Gallen<br />
können von Vertretern recht unterschiedlicher<br />
Tiergruppen angeregt werden.<br />
Überwiegend handelt es sich um<br />
Gallwespen, Gallmücken, Gallfliegen<br />
und Gallmilben, aber auch bestimmte<br />
Käfer-, Schmetterlings- und Wanzen -<br />
arten sind am Entstehen von Gall -<br />
bildungen beteiligt. Diese haben eine<br />
charakteristische und in der Regel unverwechselbare<br />
Form, wie ein Blick auf die<br />
fünf Beispiele von Eichengallen zeigt, die<br />
hier näher behandelt werden sollen.<br />
Jede Galle hat ihren spezifischen Erreger,<br />
der ausschließlich auf eine bestimmte<br />
Wirtsart oder doch zumindest<br />
auf eine Wirtsgattung mit mehreren<br />
ähnlichen Arten ausgerichtet ist. Den<br />
Nut zen hat dabei ausschließlich das Tier.<br />
Die Pflanze nimmt im Normalfall keinen<br />
erkennbaren Schaden. Insofern sind die<br />
Gall-Insekten auch nicht als Parasiten im<br />
strengen Sinne anzusprechen. Die<br />
kaum vorstellbare Menge an Gallen, wie<br />
sie eine gesunde Eiche in einem „guten“<br />
Gallenjahr (etwa 2009) tragen kann (gewiss<br />
Zehntausende von Kleingallen!),<br />
geht, soweit erkennbar, nicht zu Lasten<br />
des Holz- und Substanzzuwachses. Das<br />
bewältigt die Eiche aus ihrer schier unerschöpflichen<br />
vegetativen Kraftreserve<br />
Abb. 1: Linsengallen, Blattunterseite einer Stieleiche<br />
(mit 2 Krempengallen), Ruhrtal 2009<br />
heraus. Es verbleibt zwischen den von<br />
Gallen besetzten Anteilen der Blatt -<br />
spreite hinreichend Fläche für die normale<br />
Photosynthese und damit für die<br />
eigentliche pflanzliche Produk -<br />
tionsleistung – und im Übrigen ist für<br />
den Baum der ganze Gallenspuk mit<br />
dem herbstlichen Blätterfall ohnehin für<br />
ein Jahr wieder überstanden.<br />
In mehrfacher Hinsicht ist das Mitein -<br />
ander von Wirtspflanze und Gallinsekt<br />
von besonderem biologischen Interesse.<br />
Schon die Entstehung der Galle ist ein<br />
geheimnisvoller Vorgang. Welches Sig -<br />
nal veranlasst die Wirtspflanze, ihr genetisches<br />
Programm, das zuständig ist für<br />
die Herstellung des arteigenen Gewebes,<br />
punktuell umzustellen auf die Produktion<br />
der Galle? Ist es bereits der Stich<br />
der Gallwespe bei der Eiablage, vielleicht<br />
zusätzlich die Injektion eines bestimmten<br />
Stoffes, oder sind es die Ausscheidungen<br />
der heranwachsenden Larve,<br />
die die lokale Physiologie der Wirtpflanze<br />
umstimmt auf die Bedürfnisse<br />
des Gastes? In einer neueren Veröffentlichung<br />
zu diesem Problem äußert sich<br />
der englische Gallenspezialist Simon<br />
RANDOLPH (2005) wie folgt: „Die Natur<br />
und Be schaffenheit der Signale …,<br />
die zu den vielfältigen, komplexen und<br />
manchmal spektakulären Strukturen<br />
führen, die die äußere Gestalt der Gallen<br />
auszeichnen, sind noch nicht bekannt“<br />
(S. 40, übersetzt v. Verf.).<br />
Eine weitere Besonderheit vieler Gallwespen,<br />
auch der hier ausgewählten<br />
Beispiele, ist der Generationswechsel.<br />
Er besteht darin, dass sich eine geschlechtlich<br />
sich fortpflanzende, also<br />
von Prof. Dr. Reiner Feldmann<br />
zweigeschlechtliche Generation im Verlauf<br />
eines Jahres ablöst mit einer eingeschlechtlichen<br />
Generation, die aus -<br />
schließlich aus Weibchen besteht. Diese<br />
legen unbefruchtete Eier, aus denen die<br />
Männchen und Weibchen der zweigeschlechtlichen<br />
Folgegeneration hervorgehen.<br />
Die Tiere der beiden Gruppen<br />
weichen in Gestalt und Größe so stark<br />
voneinander ab, dass man sie früher als<br />
zwei getrennte Arten angesehen hat, zumal<br />
sie auch noch unterschiedlich aussehende<br />
Gallen produzieren. Das wird am<br />
Beispiel des Eichengallapfels und seiner<br />
Gallwespe erläutert werden.<br />
Noch komplizierter wird es, wenn der<br />
Generationswechsel zusätzlich mit einem<br />
Wirtswechsel verbunden ist. Das<br />
ist, wie wir sehen werden, bei der Knop -<br />
perngallwespe der Fall.<br />
Und schließlich hat sich herausgestellt,<br />
dass der Gall-Erreger nicht der einzige<br />
Bewohner der von ihm induzierten<br />
Pflanzengalle ist. Vielmehr gibt es eine<br />
ganze Anzahl von Tieren unterschiedlicher<br />
Art, die als Mitbewohner den Raum<br />
und die Ressourcen des pflanzlichen Gebildes<br />
mitnutzen – und das auf sehr unterschiedliche<br />
Weise und mit ausgeprägten<br />
Eigeninteressen der einzelnen Partner.<br />
Es handelt sich um eine Lebensgemeinschaft<br />
der besonderen Art, von der<br />
im Schlussabschnitt die Rede sein soll.<br />
Häufige Eichengallen<br />
Unsere heimischen Stiel- und Trau -<br />
beneichen sind die Wirtsbäume mit der<br />
artenreichsten und buntesten Gallen -<br />
fauna. Das Standardwerk von Herbert<br />
BUHR (1965) widmet den Eichengallen<br />
Abb. 2: Münzengallen, Ruhrtal 2009