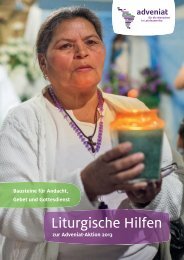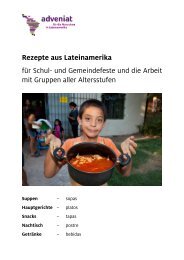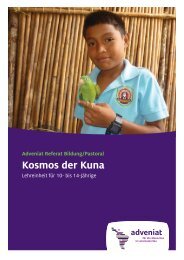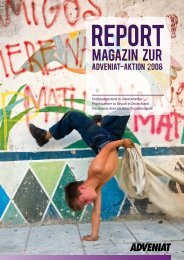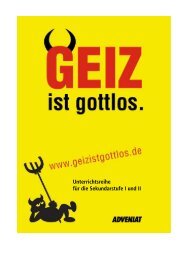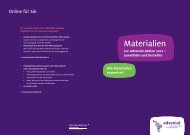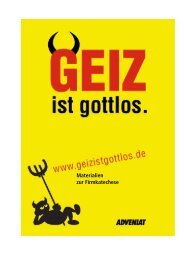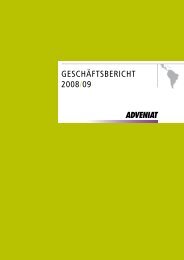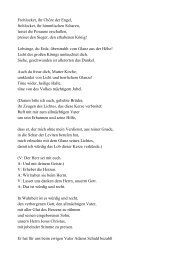1 Der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe ist die ... - Adveniat
1 Der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe ist die ... - Adveniat
1 Der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe ist die ... - Adveniat
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gisela Büttner Lermen, selbst Einwanderin in Brasilien, lehrte<br />
an der Katholischen Universität von Pernambuco Theologie und<br />
promovierte nach ihrer Pensionierung mit dem vorliegenden<br />
Werk im Fach Geschichte an der Universität in São Leopoldo<br />
in Rio Grande do Sul. Ihre Forschungsarbeit orientiert sich am<br />
Modell „Geschichte von unten“ mit dem Ziel, <strong>die</strong> Erfahrungen<br />
der katholischen Einwanderinnen für <strong>die</strong> Geschichte „zurückzugewinnen“,<br />
d.h. das „verhängnisvolle Sich-Verschließen der<br />
Kirche gegenüber den Erfahrungen von Laien allgemein und<br />
von Frauen im Besonderen“ aufzubrechen.<br />
Das Bundesland Rio Grande de Sul erlebte im 19. Jahrhundert<br />
eine beträchtliche Einwanderung aus Deutschland und Italien.<br />
Nachdem kürzlich <strong>die</strong> italienische Einwanderung<br />
in einer ebenfalls femin<strong>ist</strong>isch ausgerichteten<br />
Dissertation analysiert wurde,<br />
folgt hiermit <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong> zur Rolle der deutschen<br />
Frau im Rahmen der Einwanderung.<br />
Die Rolle der katholischen italienischen<br />
Frauen wurde folgendermaßen skizziert:<br />
„Gehorchen, danken, arbeiten.“<br />
Die Mehrzahl der katholischen deutschen<br />
Einwanderinnen und Einwanderer stammte<br />
aus dem agrarisch geprägten Südwesten<br />
Deutschlands, in dem viele Landbewohner<br />
aufgrund der Realerbteilung verarmt waren.<br />
Bezogen auf <strong>die</strong> kirchliche Verwaltung<br />
kamen sie aus den Diözesen Trier, Mainz<br />
und Freiburg.<br />
Die ersten Einwanderungsgenerationen<br />
(1824-1849) entwickelten in der neuen<br />
Heimat – auf dem Hintergrund einer in<br />
jeder Hinsicht „grauenvollen“ Situation<br />
der offiziellen Kirche – eine eindrucksvolle<br />
Eigeninitiative, um religiöses Leben und<br />
Unterweisung der Jugend zu praktizieren. Eine Art Laiengemeinden<br />
entstand, <strong>die</strong> allerdings nach 1849, als Jesuiten zunehmend<br />
<strong>die</strong> Seelsorge und Gemeindestruktur bestimmten,<br />
keine Zukunft hatten.<br />
Ab den 1840er Jahren brachten <strong>die</strong> Einwanderer Frömmigkeitsformen<br />
der katholischen Restauration aus Deutschland<br />
mit, <strong>die</strong> von der Autorin als „ultramontan emotional geladen“<br />
bezeichnet werden: Marienverehrung, Wallfahrten, Prozessionen,<br />
den Herz-Jesu-Kult sowie Bruderschaften, z.B. <strong>die</strong><br />
Herz-Mariä-Bruderschaft.<br />
Eine gefühlsorientierte Frauenfrömmigkeit wird gestützt, eine<br />
Spiritualität mit den Ideen Selbstverleugnung, Opfer, Sühne.<br />
Aktivitäten der Laien werden denen kirchlicher Autoritäten<br />
untergeordnet. Frauen kommen selten zu Wort. Als überraschendes<br />
Novum wird vermerkt, dass einige in den 1930er<br />
Jahren als Rednerinnen zu Katholikentagen eingeladen wurden.<br />
Während im südbrasilianischen Siedlungsgebiet der Deutschen<br />
katholischer Glaube, Muttersprache, Deutschtum und<br />
Unterordnung der Frau noch <strong>die</strong> Kultur bestimmten, wurde<br />
1922 in Rio de Janeiro bereits <strong>die</strong> „Brasilianische Föderation<br />
für weiblichen Fortschritt“ gegründet. Sie trat dafür ein, <strong>die</strong><br />
politischen Rechte der Frau sicherzustellen, „<strong>die</strong> unsere Konstitution<br />
ihr verleiht und sie für <strong>die</strong> intelligente Ausübung<br />
<strong><strong>die</strong>ser</strong> Rechte vorzubereiten“.<br />
<strong>Der</strong> letzte Teil des Buches enthält biographische<br />
Charakterstu<strong>die</strong>n, <strong>die</strong> den in<br />
jüngerer Zeit veröffentlichen Briefen von<br />
Auswanderern an ihre Verwandten in<br />
Deutschland sowie der deutschsprachigen<br />
Presse der südbrasilianischen Siedlungsregion<br />
entnommen wurden. Die dort veröffentlichten<br />
Todesanzeigen enthielten häufig<br />
ein Porträt der verstorbenen Person und<br />
damit Hinweise auf <strong>die</strong> Lebensumstände.<br />
Da <strong>die</strong>se sich in vielen Punkten ähnelten,<br />
hätte hier stärker zusammengefasst werden<br />
können.<br />
So nimmt der Leser tatsächlich an der Erforschung<br />
der Erfahrungen der deutschen<br />
Frauen teil, deren Schulbildung gering war.<br />
Er liest mit Erstaunen, dass <strong>die</strong> deutsche<br />
Muttersprache als „heiliges Gut“ verteidigt<br />
wurde. Er stellt Bezüge zur Migrationsdebatte<br />
hier (in Deutschland) und heute her.<br />
Er fragt sich, „wer“ lebte „wie“ von den<br />
deutschen Einwanderen im Kolonialgebiet. „Wilde Menschen“?<br />
Er fragt sich, wie sich <strong>die</strong> katholisch-deutsche Sozialisation<br />
auf den Süden Brasiliens auswirkt.<br />
Die Autorin bietet eine reiche Fülle an Materialien an, um <strong>die</strong><br />
Erfahrungen der deutschen Auswanderinnen „zurückzugewinnen“,<br />
um Fragen anzustoßen, <strong>die</strong> geeignet sind, den Horizont<br />
für <strong>die</strong> Migrationsproblematik überhaupt auszuweiten.<br />
Erschienen im Verlag Regionalkultur, Heidelberg 2006<br />
Kultur<br />
Gisela Lermen:<br />
„Deutsche Auswanderinnen in Südbrasilien“<br />
Lebenswelten und Erfahrungen von Frauen in Kolonie und katholische Kirche<br />
(1824-1939)<br />
von Annedore Jünnemann und Gerborg Me<strong>ist</strong>er<br />
17