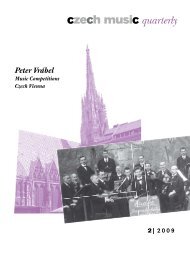Materialien zur Vorlesung "Öffentliche und private Sphäre"
Materialien zur Vorlesung "Öffentliche und private Sphäre"
Materialien zur Vorlesung "Öffentliche und private Sphäre"
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Hausmusik zwischen Privatheit <strong>und</strong> Öffentlichkeit<br />
Hausmusik scheint die <strong>private</strong> Musik schlechthin. Während die Musik- <strong>und</strong><br />
Sängerfeste nicht nur öffentliche Veranstaltungen sind, sondern auch nach<br />
publizistischer Öffentlichkeit, musikalischer Berichterstattung, Resonanz beim<br />
Publikum usw. verlangen, findet die Hausmusik in den eigenen vier Wänden statt.<br />
Um etwas darüber zu erfahren, sind wir auf die Berichte in der Presse angewiesen,<br />
die oft ihre eigenen parteiischen, polemischen Meinungen vertreten, auf ebenfalls<br />
<strong>zur</strong> Überspitzung neigende literarische Texte (wie E. T. A. Hoffmann) oder auf<br />
<strong>private</strong> Zeugnisse.<br />
Aber es gibt auch Hausmusik, die eine eigentümliche Stellung zwischen Privatheit<br />
<strong>und</strong> Öffentlichkeit einnimmt. Zwei Beispiele dafür haben wir in der <strong>Vorlesung</strong><br />
erörtert:<br />
– die „Liebhaberkonzerte“ im Wiener Schottenhof zwischen 1815 <strong>und</strong> 1818, die<br />
eigentlich aus dem <strong>private</strong>n Quartettspiel der Familie Schubert entstanden waren,<br />
zu denen sich immer mehr „Dilettanten“ gesellten, bis zuletzt ein kleines Orchester<br />
beisammen war – respektable 35 (sämtlich männliche) Mitglieder, darunter nur<br />
wenige professionelle Musiker, die meisten gehörten „dem Handlungs-, Gewerbs-<br />
oder minderen Beamtenstande an“ (Leopold von Sonnleithner). Wir haben<br />
erörtert, wie sich in Schuberts für dieses Ensemble komponierten Symphonie Nr. 5<br />
die klassischen Vorbilder Haydn <strong>und</strong> Mozart in einer „biedermeierlichen“ Variante<br />
widerspiegeln, die die kontrapunktischen bzw. motivisch-thematischen Verfahren<br />
der Klassiker glättet <strong>und</strong> ihre leichter konsumierbaren Aspekte kultiviert.<br />
– die „Sonntagsmusiken“ bei der Familie Mendelssohn in Berlin, die in den<br />
1820er Jahren vor allem in der Leipziger Straße wohl bis zu 150 Personen<br />
versammelten, darunter Wissenschaftler, Politiker <strong>und</strong> Künstler des Vormärz-<br />
Berlin, <strong>und</strong> die sich auch durch ihre Konzentration auf ernstes Repertoire <strong>und</strong> ihr<br />
Augenmerk auf Publikumsdisziplin entschieden von der geselligen Anlage der<br />
Salons unterschieden, wie sie vielerorts <strong>und</strong> eben auch bei den Mendelssohns<br />
gepflegt wurden. Obwohl der ernste Kunstanspruch der Sonntagsmusiken sie<br />
durchaus etwa Felix Mendelssohn Bartholdys späteren Gewandhauskonzerten<br />
verwandt erscheinen lässt, der weite Personenkreis durchaus einen Großteil des<br />
gebildeten Berlin umfasste, waren sie doch, einer Äußerung von Lea Mendelssohn<br />
vom Mai 1823 nach zu schließen, bewusst nicht-öffentlich gehalten: „So ließ sichs<br />
auch ein dummer Hesel einfallen, unsrer Morgenkoncerte öffentlich zu erwähnen,<br />
eine unerhörte indiscrétion, da sie durchaus Privatgesellschaft sind.“<br />
Wie man sieht, gibt es zwischen den scheinbar so gegensätzlichen Begriffen<br />
„privat“ <strong>und</strong> „öffentlich“ eine Reihe von Zwischenstufen: unserer Terminologie<br />
folgend etwa Geselligkeit, Gesellschaft, Assoziation (vgl. Abschnitt 1). Unter<br />
Geselligkeit kann man etwa die „Schubertiaden“ verstehen, eine Gesellschaft<br />
entspricht dem Pariser Salon <strong>zur</strong> Zeit Chopins, wo die Besucher oft alles andere als<br />
gute Fre<strong>und</strong>e waren, aber auch die Mendelssohnschen Sonntagskonzerte. Weitere<br />
Aspekte, die <strong>zur</strong> differenzierten Betrachtung dieser Phänomene dienen können,<br />
sind:<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 13