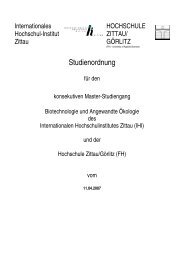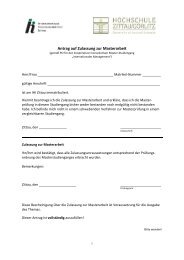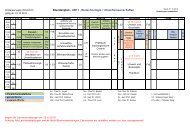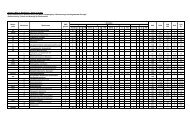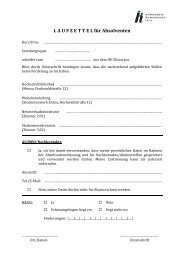Best-Practice-Studie - IHI Zittau
Best-Practice-Studie - IHI Zittau
Best-Practice-Studie - IHI Zittau
- TAGS
- zittau
- www.ihi-zittau.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
56<br />
5.4 Sicherheitstechnik<br />
5 EINZELDARSTELLUNGEN FÜR AUSGEWÄHLTE ZVEI-FACHVERBÄNDE 5.4 SICHERHEITSTECHNIK<br />
5.4.1 Marktentwicklung in der Sicherheitstechnik<br />
Im Fachverband Sicherheitstechnik sind ca. 60 Unternehmen organisiert. Das Markvolumen für elektrotechnische<br />
Sicherheitssysteme betrug im Jahr 2003 rund zwei Mrd. Euro. Davon entfielen ca. 90 % auf<br />
die im Verband organisierten Unternehmen.Bei den Dienstleistern handelt es sich überwiegend um kleinere<br />
Unternehmen, die aber oftmals die Marktführerschaft in ihrem jeweiligen Marktsegment besitzen.<br />
Unterteilen lässt sich der Markt für Sicherheitstechnik in kleinere Nischenmärkte mit einer jeweils sehr<br />
spezifischen Struktur. So können u. a. folgende Bereiche abgegrenzt werden: Brandmeldesysteme, Videoüberwachung,<br />
Einbruchsicherung, Gegensprechsysteme, Beschallungs- bzw. Evakuierungssysteme sowie<br />
Rauchmeldesysteme.<br />
In den letzten Jahren ist die Bedeutung von Sicherheit als „Gut“ für Unternehmen, jedoch auch für den<br />
Bürger weiter gestiegen. Dies ist unter anderem auf die Wahrnehmung der Gefahren durch den internationalen<br />
Terrorismus zurückzuführen. Im Bereich der Sicherheitsdienstleistungen haben sich die Großanbieter<br />
zu Systemanbietern entwickelt. Sie bieten ihren Kunden komplette Sicherheitspakete von der<br />
Analyse über die Beratung bis hin zur technischen Umsetzung an. Die Bereiche „Safety“ (u. a. Brandmeldetechnik)<br />
und „Security“ (Zutrittskontrolle, Einbruchmeldetechnik, Gebäudeüberwachung) konnten sich<br />
in den letzten Jahren gleichermaßen positiv entwickeln.<br />
In der Sicherheitstechnik haben sich weitgehend globale Maßstäbe mit weltweit identischen Produktpaletten<br />
durchgesetzt. Das „Managen“ von Sicherheitsprozessen hat sich zu einem globalen Thema entwickelt.<br />
In dem weltweiten Wettbewerb der großen Systemanbieter sind vor allem die britischen und<br />
amerikanischen Anbieter (Honeywell, Johnson Controlls) auf dem deutschen Markt aktiv. Während das<br />
Leistungsspektrum für Unternehmenskunden meist ohne größere Hemmnisse auf das jeweilige Anforderungsprofil<br />
umgesetzt werden kann, ist die Thematik der Sicherheitstechnik im öffentlichen Raum mit<br />
großen Vorbehalten bei Politik und Bürgern behaftet. Dass private Sicherheitsdienstleister im Rahmen<br />
langfristiger Betreibermodelle kostensparend für die öffentliche Hand tätig werden können, zeigt die<br />
seit langem praktizierte Überwachung von Bundeswehrstandorten. Dieses Projekt war anfänglich auf<br />
starke politische Widerstände gestoßen (siehe Tabelle 12 in Kapitel 5.4.4 <strong>Best</strong>-<strong>Practice</strong>).<br />
Bisherige ÖPP-Erfahrungen im Bereich der Sicherheitstechnik<br />
Derzeit werden bei den großen Systemanbietern (z. B. Bosch Sicherheitssysteme) etwa 15 bis 20 % des<br />
Umsatzes für die öffentliche Hand erbracht. Das mittel- und langfristig für dieses Kundensegment mögliche<br />
Marktpotential wurde jedoch von den befragten Experten als deutlich größer eingeschätzt.<br />
Im Gegensatz zu Großbritannien und den Niederlanden sind die Gebietskörperschaften in Deutschland<br />
noch weit von einer flächendeckenden Anwendung sicherheitstechnischer Überwachungssysteme im<br />
öffentlichen Raum entfernt. Zwar konnten in einigen deutschen Großstädten in den letzten Jahren positive<br />
Erfahrungen mit dem intensivierten Einsatz präventiver Videotechnik gesammelt werden. ÖPP-<br />
Projekte spielten dabei jedoch noch keine wesentliche Rolle. Die Auswertungen der Pilotprojekte zeigten<br />
in der Summe, dass durch eine Kamerapräsenz im öffentlichen Raum Vandalismusschäden deutlich verringert<br />
wurden. Beispielsweise konnten in Berliner U- und S-Bahnen Sachbeschädigungen durch den<br />
Kameraeinsatz um bis zu 85 % reduziert werden. Damit einhergehend war eine deutliche Zunahme der<br />
Nutzung speziell gekennzeichneter U- und S-Bahnen durch Kunden in der Altersgruppe von über<br />
50 Jahren zu verzeichnen.<br />
Derartige Formen der „Rückeroberung des öffentlichen Raumes“ bergen nach Ansicht der interviewten<br />
Unternehmensvertreter großes Potential für mögliche Öffentlich-Private Partnerschaften. Die „Sicherheitspartnerschaft<br />
für die moderne Stadt“ könnte nach Ansicht der Gesprächspartner für fast alle Städte zwischen<br />
50.000 und unter 100.000 Einwohnern Anwendung finden. Dabei gewinnt der Sicherheitsaspekt<br />
zunehmend auch als Faktor bei der touristischen und wirtschaftlichen Vermarktung der Städte an<br />
Bedeutung (Frankfurter Bahnhofs- und Bankenviertel).<br />
5 EINZELDARSTELLUNGEN FÜR AUSGEWÄHLTE ZVEI-FACHVERBÄNDE 5.4 SICHERHEITSTECHNIK<br />
Die noch über die beschriebenen Pilotprojekte hinausgehende Bündelung von Überwachungsaufgaben<br />
verschiedener Städte in Form interkommunaler Leitstellen mit entsprechenden Effekten der Kosteneinsparung<br />
wird in den Niederlanden bereits erfolgreich praktiziert.<br />
Als weitere Faktoren, die komplexere öffentlich-private und interkommunale Kooperationsmodelle im<br />
Bereich der Sicherheitstechnik begünstigen, sind zu nennen:<br />
• Eine wachsende Anzahl von Kooperationsprojekten zwischen Stadtverwaltungen und Zusammenschlüssen<br />
von Innenstadtkaufleuten, um – z. B. durch Videoüberwachung öffentlicher Räume – soziale<br />
Brennpunkte zu entschärfen;<br />
• neu geschaffene rechtliche und organisatorische Möglichkeiten in einigen Bundesländern (z. B.<br />
Hessen) für die Entlastung der regulären, fachlich hoch qualifizierten Polizeibeamten durch Polizeihilfskräfte<br />
mit deutlich kürzerer und einfacherer Ausbildung („Schutzpolizei“).<br />
Die Komplexität der Technik ist der wesentliche Punkt auf Grund dessen Kommunen effiziente private<br />
Anbieter bei Sicherheitsdienstleistungen für den öffentlichen Raum vermehrt in Anspruch nehmen.<br />
Service und Wartung mit den notwendigen technischen Anpassungen können dabei zumeist nur von privaten<br />
Anbietern umgesetzt werden, die über langjähriges technisches Know-how verfügen.<br />
Der Einbau einer komplexen sicherheitstechnischen Infrastruktur innerhalb geschlossener öffentlicher<br />
Gebäude („Safety“ & „Security“) wird dagegen bereits seit langem erfolgreich praktiziert. Der entscheidende<br />
Nutzen privater Projektbeteiligung für die öffentliche Hand besteht hier darin, dass der Kostenund<br />
Zeitaufwand für Planung, Installation, Betrieb, Projektmanagement und Finanzierung gegenüber konventionellen<br />
Projekten deutlich (im Durchschnitt um ca. 15 bis 20 %) verringert werden kann.<br />
5.4.2 ÖPP-Potentiale im Markt der Sicherheitstechnik<br />
Während in Großbritannien sowie in den Niederlanden die flächendeckende Überwachung der<br />
Innenstädte bereits seit einigen Jahren Alltagspraxis ist, sind innerstädtische Überwachungsprojekte in<br />
Deutschland bisher auf wenige Pilotprojekte beschränkt. Dass ÖPP auch im Sicherheitsbereich, z. B. in<br />
der Form langfristige Betreibermodelle, zweifelsfrei Vorteile birgt, zeigt die seit langem praktizierte<br />
Überwachung von Liegenschaften der Bundeswehr durch private Anbieter.<br />
Im öffentlichen Raum stehen den Vorteilen einer möglichen Steigerung des subjektiven Sicherheitsempfindens<br />
der Bürger sowie einer höheren Aufklärungsquote bei der Strafverfolgung Bedenken der<br />
Datenschützer und eine weit verbreitete Technikskepsis in der Bevölkerung gegenüber. Falls sich in der<br />
politischen und gesellschaftlichen Diskussion die Befürworter des Einsatzes technischer Überwachungssysteme<br />
durchsetzen, ist generell in allen Städten ab 50.000 Einwohnern sowie zusätzlich auch in kleineren<br />
Kommunen mit besonderem Gefährdungspotential in Agglomerationsräumen der Einsatz von<br />
Videoüberwachungs-Systemen denkbar. Je nach Umfang der Leistungen werden durch den privaten<br />
Anbieter die technischen Komponenten bereit gestellt, betrieben und gewartet.<br />
Neben den 82 Großstädten kommen auch die 109 Städte mit einer Einwohnerzahl von 50.000 bis unter<br />
100.000 sowie einige Dutzend kleinere Kommunen für einen Einsatz dieser technischen Systeme in<br />
Frage. Das Projektvolumen liegt dabei je nach Komplexität der Technik zwischen 30.000 Euro für<br />
Einzelkameras und bis zu 600.000 Euro für eine Systemüberwachung mit eigener IT und Leitstelle. Geht<br />
man von einem durchschnittlichen Projektvolumen von ca. 300.000 Euro aus, ergibt sich bei ca. 300<br />
möglichen neuen Anwenderkommunen in Deutschland ein zusätzliches Investitionspotential von ca. 90<br />
Mio. Euro für die Technik im öffentlichen Raum. Im Rahmen längerfristiger Betreiber- und Wartungsverträge<br />
errechnet sich dann ein darauf aufbauendes zusätzliches Potential in zweistelliger Millionenhöhe.<br />
Eine Ausdehnung der Überwachungsleistung auf weitere öffentliche Liegenschaften nach dem Vorbild<br />
der Kasernenüberwachung bietet daneben ein zusätzliches Potential. Langfristig ist von einem zusätzlichen<br />
Volumen für ÖPP-Projekte im Bereich der Sicherheitstechnik in einer Höhe von ca. 500 bis 700<br />
Mio. Euro p. a. auszugehen<br />
57